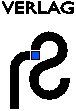Beiträge 2020
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle möchte ich aktuelle Entwicklungen in Form von Gesetzesnovellen und Urteilsanmerkungen aufzeigen und gleichzeitig Inhalte meiner Bücher aktualisieren. Für das Jahr 2020 werden bislang folgende Themen behandelt (Thema bitte durch Anklicken
auswählen):
- Unterlassungsanspruch bei Besitzstörung (hier: Haftung eines Falschparkers) (02.12.2020)
- Zur Strafbarkeit der Embryonenspende (07.11.2020)
- Gutgläubiger Erwerb einer unterschlagenen Sache vom Nichtberechtigten (21.10.2020)
- Zur Aufhebbarkeit von im Ausland geschlossenen Ehen mit Minderjährigen (17.08.2020)
- Zur Strafbarkeit des sog. Stealthing (14.08.2020)
- Namensführung der Kinder nach der Scheidung – hier: Einbenennung (§ 1618 BGB) (05.08.2020)
- Kündigung von Fitnessstudio-Verträgen (03.08.2020)
- Zur Frage nach Schadensersatzansprüchen im Diesel-Abgasskandal (01.08.2020)
- Kaufrechtliche Bestimmungen über Neu- und Gebrauchtsachen beim Tierkauf
(zugleich zur Frage nach der Unionsrechtskonformität des § 476 II BGB) (10.07.2020) - Sachmangel bei Kfz, wenn bei Zubehör(felgen) Betriebserlaubnis fehlt (27.06.2020)
- BND auch bei Auslandsaufklärung an Grundrechte des Grundgesetzes gebunden (24.05.2020)
- Polizei und Tätowierung – Zur Reichweite der beamtenrechtlichen Dienstpflichten (16.05.2020)
- Anleihenkauf der EZB – Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (09.05.2020)
- Verfassungswidrigkeit des Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbststötung (27.02.2020)
- Fahrlässige Brandstiftung durch Himmelslaterne und (un-)vermeidbarer Verbotsirrtum? (04.01.2020)
- Vorliegen eines Fernabsatzvertrags mit verbraucherschützendem Widerrufsrecht auch im Kfz-Handel? (01.01.2020)
02.12.2020: Unterlassungsanspruch bei Besitzstörung (hier: Haftung eines Falschparkers)
LG Mainz, Urteil v. 07.01.2020 – 6 S 39/19
Mit Urteil v. 07.01.2020 (6 S 39/19) hat das LG Mainz in seiner Funktion als Berufungsgericht entschieden, dass das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB darstelle und einen Unterlassungsanspruch des Berechtigten begründe. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
H, Eigentümer und Halter eines Kfz, überließ seinen Wagen einem Bekannten. Dieser stellte den Wagen unbefugt auf einem (mit einem Parkverbotsschild versehenen) Privatgrundstück ab und begab sich auf einen Stadtbummel. Der Grundstückseigentümer E fühlte sich in seinem Eigentumsrecht (siehe § 903 BGB) und seinem Besitzrecht (§§ 854 I, 858 I BGB) gestört. Er beauftragte einen Rechtsanwalt zur Halterermittlung und begehrte anschließend Unterlassung, die ebenfalls anwaltlich geltend gemacht wurde. Die Kosten der Halterermittlung betragen 100 € (davon 90 € Anwaltskosten) und die Kosten für die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 300 €.
II. Rechtliche Ausgangslage (Besitzstörung und Besitzschutzrechte)
Das unbefugte (d.h. widerrechtliche) Parken auf einem fremden Privatgrundstück stellt nach ganz h.M. eine Besitzstörung dar, die die Ausübung bestimmter Besitzschutzrechte ermöglicht:
Maßgebliche Voraussetzung für die genannten Gewaltrechte und possessorischen Besitzschutzansprüche ist, dass der Besitz im Wege der verbotenen Eigenmacht beeinträchtigt wird. Gemäß § 858 I BGB liegt eine verbotene Eigenmacht vor, wenn der Besitz ohne den Willen des Besitzers gestört oder entzogen wird, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet. Während eine Besitzentziehung vorliegt, wenn der Besitz des unmittelbaren Besitzers dauerhaft aufgehoben wird (BGH NJW 2008, 580; Herrler, in: Palandt, § 861 Rn. 4), spricht man von Besitzstörung bei jeder sonstigen Beeinträchtigung der tatsächlichen Sachherrschaft, die nicht als Besitzentziehung einzustufen ist (BGH NJW 2009, 1947 f.; Herrler, in: Palandt, § 862 Rn. 2).
Beispiele: Besitzstörungen können in physischen Einwirkungen jedweder Art bestehen. Dies kann durch eine Sachbeschädigung der Fall sein sowie durch sonstige Einschränkungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Besitzstörungen sind bspw. das Abklemmen von Versorgungsleitungen (z.B. für Gas, Wasser, Strom – OLG Köln NJW-RR 2001, 301, 302; LG Mannheim WuM 1963, 167, 168), das Betreten des vermieteten Gartens gegen den Willen des Mieters (OLG Frankfurt NStZ-RR 2000, 107; Fritzsche, in: Bamberger/Roth, 3. Aufl. 2012, § 858 Rn. 10 m.w.N.) und das unbefugte Abstellen des Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück (BGH NJW 2016, 863, 864; BGH NJW 2014, 3727; siehe auch BGH NJW 2012, 3781 f. mit Verweis auf BGHZ 181, 233, der allerdings offenließ, ob – mit Blick auf die gleichen Rechtsfolgen nach §§ 861, 862 BGB – das Parken auf einem fremden Grundstück eine Besitzstörung oder eine „teilweise Besitzentziehung“ ist).
Besteht zwischen den Kontrahenten ein Vertragsverhältnis, das ein Besitzrecht zum Gegenstand hat (Vermietung, Verpachtung), ordnet der BGH nicht jedes vertragswidrige Verhalten als verbotene Eigenmacht ein. So verhalte sich der Mieter, der den vereinbarten Mietzins nicht zahlt, zwar vertragswidrig; er begehe aber keine verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 I BGB. Es entspreche auch ständiger Rechtsprechung des BGH, dass dem Vermieter gegen den Mieter, der die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt, keine Besitzschutzansprüche aus § 859 I BGB zustünden (BGH NJW 2016, 863, 864 m.w.N.). Etwas anderes gilt nach dem BGH aber bei einem Vertrag über die kurzzeitige Nutzung eines jedermann zugänglichen privaten Parkplatzes (also i.d.R. ein Parkplatz, auf dem man nach Zahlung einer Gebühr den Wagen für eine begrenzte Zeit abstellen darf). Hier sei eine unbedingte Besitzverschaffung durch den Parkplatzbetreiber nicht geschuldet. Mache er das Parken von der Zahlung der Parkgebühr und dem Auslegen des Parkscheins abhängig, begehe derjenige verbotene Eigenmacht, der sein Fahrzeug abstellt, ohne sich daran zu halten (BGH NJW 2016, 863, 864).
Dieser Besitz muss ohne – aber nicht notwendig gegen – den Willen des unmittelbaren Besitzers gestört oder entzogen werden. Das ist der Fall, wenn zur Zeit der Besitzbeeinträchtigung keine ausdrücklich oder konkludent kundgegebene Zustimmung des unmittelbaren Besitzers vorliegt.
Schließlich darf die Besitzbeeinträchtigung nicht durch das Gesetz gestattet sein. Anderenfalls ist die Eigenmacht nicht verboten und Besitzschutzrechte kommen nicht in Betracht. Für eine Gestattung reicht es nach h.M. (siehe nur Herrler, in: Palandt, § 858 Rn. 6 m.w.N.) allerdings nicht aus, wenn die die Eigenmacht übende Person ein Recht zum Besitz hat, z.B. als Eigentümer oder Pfandgläubiger. Auch ein schuldrechtlicher Anspruch auf Besitzverschaffung ist nicht als Legitimation einer Besitzstörung oder Besitzentziehung anzusehen. In solchen Fällen ist derjenige, der den Anspruch auf Besitzverschaffung hat, auf gerichtliche Hilfe angewiesen.
Eine gesetzliche Gestattung, welche die Eigenmacht zulässt, besteht bei amtlichen, auf dem Gesetz basierenden Akten z.B. des Gerichts bzw. des Gerichtsvollziehers (§§ 758, 808, 883, 892 ZPO, 150 II ZVG) oder der Polizei (nach StPO oder Polizeirecht). Auf privatrechtlicher Basis stellen Gestattungsrechte i.S.d. § 858 BGB die Notwehr- und Selbsthilfebefugnisse dar (§ 127 I StPO, §§ 227, 228, 229, 859, 904-906, 962, 867 BGB).
Unmittelbare Rechtsfolge verbotener Eigenmacht ist der sog. fehlerhafte Besitz, § 858 II S. 1 BGB, der zu den genannten Abwehrrechten führt: Die Besitzwehr i.S.d. § 859 I BGB gibt dem unmittelbaren Besitzer das Recht, sich gegen eine drohende Entziehung oder anderweitige Störung des Besitzes mit Gewalt zu wehren, ohne dabei selbst verbotene Eigenmacht zu begehen. Voraussetzung ist, dass die verbotene Eigenmacht noch nicht abgeschlossen ist und auch noch kein Besitzverlust eingetreten ist. Typischer Anwendungsfall ist das Abschleppen(lassen) eines auf einem Privatgrundstück unerlaubt abgestellten Kfz (siehe etwa den Fall BGH NJW 2014, 3727). Bei vollendetem Besitzentzug ist Besitzwehr dagegen nicht mehr möglich. Für diesen Fall greifen möglicherweise § 859 II BGB (bei beweglichen Sachen) oder § 859 III BGB (bei unbeweglichen Sachen).
Obgleich § 859 I BGB kein weiteres Erfordernis nennt, ist anerkannt, dass die Besitzwehr nur dann rechtmäßig ist, wenn die Gewaltanwendung geeignet und erforderlich ist, die Störung zu beseitigen. Am Merkmal der Geeignetheit mangelt es bspw., wenn bloße Reaktionen auf die Störung ohne Abwehrcharakter vorliegen wie z.B. bei der Verhinderung des Wegfahrens eines störenden Fahrzeugs (OLG Hamm MDR 1969, 601, 602). Erforderlich ist ein Mittel, wenn es unter gleich wirksamen Mitteln das mildeste darstellt. Das Abschleppen(lassen) eines auf einem Privatgrundstück unerlaubt abgestellten Kfz ist i.d.R. ein zulässiges Mittel (BGH WM 1968, 1356, 1357; Joost, in: MüKo, § 859 Rn. 10; Herrler, in: Palandt, § 859 Rn. 2).
Neben den genannten Gewaltrechten (Selbsthilferechten) sind auch possessorische Besitzschutzrechte möglich. Dem Eigentümer einer Sache steht bei einem Besitzentzug der dingliche Herausgabeanspruch des § 985 BGB und bei einer Besitzstörung der Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch des § 1004 BGB zu. Auch aus dem Besitz als nicht dingliche Rechtsposition lassen sich Ansprüche ableiten, die vor Gericht verwirklicht werden können. So stellt das Gesetz dem Besitzer einer Sache für den Fall des Besitzentzugs die Rechte aus § 861 BGB und bei einer Besitzstörung den Anspruch aus § 862 BGB zur Seite. Diese Ansprüche stehen dem in seiner Sachherrschaft gestörten Besitzer teilweise neben den Gewaltrechten zu; sie sind teilweise aber auch seine einzigen Abwehrmöglichkeiten. Letzteres ist dann der Fall, wenn die Ausübung der Gewaltrechte aufgrund einer Überschreitung der Zeitgrenze präkludiert ist.
Besitzschutzanspruch gem. § 861 BGB: Der Anspruch aus § 861 BGB ist auf die Wiedereinräumung des durch eine verbotene Eigenmacht entzogenen Besitzes gerichtet und stellt damit sozusagen das besitzrechtliche Pendant zum dinglichen Herausgabeanspruch des Eigentümers aus § 985 BGB dar.
Besitzschutzanspruch gem. § 862 BGB: Der Anspruch aus § 862 BGB ist auf die Beseitigung oder Unterlassung einer durch verbotene Eigenmacht erfolgten Besitzstörung gerichtet und stellt damit das possessorische Pendant zu dem dinglichen Anspruch aus § 1004 BGB dar. Die Voraussetzungen und Beschränkungen sind weitgehend identisch mit denen des Anspruchs aus § 861 BGB, wobei im Rahmen des § 862 BGB auf die Besonderheiten der Besitzstörung – im Gegensatz zum Besitzentzug – zu achten ist. Anspruchsberechtigt ist – wie bei § 861 BGB – der unmittelbare Besitzer. Der (unmittelbare) Besitz muss weiterhin durch verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 I BGB gestört werden, d.h. es darf noch keine vollendete Besitzentziehung vorliegen (dann § 861 BGB). Hinsichtlich der Rechtsfolge ist zwischen den beiden Varianten des § 862 I BGB zu unterscheiden:
III. Prüfung des Falls/Entscheidung des LG Mainz
Besitzrechtlich könnte sich der Anspruch auf Unterlassung aus § 862 I S. 2 BGB i.V.m. § 862 I S. 1 BGB ergeben. Danach kann der Besitzer auf Unterlassung klagen, wenn weitere durch verbotene Eigenmacht verursachte Besitzstörungen zu besorgen sind. Voraussetzungen sind also eine bereits erfolgte verbotene Eigenmacht und eine Wiederholungsgefahr. Wie der BGH konstatiert, stellt das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB dar (BGH NJW 2016, 863, 864; BGH NJW 2014, 3727; siehe auch BGH NJW 2012, 3781 f. mit Verweis auf BGHZ 181, 233, der allerdings offenließ, ob – mit Blick auf die gleichen Rechtsfolgen nach §§ 861, 862 BGB – das Parken auf einem fremden Grundstück eine Besitzstörung oder eine „teilweise Besitzentziehung“ ist; siehe auch LG Mainz 07.01.2020 – 6 S 39/19). Das darf jedoch nicht undifferenziert verstanden werden. Richtigerweise wird man danach unterscheiden müssen, ob das Parkverbot durch Parkverbotsschild gekennzeichnet ist oder sich das Parkverbot zumindest aus den Umständen ergibt. Nur wenn das der Fall ist, lässt sich eine Besitzstörung bejahen. Handelt es sich bei der Verkehrsfläche um eine allgemein zugängliche Fläche ohne Hinweise auf ein Parkverbot, wird man eine Besitzstörung verneinen müssen. Liegt aber eine Besitzstörung vor, löst sie bestimmte besitzschutzrechtliche Folgerechte aus wie Besitzwehr gem. § 859 I BGB (hier: Abschleppenlassen des verbotswidrig abgestellten Kfz) und Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gem. § 862 BGB. Für einen Unterlassungsanspruch müsste H aber auch für die Störung verantwortlich sein. Da H nicht selbst den Wagen auf dem Grundstück des E abgestellt hat, kommt lediglich eine Zustandsverantwortlichkeit in Betracht. Der BGH hat entschieden, dass Zustandsstörer ist, wer sein Fahrzeug einer anderen Person zur Benutzung im Straßenverkehr überlassen und damit das Risiko übernommen hat, dass sich der Nutzer nicht an die allgemeinen Verhaltensregeln hält und das Fahrzeug unberechtigt auf fremdem Privatgrund abstellt (BGH NJW 2012, 3781 f.; siehe auch BGH NJW 2016, 863, 864). Da das Falschparken auf einem Privatgrundstück kein außergewöhnliches Verhalten eines Verkehrsteilnehmers darstelle, mit dem der Halter nicht zu rechnen habe, sei es sachgerecht, ihm als Halter die Verantwortung aufzuerlegen, wenn sich die mit der freiwilligen Fahrzeugüberlassung geschaffene Gefahr des unberechtigten Parkens tatsächlich realisiert (BGH NJW 2012, 3781). Das sei bei H der Fall. Nach der hier vertretenen Auffassung überzeugt diese Argumentation aber nicht. Denn sie führt dazu, dass jeder Halter, der sein Kfz vermietet oder verleiht, „über die Hintertür“ für Parkverstöße des Fahrers verantwortlich ist. Offenbar hat sich der BGH an der Regelung des § 25a StVG orientiert, wonach bei Parkverstößen, bei denen der Fahrer nicht ermittelt werden kann, mitunter der Halter zur Verantwortung gezogen werden kann. Jedoch ist eine solche vergleichende Betrachtung abzulehnen, weil § 25a StVG den öffentlichen Verkehrsraum betrifft, eine andere Zielsetzung verfolgt und weder analogie- noch verallgemeinerungsfähig ist.
Fraglich ist weiterhin, ob eine Wiederholungsgefahr besteht. Der BGH ist der Auffassung, dass selbst bei einem einmaligen bzw. erstmaligen unbefugten Abstellen eines Kfz auf einem fremden Grundstück die tatsächliche Vermutung dafür bestehe, dass sich die Beeinträchtigung wiederhole, was den Unterlassungsanspruch begründe (BGH NJW 2016, 863, 865; BGH NJW 2012, 3781, 3782 mit Verweis auf BGH ZUM 2011, 333, 336; BGH NJW 2004, 1035, 1036). Das gelte in Bezug auf die Zustandsverantwortlichkeit jedenfalls dann, wenn der Halter (= der Zustandsstörer) sich weigere, den Fahrer zu benennen (BGH NJW 2016, 863, 865). Auch dies überzeugt nicht. Die vom Besitzer geltend gemachte Wiederholungsgefahr muss sich schon noch auf begründete Tatsachen stützen lassen. Wohnt der Falschparker z.B. in einem anderen Ort und bestehen auch keine (sonstigen) Anhaltspunkte dafür, dass er die Besitzstörung wiederholt, kann man nicht schlicht eine Wiederholungsgefahr annehmen. Und auch die Weigerung des Halters, den Namen des Fahrers zu benennen, kann keine Wiederholungsgefahr begründen. Gerade, wenn es sich um ein Näheverhältnis zum Fahrer handelt, ist es nachvollziehbar, den Namen des Fahrers nicht zu offenbaren. Deshalb eine Wiederholungsgefahr zu unterstellen, geht an der Sache vorbei.
Ist demnach der Unterlassungsanspruch begründet, stellt sich die Folgefrage, ob E die Anwaltskosten (Aufwendungen für die Halterermittlung und die Unterlassungsaufforderung) erstattet (bzw. eine Freistellung) verlangen kann. Anspruchsgrundlage könnte § 683 S. 1 i.V.m. §§ 677, 670 BGB sein (Aufwendungsersatz nach berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag). Nach § 670 BGB sind solche Aufwendungen ersatzfähig, die der Geschäftsführer den Umständen nach für erforderlich halten darf. Wie der BGH in ständiger Rechtsprechung entscheidet, ist maßgeblich, was der Geschäftsführer nach sorgfältiger Prüfung der ihm bekannten Umstände vernünftigerweise aufzuwenden hatte. Dies könne nicht allgemein bestimmt werden, sondern bemesse sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls, deren Würdigung der tatrichterlichen Beurteilung obliege. Sei die rechtliche Angelegenheit nicht einfach gelagert, sondern bedürfe der Beurteilung durch einen Rechtsanwalt, seien die Kosten für die Inanspruchnahme von § 670 BGB erfasst (BGH NJW 2012, 3781, 3782).
Geht es um die Abwehr von Rechtsverletzungen, liegt es nach der Rspr. grundsätzlich im Interesse des (dem Rechtsinhaber namentlich bekannten) Rechtsverletzers, abgemahnt zu werden, weil er dadurch Gelegenheit erhalte, einen kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden (BGH NJW 2016, 863, 866). Das gelte insbesondere bei urheberrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen (BGH NJW 2016, 863, 866.) Auch bei Parkverstößen hat der BGH die Aufwendungen zur Ermittlung des Fahrzeughalters in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit der Kosten einer berechtigten außergerichtlichen Abmahnung lange Zeit als zur Vorbereitung der an den Zustandsstörer gerichteten Unterlassungsaufforderung erforderlich und nach § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB als ersatzfähig angesehen (BGH NJW 2012, 3781 f.). In seiner aktuellen Rechtsprechung sieht der BGH das jedoch anders. Es entspreche nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden. Es könne nicht angenommen werden, dass er ein Interesse daran habe, aus der Anonymität herauszutreten, um auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden (BGH NJW 2016, 863, 866). Anders könne der Fall lediglich liegen, wenn das unbefugt abgestellte Fahrzeug abgeschleppt werde (BGH NJW 2016, 863, 866).
Entspricht es also bei Parkverstößen nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden, darf der Geschäftsführer die damit verbundenen Kosten der Halterermittlung den Umständen nach auch nicht für erforderlich halten.
Zwischenergebnis: Ein Ersatzanspruch aus § 683 S. 1 i.V.m. §§ 677, 670 BGB wegen der Halterermittlungskosten ist danach also nicht gegeben. Ein solcher kann auch nicht aus § 823 II BGB angenommen werden. Zwar ist § 858 I BGB ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II BGB. Jedoch hat der BGH zutreffend festgestellt, dass es regelmäßig am Verschulden (d.h. an der wenigstens erforderlichen Fahrlässigkeit) fehlt. Der Halter habe es nicht zu vertreten, wenn der Fahrer das Kfz verbotswidrig abstelle (BGH NJW 2016, 863, 866).
Ist ein Anspruch wegen der Halterermittlungskosten nicht gegeben, stellt sich die Frage, ob das auch hinsichtlich der anwaltlichen Kosten für die Aufforderung zur Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung gilt. Aus dem Urteil BGH NJW 2016, 863 geht das nicht eindeutig hervor. Jedoch geht das LG Mainz mit Urteil v. 07.01.2020 (Az. 6 S 39/19) ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten in Bezug auf die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aus § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB gegeben ist.
Fazit: Auch nach der geänderten BGH-Rechtsprechung stellt das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB jedenfalls dann dar, wenn sich das Parkverbot zumindest aus den Umständen ergibt. Auch besteht die Vermutung der Wiederholungsgefahr und der Besitzer hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Falschparker (Besitzstörer). Die vom Besitzer geltend gemachte Wiederholungsgefahr muss aber begründet sein, was nicht der Fall ist, wenn der Falschparker z.B. in einem anderen Ort wohnt und auch keine (sonstigen) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er die Besitzstörung wiederholt.
Zu der (in der Praxis allein relevanten) Frage nach der Kostenerstattung hat der BGH entschieden, dass die Kosten der Halterermittlung nicht erstattungsfähig sind, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Es entspreche nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden. Es könne nicht angenommen werden, dass er ein Interesse daran habe, aus der Anonymität herauszutreten, um auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Da die Prüfung, ob ein Unterlassungsanspruch besteht, aber nicht einfach gelagert ist, gehen die Gerichte nach wie vor davon aus, dass ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten in Bezug auf die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aus § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB gegeben ist.
Rolf Schmidt (02.12.2020)
LG Mainz, Urteil v. 07.01.2020 – 6 S 39/19
Mit Urteil v. 07.01.2020 (6 S 39/19) hat das LG Mainz in seiner Funktion als Berufungsgericht entschieden, dass das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB darstelle und einen Unterlassungsanspruch des Berechtigten begründe. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
H, Eigentümer und Halter eines Kfz, überließ seinen Wagen einem Bekannten. Dieser stellte den Wagen unbefugt auf einem (mit einem Parkverbotsschild versehenen) Privatgrundstück ab und begab sich auf einen Stadtbummel. Der Grundstückseigentümer E fühlte sich in seinem Eigentumsrecht (siehe § 903 BGB) und seinem Besitzrecht (§§ 854 I, 858 I BGB) gestört. Er beauftragte einen Rechtsanwalt zur Halterermittlung und begehrte anschließend Unterlassung, die ebenfalls anwaltlich geltend gemacht wurde. Die Kosten der Halterermittlung betragen 100 € (davon 90 € Anwaltskosten) und die Kosten für die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 300 €.
II. Rechtliche Ausgangslage (Besitzstörung und Besitzschutzrechte)
Das unbefugte (d.h. widerrechtliche) Parken auf einem fremden Privatgrundstück stellt nach ganz h.M. eine Besitzstörung dar, die die Ausübung bestimmter Besitzschutzrechte ermöglicht:
- Zunächst stellen die sog. Gewaltrechte dem Besitzer und dem Besitzdiener die Möglichkeit zur Seite, sich gegen die verbotene Eigenmacht eines anderen (§ 858 BGB) mit Gewalt zu wehren, § 859 BGB (Selbsthilfe des Besitzers) und § 860 BGB (Selbsthilfe des Besitzdieners, also desjenigen, der die tatsächliche Gewalt nach § 855 BGB für den Besitzer ausübt). Die Gewaltrechte sind keine Ansprüche im rechtlichen Sinne (zur Anspruchsdefinition vgl. § 194 I BGB), sondern besondere Formen der Notwehr bzw. Selbsthilfe. Anknüpfungspunkt ist jeweils der Besitz einer Person – ungeachtet eines Besitzrechts – und die Ausübung verbotener Eigenmacht durch eine andere Person.
- §§ 861, 862 BGB vermitteln dem Besitzer im Fall einer durch verbotene Eigenmacht erfolgten Besitzstörung bzw. -entziehung verschiedene Besitzschutzansprüche für die Wiederherstellung der vorherigen Besitzlage. Die Ansprüche – die gem. § 869 BGB auch dem mittelbaren Besitzer zustehen können – entstehen unabhängig von einem materiellen Besitzrecht und stützen sich allein auf den Besitz als Tatsache. Sie werden daher possessorische Besitzschutzansprüche genannt. Diese Ansprüche werden durch § 867 BGB ergänzt.
- Im Gegensatz zu den possessorischen Besitzschutzansprüchen schützen die petitorischen Besitzschutzrechte nicht den Besitz als solchen, sondern das Recht zum Besitz. Petitorischer Rechtsschutz wird durch §§ 1007, 1004, 985, 823 und 812 BGB vermittelt.
Maßgebliche Voraussetzung für die genannten Gewaltrechte und possessorischen Besitzschutzansprüche ist, dass der Besitz im Wege der verbotenen Eigenmacht beeinträchtigt wird. Gemäß § 858 I BGB liegt eine verbotene Eigenmacht vor, wenn der Besitz ohne den Willen des Besitzers gestört oder entzogen wird, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet. Während eine Besitzentziehung vorliegt, wenn der Besitz des unmittelbaren Besitzers dauerhaft aufgehoben wird (BGH NJW 2008, 580; Herrler, in: Palandt, § 861 Rn. 4), spricht man von Besitzstörung bei jeder sonstigen Beeinträchtigung der tatsächlichen Sachherrschaft, die nicht als Besitzentziehung einzustufen ist (BGH NJW 2009, 1947 f.; Herrler, in: Palandt, § 862 Rn. 2).
Beispiele: Besitzstörungen können in physischen Einwirkungen jedweder Art bestehen. Dies kann durch eine Sachbeschädigung der Fall sein sowie durch sonstige Einschränkungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Besitzstörungen sind bspw. das Abklemmen von Versorgungsleitungen (z.B. für Gas, Wasser, Strom – OLG Köln NJW-RR 2001, 301, 302; LG Mannheim WuM 1963, 167, 168), das Betreten des vermieteten Gartens gegen den Willen des Mieters (OLG Frankfurt NStZ-RR 2000, 107; Fritzsche, in: Bamberger/Roth, 3. Aufl. 2012, § 858 Rn. 10 m.w.N.) und das unbefugte Abstellen des Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück (BGH NJW 2016, 863, 864; BGH NJW 2014, 3727; siehe auch BGH NJW 2012, 3781 f. mit Verweis auf BGHZ 181, 233, der allerdings offenließ, ob – mit Blick auf die gleichen Rechtsfolgen nach §§ 861, 862 BGB – das Parken auf einem fremden Grundstück eine Besitzstörung oder eine „teilweise Besitzentziehung“ ist).
Besteht zwischen den Kontrahenten ein Vertragsverhältnis, das ein Besitzrecht zum Gegenstand hat (Vermietung, Verpachtung), ordnet der BGH nicht jedes vertragswidrige Verhalten als verbotene Eigenmacht ein. So verhalte sich der Mieter, der den vereinbarten Mietzins nicht zahlt, zwar vertragswidrig; er begehe aber keine verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 I BGB. Es entspreche auch ständiger Rechtsprechung des BGH, dass dem Vermieter gegen den Mieter, der die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt, keine Besitzschutzansprüche aus § 859 I BGB zustünden (BGH NJW 2016, 863, 864 m.w.N.). Etwas anderes gilt nach dem BGH aber bei einem Vertrag über die kurzzeitige Nutzung eines jedermann zugänglichen privaten Parkplatzes (also i.d.R. ein Parkplatz, auf dem man nach Zahlung einer Gebühr den Wagen für eine begrenzte Zeit abstellen darf). Hier sei eine unbedingte Besitzverschaffung durch den Parkplatzbetreiber nicht geschuldet. Mache er das Parken von der Zahlung der Parkgebühr und dem Auslegen des Parkscheins abhängig, begehe derjenige verbotene Eigenmacht, der sein Fahrzeug abstellt, ohne sich daran zu halten (BGH NJW 2016, 863, 864).
Dieser Besitz muss ohne – aber nicht notwendig gegen – den Willen des unmittelbaren Besitzers gestört oder entzogen werden. Das ist der Fall, wenn zur Zeit der Besitzbeeinträchtigung keine ausdrücklich oder konkludent kundgegebene Zustimmung des unmittelbaren Besitzers vorliegt.
Schließlich darf die Besitzbeeinträchtigung nicht durch das Gesetz gestattet sein. Anderenfalls ist die Eigenmacht nicht verboten und Besitzschutzrechte kommen nicht in Betracht. Für eine Gestattung reicht es nach h.M. (siehe nur Herrler, in: Palandt, § 858 Rn. 6 m.w.N.) allerdings nicht aus, wenn die die Eigenmacht übende Person ein Recht zum Besitz hat, z.B. als Eigentümer oder Pfandgläubiger. Auch ein schuldrechtlicher Anspruch auf Besitzverschaffung ist nicht als Legitimation einer Besitzstörung oder Besitzentziehung anzusehen. In solchen Fällen ist derjenige, der den Anspruch auf Besitzverschaffung hat, auf gerichtliche Hilfe angewiesen.
Eine gesetzliche Gestattung, welche die Eigenmacht zulässt, besteht bei amtlichen, auf dem Gesetz basierenden Akten z.B. des Gerichts bzw. des Gerichtsvollziehers (§§ 758, 808, 883, 892 ZPO, 150 II ZVG) oder der Polizei (nach StPO oder Polizeirecht). Auf privatrechtlicher Basis stellen Gestattungsrechte i.S.d. § 858 BGB die Notwehr- und Selbsthilfebefugnisse dar (§ 127 I StPO, §§ 227, 228, 229, 859, 904-906, 962, 867 BGB).
Unmittelbare Rechtsfolge verbotener Eigenmacht ist der sog. fehlerhafte Besitz, § 858 II S. 1 BGB, der zu den genannten Abwehrrechten führt: Die Besitzwehr i.S.d. § 859 I BGB gibt dem unmittelbaren Besitzer das Recht, sich gegen eine drohende Entziehung oder anderweitige Störung des Besitzes mit Gewalt zu wehren, ohne dabei selbst verbotene Eigenmacht zu begehen. Voraussetzung ist, dass die verbotene Eigenmacht noch nicht abgeschlossen ist und auch noch kein Besitzverlust eingetreten ist. Typischer Anwendungsfall ist das Abschleppen(lassen) eines auf einem Privatgrundstück unerlaubt abgestellten Kfz (siehe etwa den Fall BGH NJW 2014, 3727). Bei vollendetem Besitzentzug ist Besitzwehr dagegen nicht mehr möglich. Für diesen Fall greifen möglicherweise § 859 II BGB (bei beweglichen Sachen) oder § 859 III BGB (bei unbeweglichen Sachen).
Obgleich § 859 I BGB kein weiteres Erfordernis nennt, ist anerkannt, dass die Besitzwehr nur dann rechtmäßig ist, wenn die Gewaltanwendung geeignet und erforderlich ist, die Störung zu beseitigen. Am Merkmal der Geeignetheit mangelt es bspw., wenn bloße Reaktionen auf die Störung ohne Abwehrcharakter vorliegen wie z.B. bei der Verhinderung des Wegfahrens eines störenden Fahrzeugs (OLG Hamm MDR 1969, 601, 602). Erforderlich ist ein Mittel, wenn es unter gleich wirksamen Mitteln das mildeste darstellt. Das Abschleppen(lassen) eines auf einem Privatgrundstück unerlaubt abgestellten Kfz ist i.d.R. ein zulässiges Mittel (BGH WM 1968, 1356, 1357; Joost, in: MüKo, § 859 Rn. 10; Herrler, in: Palandt, § 859 Rn. 2).
Neben den genannten Gewaltrechten (Selbsthilferechten) sind auch possessorische Besitzschutzrechte möglich. Dem Eigentümer einer Sache steht bei einem Besitzentzug der dingliche Herausgabeanspruch des § 985 BGB und bei einer Besitzstörung der Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch des § 1004 BGB zu. Auch aus dem Besitz als nicht dingliche Rechtsposition lassen sich Ansprüche ableiten, die vor Gericht verwirklicht werden können. So stellt das Gesetz dem Besitzer einer Sache für den Fall des Besitzentzugs die Rechte aus § 861 BGB und bei einer Besitzstörung den Anspruch aus § 862 BGB zur Seite. Diese Ansprüche stehen dem in seiner Sachherrschaft gestörten Besitzer teilweise neben den Gewaltrechten zu; sie sind teilweise aber auch seine einzigen Abwehrmöglichkeiten. Letzteres ist dann der Fall, wenn die Ausübung der Gewaltrechte aufgrund einer Überschreitung der Zeitgrenze präkludiert ist.
Besitzschutzanspruch gem. § 861 BGB: Der Anspruch aus § 861 BGB ist auf die Wiedereinräumung des durch eine verbotene Eigenmacht entzogenen Besitzes gerichtet und stellt damit sozusagen das besitzrechtliche Pendant zum dinglichen Herausgabeanspruch des Eigentümers aus § 985 BGB dar.
Besitzschutzanspruch gem. § 862 BGB: Der Anspruch aus § 862 BGB ist auf die Beseitigung oder Unterlassung einer durch verbotene Eigenmacht erfolgten Besitzstörung gerichtet und stellt damit das possessorische Pendant zu dem dinglichen Anspruch aus § 1004 BGB dar. Die Voraussetzungen und Beschränkungen sind weitgehend identisch mit denen des Anspruchs aus § 861 BGB, wobei im Rahmen des § 862 BGB auf die Besonderheiten der Besitzstörung – im Gegensatz zum Besitzentzug – zu achten ist. Anspruchsberechtigt ist – wie bei § 861 BGB – der unmittelbare Besitzer. Der (unmittelbare) Besitz muss weiterhin durch verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 I BGB gestört werden, d.h. es darf noch keine vollendete Besitzentziehung vorliegen (dann § 861 BGB). Hinsichtlich der Rechtsfolge ist zwischen den beiden Varianten des § 862 I BGB zu unterscheiden:
- Der Beseitigungsanspruch hat zum Ziel, dass der Gegner durch ein aktives Tun oder Unterlassen einen den Besitz störenden Zustand beseitigt. Er erfordert daher eine auf verbotener Eigenmacht beruhende fortdauernde Störung des Besitzes (Joost, in: MüKo, § 862 Rn. 2). Wurde die Störung bereits vom Besitzer beseitigt oder ist sie aus anderem Grund beendet, entfällt der Anspruch und es kommt allenfalls – bei Wiederholungsgefahr – ein Unterlassungsanspruch i.S.d. 2. Variante in Betracht.
- Der Unterlassungsanspruch ist auf die Vermeidung künftiger Störungen gerichtet. Er erfordert somit das Vorliegen einer konkreten Gefahr zukünftiger Störungen, die in der Regel aus wiederholten Störungen der Vergangenheit geschlossen werden kann (z.B. wenn jeden Samstag Lärm gemacht wird oder wenn sich ständig Werbung im Briefkasten befindet trotz eines Aufklebers „bitte keine Werbung“), sich im Einzelfall aber auch aus anderen Umständen ergibt (z.B. bei der Vorbereitung einer Baustelle). Auch das bereits abgeschlossene unbefugte Parken auf einem fremden Grundstück kann einen Unterlassungsanspruch begründen, insbesondere, wenn die Gefahr einer wiederholten Besitzstörung besteht (BGH NJW 2012, 3781 f.).
III. Prüfung des Falls/Entscheidung des LG Mainz
Besitzrechtlich könnte sich der Anspruch auf Unterlassung aus § 862 I S. 2 BGB i.V.m. § 862 I S. 1 BGB ergeben. Danach kann der Besitzer auf Unterlassung klagen, wenn weitere durch verbotene Eigenmacht verursachte Besitzstörungen zu besorgen sind. Voraussetzungen sind also eine bereits erfolgte verbotene Eigenmacht und eine Wiederholungsgefahr. Wie der BGH konstatiert, stellt das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB dar (BGH NJW 2016, 863, 864; BGH NJW 2014, 3727; siehe auch BGH NJW 2012, 3781 f. mit Verweis auf BGHZ 181, 233, der allerdings offenließ, ob – mit Blick auf die gleichen Rechtsfolgen nach §§ 861, 862 BGB – das Parken auf einem fremden Grundstück eine Besitzstörung oder eine „teilweise Besitzentziehung“ ist; siehe auch LG Mainz 07.01.2020 – 6 S 39/19). Das darf jedoch nicht undifferenziert verstanden werden. Richtigerweise wird man danach unterscheiden müssen, ob das Parkverbot durch Parkverbotsschild gekennzeichnet ist oder sich das Parkverbot zumindest aus den Umständen ergibt. Nur wenn das der Fall ist, lässt sich eine Besitzstörung bejahen. Handelt es sich bei der Verkehrsfläche um eine allgemein zugängliche Fläche ohne Hinweise auf ein Parkverbot, wird man eine Besitzstörung verneinen müssen. Liegt aber eine Besitzstörung vor, löst sie bestimmte besitzschutzrechtliche Folgerechte aus wie Besitzwehr gem. § 859 I BGB (hier: Abschleppenlassen des verbotswidrig abgestellten Kfz) und Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gem. § 862 BGB. Für einen Unterlassungsanspruch müsste H aber auch für die Störung verantwortlich sein. Da H nicht selbst den Wagen auf dem Grundstück des E abgestellt hat, kommt lediglich eine Zustandsverantwortlichkeit in Betracht. Der BGH hat entschieden, dass Zustandsstörer ist, wer sein Fahrzeug einer anderen Person zur Benutzung im Straßenverkehr überlassen und damit das Risiko übernommen hat, dass sich der Nutzer nicht an die allgemeinen Verhaltensregeln hält und das Fahrzeug unberechtigt auf fremdem Privatgrund abstellt (BGH NJW 2012, 3781 f.; siehe auch BGH NJW 2016, 863, 864). Da das Falschparken auf einem Privatgrundstück kein außergewöhnliches Verhalten eines Verkehrsteilnehmers darstelle, mit dem der Halter nicht zu rechnen habe, sei es sachgerecht, ihm als Halter die Verantwortung aufzuerlegen, wenn sich die mit der freiwilligen Fahrzeugüberlassung geschaffene Gefahr des unberechtigten Parkens tatsächlich realisiert (BGH NJW 2012, 3781). Das sei bei H der Fall. Nach der hier vertretenen Auffassung überzeugt diese Argumentation aber nicht. Denn sie führt dazu, dass jeder Halter, der sein Kfz vermietet oder verleiht, „über die Hintertür“ für Parkverstöße des Fahrers verantwortlich ist. Offenbar hat sich der BGH an der Regelung des § 25a StVG orientiert, wonach bei Parkverstößen, bei denen der Fahrer nicht ermittelt werden kann, mitunter der Halter zur Verantwortung gezogen werden kann. Jedoch ist eine solche vergleichende Betrachtung abzulehnen, weil § 25a StVG den öffentlichen Verkehrsraum betrifft, eine andere Zielsetzung verfolgt und weder analogie- noch verallgemeinerungsfähig ist.
Fraglich ist weiterhin, ob eine Wiederholungsgefahr besteht. Der BGH ist der Auffassung, dass selbst bei einem einmaligen bzw. erstmaligen unbefugten Abstellen eines Kfz auf einem fremden Grundstück die tatsächliche Vermutung dafür bestehe, dass sich die Beeinträchtigung wiederhole, was den Unterlassungsanspruch begründe (BGH NJW 2016, 863, 865; BGH NJW 2012, 3781, 3782 mit Verweis auf BGH ZUM 2011, 333, 336; BGH NJW 2004, 1035, 1036). Das gelte in Bezug auf die Zustandsverantwortlichkeit jedenfalls dann, wenn der Halter (= der Zustandsstörer) sich weigere, den Fahrer zu benennen (BGH NJW 2016, 863, 865). Auch dies überzeugt nicht. Die vom Besitzer geltend gemachte Wiederholungsgefahr muss sich schon noch auf begründete Tatsachen stützen lassen. Wohnt der Falschparker z.B. in einem anderen Ort und bestehen auch keine (sonstigen) Anhaltspunkte dafür, dass er die Besitzstörung wiederholt, kann man nicht schlicht eine Wiederholungsgefahr annehmen. Und auch die Weigerung des Halters, den Namen des Fahrers zu benennen, kann keine Wiederholungsgefahr begründen. Gerade, wenn es sich um ein Näheverhältnis zum Fahrer handelt, ist es nachvollziehbar, den Namen des Fahrers nicht zu offenbaren. Deshalb eine Wiederholungsgefahr zu unterstellen, geht an der Sache vorbei.
Ist demnach der Unterlassungsanspruch begründet, stellt sich die Folgefrage, ob E die Anwaltskosten (Aufwendungen für die Halterermittlung und die Unterlassungsaufforderung) erstattet (bzw. eine Freistellung) verlangen kann. Anspruchsgrundlage könnte § 683 S. 1 i.V.m. §§ 677, 670 BGB sein (Aufwendungsersatz nach berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag). Nach § 670 BGB sind solche Aufwendungen ersatzfähig, die der Geschäftsführer den Umständen nach für erforderlich halten darf. Wie der BGH in ständiger Rechtsprechung entscheidet, ist maßgeblich, was der Geschäftsführer nach sorgfältiger Prüfung der ihm bekannten Umstände vernünftigerweise aufzuwenden hatte. Dies könne nicht allgemein bestimmt werden, sondern bemesse sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls, deren Würdigung der tatrichterlichen Beurteilung obliege. Sei die rechtliche Angelegenheit nicht einfach gelagert, sondern bedürfe der Beurteilung durch einen Rechtsanwalt, seien die Kosten für die Inanspruchnahme von § 670 BGB erfasst (BGH NJW 2012, 3781, 3782).
Geht es um die Abwehr von Rechtsverletzungen, liegt es nach der Rspr. grundsätzlich im Interesse des (dem Rechtsinhaber namentlich bekannten) Rechtsverletzers, abgemahnt zu werden, weil er dadurch Gelegenheit erhalte, einen kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden (BGH NJW 2016, 863, 866). Das gelte insbesondere bei urheberrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen (BGH NJW 2016, 863, 866.) Auch bei Parkverstößen hat der BGH die Aufwendungen zur Ermittlung des Fahrzeughalters in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit der Kosten einer berechtigten außergerichtlichen Abmahnung lange Zeit als zur Vorbereitung der an den Zustandsstörer gerichteten Unterlassungsaufforderung erforderlich und nach § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB als ersatzfähig angesehen (BGH NJW 2012, 3781 f.). In seiner aktuellen Rechtsprechung sieht der BGH das jedoch anders. Es entspreche nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden. Es könne nicht angenommen werden, dass er ein Interesse daran habe, aus der Anonymität herauszutreten, um auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden (BGH NJW 2016, 863, 866). Anders könne der Fall lediglich liegen, wenn das unbefugt abgestellte Fahrzeug abgeschleppt werde (BGH NJW 2016, 863, 866).
Entspricht es also bei Parkverstößen nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden, darf der Geschäftsführer die damit verbundenen Kosten der Halterermittlung den Umständen nach auch nicht für erforderlich halten.
Zwischenergebnis: Ein Ersatzanspruch aus § 683 S. 1 i.V.m. §§ 677, 670 BGB wegen der Halterermittlungskosten ist danach also nicht gegeben. Ein solcher kann auch nicht aus § 823 II BGB angenommen werden. Zwar ist § 858 I BGB ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II BGB. Jedoch hat der BGH zutreffend festgestellt, dass es regelmäßig am Verschulden (d.h. an der wenigstens erforderlichen Fahrlässigkeit) fehlt. Der Halter habe es nicht zu vertreten, wenn der Fahrer das Kfz verbotswidrig abstelle (BGH NJW 2016, 863, 866).
Ist ein Anspruch wegen der Halterermittlungskosten nicht gegeben, stellt sich die Frage, ob das auch hinsichtlich der anwaltlichen Kosten für die Aufforderung zur Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung gilt. Aus dem Urteil BGH NJW 2016, 863 geht das nicht eindeutig hervor. Jedoch geht das LG Mainz mit Urteil v. 07.01.2020 (Az. 6 S 39/19) ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten in Bezug auf die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aus § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB gegeben ist.
Fazit: Auch nach der geänderten BGH-Rechtsprechung stellt das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem fremden Grundstück eine verbotene Eigenmacht i.S.v. § 858 I BGB jedenfalls dann dar, wenn sich das Parkverbot zumindest aus den Umständen ergibt. Auch besteht die Vermutung der Wiederholungsgefahr und der Besitzer hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Falschparker (Besitzstörer). Die vom Besitzer geltend gemachte Wiederholungsgefahr muss aber begründet sein, was nicht der Fall ist, wenn der Falschparker z.B. in einem anderen Ort wohnt und auch keine (sonstigen) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er die Besitzstörung wiederholt.
Zu der (in der Praxis allein relevanten) Frage nach der Kostenerstattung hat der BGH entschieden, dass die Kosten der Halterermittlung nicht erstattungsfähig sind, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Es entspreche nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen eines Halters, als Adressat einer Unterlassungsaufforderung ermittelt zu werden. Es könne nicht angenommen werden, dass er ein Interesse daran habe, aus der Anonymität herauszutreten, um auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Da die Prüfung, ob ein Unterlassungsanspruch besteht, aber nicht einfach gelagert ist, gehen die Gerichte nach wie vor davon aus, dass ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten in Bezug auf die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aus § 683 S. 1 BGB i.V.m. §§ 677, 670 BGB gegeben ist.
Rolf Schmidt (02.12.2020)
07.11.2020: Zur Strafbarkeit der Embryonenspende
BayObLG, Urt. v. 04.11.2020 – 206 StRR 1461/19
Mit Urteil v. 04.11.2020 (206 StRR 1461/19) hat der 6. Senat des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) entschieden, dass es dem Straftatbestand des § 1 I Nr. 2 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) unterfalle, wenn die zur künstlichen Befruchtung eingefrorenen Eizellen einer Frau aufgetaut werden, um damit die Schwangerschaft einer anderen Frau herbeizuführen, sofern sich die Zellen noch im sog. 2-PN-Stadium befinden. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Der verurteilte Arzt ist Mitglied eines Vereins, der durch beteiligte Ärzte es zeugungsunfähigen Frauen ermöglichte, imprägnierte kryokonservierte (d.h. in flüssigem Stickstoff bei -196 Grad Celsius tiefgefrorene) Eizellen zu erhalten, um auf diese Weise schwanger zu werden. Imprägniert ist eine Eizelle, bei der die Samenzelle zwar in das Plasma der Eizelle eingedrungen ist bzw. eingebracht wurde, aber noch keine Kernverschmelzung (Verschmelzung von Samen- und Eizellkern) stattgefunden hat. Die imprägnierten Eizellen stammten von Frauen, bei denen zuvor eine künstliche Befruchtung vorgenommen wurde. Dazu wurden der jeweiligen Frau Eizellen entnommen und mit dem Samen ihres Partners in vitro befruchtet und anschließend in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. Dieses Verfahren ist nicht von den Strafnormen des ESchG erfasst, mithin straflos und in der Reproduktionsmedizin weit verbreitet. Die Besonderheit dieses Verfahrens besteht aber darin, dass stets mehrere Eizellen entnommen und imprägniert werden, weil die Erfolgsquote nicht sehr hoch ist. Die überzähligen imprägnierten Eizellen werden sodann kryokonserviert, um im Fall eines Fehlschlags auf weitere zurückgreifen zu können. Im Falle einer Schwangerschaft werden diese imprägnierten kryokonservierten Eizellen (jedenfalls für die konkrete Schwangerschaft) nicht mehr benötigt, sodass das Paar gefragt wurde, ob sie sie anderen Paaren überlassen möchten. Das aber könnte dem Straftatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG unterfallen, worüber seit Jahren juristischer Streit herrscht. Das BayObLG hat der Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Berufungsurteil (teilweise) stattgegeben und die Sache zurückverwiesen.
II. Biologische/medizinische Grundlagen
Ungewollte Kinderlosigkeit kann – beim Mann und bei der Frau – verschiedene (biologische) Ursachen haben. Im Zentrum steht die Infertilität, also die Unfähigkeit, Nachkommen zu zeugen, bzw. die Fähigkeit, nur noch sporadisch durch Spontankonzeption schwanger zu werden. Um sich gleichwohl den Kinderwunsch zu erfüllen, entscheiden sich viele betroffene Paare zur künstlichen Befruchtung, d.h. zur assistierten Reproduktion. Gemäß der Definition der „Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen der assistierten Reproduktion“ der Bundesärztekammer v. 06.10.2017 wird als assistierte Reproduktion „die ärztliche Hilfe zur Erfüllung des Kinderwunsches durch medizinische Behandlungen und Methoden bezeichnet, die die Handhabung menschlicher Keimzellen (Ei- und Samenzellen) oder Embryonen zum Zwecke der Herbeiführung einer Schwangerschaft umfassen“ (Punkt 1.4, erster Spiegelstrich der Richtlinie). Im Mittelpunkt steht die „In-vitro-Fertilisation“ IVF (in vitro = lat.: „im Glas“). In-vitro-Fertilisation bedeutet also eine im Glas (d.h. Reagenzglas) vorgenommene Imprägnation der Eizelle, daher auch als „extrakorporale Imprägnation“ bezeichnet. Dazu werden der Frau unmittelbar vor dem (künstlich erzeugten) Eisprung Oozyten (Eizellen) aus den Ovarien (Eierstöcken) entnommen (Follikelpunktion). Jede entnommene Eizelle wird in ein Kulturgefäß überführt und dort mit den (aufbereiteten) Spermien zusammengeführt. Das erfolgt durch schlichte Vermischung. Sollte ein eigenständiges Eindringen einer Samenzelle in die Eizelle nicht möglich oder erschwert sein, wird „nachgeholfen“ mittels intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI), d.h. durch Injektion einer Samenzelle in das Plasma einer Eizelle. Das Eindringen einer Samenzelle in das Zellplasma einer Eizelle nennt man Imprägnation. Danach werden die imprägnierten Eizellen in einen Brutschrank gegeben, um die Befruchtung herbeizuführen bzw. abzuschließen. Die Befruchtungsphasen sind zeitlich, nach Fortschritt der Zellteilungen, gestaffelt:
1. Tag nach der Imprägnation: Vorkernstadium (Pronucleus- bzw. PN-Stadium)
2. Tag nach der Imprägnation: Zwei- bis Vierzellstadium
3. Tag nach der Imprägnation: Achtzellstadium
4. Tag nach der Imprägnation: Beerenstadium (Morulastadium)
5. Tag nach der Imprägnation: Blastozystenstadium
Aus der Strafnorm des § 1 I Nr. 3 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) folgt, dass durch die IVF bzw. ICSI maximal 3 Embryonen extrakorporal erzeugt und übertragen werden dürfen. Üblicherweise werden daher 3 Embryonen erzeugt und in das PN-Stadium gebracht. Sodann werden maximal zwei Zellen des PN-Stadiums separiert und kryokonserviert, um – im Fall eines Fehlschlags – auf diese zurückgreifen zu können.
Lediglich die Eizelle(n), die auf die Frau übertragen werden soll(en), verbleibt bzw. verbleiben im Brutkasten zwecks Fortsetzung des Inkubationsprozesses. Nach Erreichen des Achtzellstadiums wird/werden sie dann mittels weichen Kunststoffkatheters in den Uterus (die Gebärmutter) der Frau übertragen (Embryonentransfer), damit sie sich dort einnistet bzw. einnisten (Nidation). Insoweit ist das Verfahren auch rechtlich einwandfrei.
Wenn aber die Implantation erfolgreich war und die Frau schwanger geworden ist oder sich der Kinderwunsch erübrigt hat, stellt sich die Frage nach dem Schicksal der überzähligen, kryokonservierten Eizelle(n). Es erscheint naheliegend, sie anderen Paaren zu überlassen. Ob das zulässig ist, ist zweifelhaft in Anbetracht der Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG, wonach sich strafbar macht, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Es kommt maßgeblich darauf an, ob zum Zeitpunkt der Kryokonservierung bereits eine Befruchtung stattgefunden hat. Nur, wenn das angenommen werden kann, ist § 1 I Nr. 2 ESchG nicht einschlägig. Da das ESchG den Begriff der Befruchtung jedoch nicht definiert, bedarf dieser einer Herleitung:
Befruchtet ist eine Eizelle jedenfalls mit der Kernverschmelzung (Konjugation), womit auch ein Embryo entstanden ist (siehe § 8 I Halbs. 1 ESchG). Die Konjugation wiederum ist gegeben, wenn sich Zellkern der Samenzelle und Zellkern der Eizelle vereinen. Das ist spätestens 24 Stunden nach der Imprägnation der Fall, also in der Phase 1 (im Pronucleus- bzw. PN-Stadium). Wie bereits erläutert, ist eine Eizelle imprägniert, wenn die Samenzelle zwar in das Plasma der Eizelle eingedrungen ist bzw. eingebracht wurde, aber noch keine Kernverschmelzung stattgefunden hat. Wird also eine lediglich imprägnierte Eizelle in die Gebärmutter einer anderen Frau implantiert, ist dieses Verfahren straflos, wenn man eine lediglich imprägnierte Eizelle noch nicht als befruchtete Eizelle ansieht. Eine Straflosigkeit besteht auch dann, wenn man eine imprägnierte Eizelle kryokonserviert und dabei nicht von einer Befruchtung ausgeht. Die entscheidenden Fragen lauten also: Handelt es sich bei einer imprägnierten Eizelle bereits um eine befruchtete Eizelle oder muss dazu eine Konjugation erforderlich sein? Und handelt es sich bei der kryokonservierten Eizelle bereits um eine befruchtete Eizelle?
III. Rechtliche Ausgangslage (Mutterschaft/Embryonentransfer)
Das BGB knüpft bei der Mutterschaft an die Geburt an. So ist nach § 1591 BGB Mutter eines Kindes die Frau, die es geboren hat. Eine so definierte Mutterschaft kann auf verschiedene (legale und illegale) Weisen entstehen (Übersicht nach R. Schmidt, FamR, 10. Aufl. 2018, Rn. 462m):
Vorliegend von keiner Relevanz ist der Fall, dass der Wunschmutter Eizellen zwecks In-vitro-Fertilisation bzw. intracytoplasmatischer Spermieninjektion entnommen werden, sich dann aber herausstellt, dass eine Einpflanzung einer imprägnierten bzw. befruchteten Eizelle in den Körper der Wunschmutter (medizinisch oder faktisch) unmöglich ist. Wird in diesem Fall ein Embryo in eine andere Frau übertragen, liegt kein Fall des § 1 II ESchG vor, da es allein schon an der zeitlichen Koinzidenz (vgl. § 1 II a.E. ESchG: „...ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt“) fehlt. Gleiches gilt hinsichtlich der in § 1 I Nr. 6 ESchG beschriebenen Handlung, wenn die zeitliche Koinzidenz fehlt. Rechtspolitisch lässt sich die Straflosigkeit dieser Verfahren damit begründen, dass der Embryo anderenfalls verworfen werden müsste und dass die Ratio des ESchG, Vermeidung einer gespaltenen Mutterschaft, in diesen Fällen nicht greift (vgl. dazu Taupitz/Hermes, NJW 2015, 1802, 1803; Taupitz, NJW 2019, 337).
Jedoch ist unklar, ob ein Fall des § 1 I Nr. 2 ESchG auch dann vorliegt, wenn die in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzte Eizelle von einer anderen Frau stammt. Das ist vorstellbar in dem Fall, in dem diese andere Frau und ihr Partner, von dem die Samenzelle stammt, die imprägnierte Eizelle nicht mehr benötigen, etwa, weil die Schwangerschaft bereits (durch eine IVF bzw. ICSI) eingetreten ist oder der Kinderwunsch sich erledigt hat. Wird die dann freigegebene imprägnierte Eizelle in eine andere Frau implantiert, könnte der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt sein. Ob das der Fall ist, hängt davon ab, ob eine Befruchtung bereits mit der Imprägnation vorliegt (dann kein Fall des § 1 I Nr. 2 ESchG) oder erst mit der Kernverschmelzung/Konjugation (dann Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG).
IV. Prüfung des Falls/Entscheidung des BayObLG
Der im Sachverhalt genannte Arzt könnte sich durch die Implantation einer aufgetauten imprägnierten bzw. befruchteten Eizelle in die Gebärmutter einer Frau, von der die Eizelle nicht stammt, nach § 1 I Nr. 2 ESchG strafbar gemacht haben. Nach dieser Norm macht sich strafbar, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Entscheidend ist also, in welchem Stadium des Befruchtungsprozesses die „Befruchtung“ i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG anzunehmen ist. Teilweise wird auf den Zeitpunkt der Imprägnation abgestellt. Andere erachten den Zeitpunkt der Konjugation für maßgeblich. Das BayObLG hat entschieden, dass die Befruchtung einer Eizelle nicht schon durch das Einbringen der Samenzelle in die Eizelle geschehe (was also die Imprägnation als Akt der Befruchtung ausschließt), sondern sich über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden bis zur Entstehung eines Embryos (womit das Gericht wohl die Konjugation meint) vollziehe. Danach ist die Befruchtung also erst mit der Konjugation abgeschlossen. Schließt man sich dem an, kann man also lediglich von einem „Befruchtungsprozess“ sprechen, nicht aber von einer „fertigen Befruchtung“, solange die Konjugation noch nicht stattgefunden hat. Das wiederum führt zur Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG: Werden zwecks assistierter Reproduktion Eizellen der Wunschmutter entnommen, mit Samenzellen des Partners/Samenspenders imprägniert und sodann kryokonserviert, um sie später aufzutauen und der Wunschmutter zu implantieren, liegt darin noch keine Befruchtung, wenn man bei der Frage nach der Befruchtung auf das Stadium der Konjugation abstellt. Dann aber ist der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt, wenn eine imprägnierte Eizelle aufgetaut wird, diese dann das Stadium der Konjugation erreicht und sodann einer anderen Frau implantiert wird. Diese Lesart vertritt das BayObLG: Da die Befruchtung erst ihren Abschluss finde, wenn die Eizelle wieder aufgetaut werde, geschehe dann das Auftauen nicht mehr mit dem Ziel, eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, sondern werde vorgenommen, um die Eizelle einer anderen Frau einzupflanzen. Damit sei der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt.
Stellungnahme: Nach dem soeben Aufgezeigten ist es also entscheidend, ob man die Imprägnation oder die Konjugation als Befruchtung ansieht. Rechtlich vertretbar ist beides, zumal das ESchG dies nicht annähernd beschreibt. Zieht man aber die Ratio der Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG heran, wonach man in erster Linie einer gespaltenen Mutterschaft (Auseinanderfallen von genetischer und gebärender Mutterschaft) begegnen wollte, weil dies als „Kindeswohlgefährdung“ angesehen wurde (siehe BT-Drs. 11/5460, S. 8), erscheint die Lesart des BayObLG auf den ersten Blick überzeugend. Jedoch bei einer gespaltenen Mutterschaft (zwingend) eine Kindeswohlgefährdung anzunehmen, ist zum einen nicht dargelegt und entspricht zum anderen auch nicht modernen Familienstrukturen. Zudem erscheint es nicht nachvollziehbar, warum es einerseits strafbar ist, wenn imprägnierte Eizellen eingefroren, später aufgetaut und einer anderen Frau eingesetzt werden, wohingegen es straflos ist, wenn die eingefrorenen Eizellen bereits konjugiert waren. Ähnlich argumentierte auch der angeklagte Arzt gegenüber der LTO: „Das versteht kein Mensch. Wenn man nun einen Tag später einfriert, ist es legal“ (https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bayoblg-206strr1461-19-netzwerk-embryonenspende-eizellspende-freispruch-revision-stattgegeben).
Insofern wäre eine teleologische Reduktion des § 1 I Nr. 2 ESchG angebracht gewesen und es hätte sich die gegenteilige Handhabung der mittlerweile 30 Jahre alten Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG angeboten: Wenn das Kryokonservieren eines bereits weiterentwickelten werdenden Menschen straflos ist, kann es nicht strafbar sein, wenn der werdende Mensch in einem früheren Stadium seiner Entwicklung kryokonserviert (und später einer anderen Frau eingesetzt) wird.
Ergebnis: Entgegen der Entscheidung des BayObLG ist der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG nicht erfüllt. Richtigerweise ist eine Eizelle bereits mit der Imprägnation und nicht erst mit der Konjugation „befruchtet“ i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG. Die vom BayObLG vorgenommene Auslegung des Begriffs der „Befruchtung“ war weder rechtspolitisch noch kriminologisch geboten. Auch aus teleologischer Sicht gibt es keinen überzeugenden Grund, die „Befruchtung“ mit dem Stadium der Konjugation zu definieren. Die Entscheidung des BayObLG war damit also jedenfalls nicht zwingend. Ob das BVerfG eine Grundrechtsverletzung (Art. 12 I GG; Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG) auf Seiten des verurteilten Arztes zu prüfen haben wird, bleibt (vorerst) abzuwarten.
BayObLG, Urt. v. 04.11.2020 – 206 StRR 1461/19
Mit Urteil v. 04.11.2020 (206 StRR 1461/19) hat der 6. Senat des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) entschieden, dass es dem Straftatbestand des § 1 I Nr. 2 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) unterfalle, wenn die zur künstlichen Befruchtung eingefrorenen Eizellen einer Frau aufgetaut werden, um damit die Schwangerschaft einer anderen Frau herbeizuführen, sofern sich die Zellen noch im sog. 2-PN-Stadium befinden. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Der verurteilte Arzt ist Mitglied eines Vereins, der durch beteiligte Ärzte es zeugungsunfähigen Frauen ermöglichte, imprägnierte kryokonservierte (d.h. in flüssigem Stickstoff bei -196 Grad Celsius tiefgefrorene) Eizellen zu erhalten, um auf diese Weise schwanger zu werden. Imprägniert ist eine Eizelle, bei der die Samenzelle zwar in das Plasma der Eizelle eingedrungen ist bzw. eingebracht wurde, aber noch keine Kernverschmelzung (Verschmelzung von Samen- und Eizellkern) stattgefunden hat. Die imprägnierten Eizellen stammten von Frauen, bei denen zuvor eine künstliche Befruchtung vorgenommen wurde. Dazu wurden der jeweiligen Frau Eizellen entnommen und mit dem Samen ihres Partners in vitro befruchtet und anschließend in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. Dieses Verfahren ist nicht von den Strafnormen des ESchG erfasst, mithin straflos und in der Reproduktionsmedizin weit verbreitet. Die Besonderheit dieses Verfahrens besteht aber darin, dass stets mehrere Eizellen entnommen und imprägniert werden, weil die Erfolgsquote nicht sehr hoch ist. Die überzähligen imprägnierten Eizellen werden sodann kryokonserviert, um im Fall eines Fehlschlags auf weitere zurückgreifen zu können. Im Falle einer Schwangerschaft werden diese imprägnierten kryokonservierten Eizellen (jedenfalls für die konkrete Schwangerschaft) nicht mehr benötigt, sodass das Paar gefragt wurde, ob sie sie anderen Paaren überlassen möchten. Das aber könnte dem Straftatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG unterfallen, worüber seit Jahren juristischer Streit herrscht. Das BayObLG hat der Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Berufungsurteil (teilweise) stattgegeben und die Sache zurückverwiesen.
II. Biologische/medizinische Grundlagen
Ungewollte Kinderlosigkeit kann – beim Mann und bei der Frau – verschiedene (biologische) Ursachen haben. Im Zentrum steht die Infertilität, also die Unfähigkeit, Nachkommen zu zeugen, bzw. die Fähigkeit, nur noch sporadisch durch Spontankonzeption schwanger zu werden. Um sich gleichwohl den Kinderwunsch zu erfüllen, entscheiden sich viele betroffene Paare zur künstlichen Befruchtung, d.h. zur assistierten Reproduktion. Gemäß der Definition der „Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen der assistierten Reproduktion“ der Bundesärztekammer v. 06.10.2017 wird als assistierte Reproduktion „die ärztliche Hilfe zur Erfüllung des Kinderwunsches durch medizinische Behandlungen und Methoden bezeichnet, die die Handhabung menschlicher Keimzellen (Ei- und Samenzellen) oder Embryonen zum Zwecke der Herbeiführung einer Schwangerschaft umfassen“ (Punkt 1.4, erster Spiegelstrich der Richtlinie). Im Mittelpunkt steht die „In-vitro-Fertilisation“ IVF (in vitro = lat.: „im Glas“). In-vitro-Fertilisation bedeutet also eine im Glas (d.h. Reagenzglas) vorgenommene Imprägnation der Eizelle, daher auch als „extrakorporale Imprägnation“ bezeichnet. Dazu werden der Frau unmittelbar vor dem (künstlich erzeugten) Eisprung Oozyten (Eizellen) aus den Ovarien (Eierstöcken) entnommen (Follikelpunktion). Jede entnommene Eizelle wird in ein Kulturgefäß überführt und dort mit den (aufbereiteten) Spermien zusammengeführt. Das erfolgt durch schlichte Vermischung. Sollte ein eigenständiges Eindringen einer Samenzelle in die Eizelle nicht möglich oder erschwert sein, wird „nachgeholfen“ mittels intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI), d.h. durch Injektion einer Samenzelle in das Plasma einer Eizelle. Das Eindringen einer Samenzelle in das Zellplasma einer Eizelle nennt man Imprägnation. Danach werden die imprägnierten Eizellen in einen Brutschrank gegeben, um die Befruchtung herbeizuführen bzw. abzuschließen. Die Befruchtungsphasen sind zeitlich, nach Fortschritt der Zellteilungen, gestaffelt:
1. Tag nach der Imprägnation: Vorkernstadium (Pronucleus- bzw. PN-Stadium)
2. Tag nach der Imprägnation: Zwei- bis Vierzellstadium
3. Tag nach der Imprägnation: Achtzellstadium
4. Tag nach der Imprägnation: Beerenstadium (Morulastadium)
5. Tag nach der Imprägnation: Blastozystenstadium
Aus der Strafnorm des § 1 I Nr. 3 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) folgt, dass durch die IVF bzw. ICSI maximal 3 Embryonen extrakorporal erzeugt und übertragen werden dürfen. Üblicherweise werden daher 3 Embryonen erzeugt und in das PN-Stadium gebracht. Sodann werden maximal zwei Zellen des PN-Stadiums separiert und kryokonserviert, um – im Fall eines Fehlschlags – auf diese zurückgreifen zu können.
Lediglich die Eizelle(n), die auf die Frau übertragen werden soll(en), verbleibt bzw. verbleiben im Brutkasten zwecks Fortsetzung des Inkubationsprozesses. Nach Erreichen des Achtzellstadiums wird/werden sie dann mittels weichen Kunststoffkatheters in den Uterus (die Gebärmutter) der Frau übertragen (Embryonentransfer), damit sie sich dort einnistet bzw. einnisten (Nidation). Insoweit ist das Verfahren auch rechtlich einwandfrei.
Wenn aber die Implantation erfolgreich war und die Frau schwanger geworden ist oder sich der Kinderwunsch erübrigt hat, stellt sich die Frage nach dem Schicksal der überzähligen, kryokonservierten Eizelle(n). Es erscheint naheliegend, sie anderen Paaren zu überlassen. Ob das zulässig ist, ist zweifelhaft in Anbetracht der Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG, wonach sich strafbar macht, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Es kommt maßgeblich darauf an, ob zum Zeitpunkt der Kryokonservierung bereits eine Befruchtung stattgefunden hat. Nur, wenn das angenommen werden kann, ist § 1 I Nr. 2 ESchG nicht einschlägig. Da das ESchG den Begriff der Befruchtung jedoch nicht definiert, bedarf dieser einer Herleitung:
Befruchtet ist eine Eizelle jedenfalls mit der Kernverschmelzung (Konjugation), womit auch ein Embryo entstanden ist (siehe § 8 I Halbs. 1 ESchG). Die Konjugation wiederum ist gegeben, wenn sich Zellkern der Samenzelle und Zellkern der Eizelle vereinen. Das ist spätestens 24 Stunden nach der Imprägnation der Fall, also in der Phase 1 (im Pronucleus- bzw. PN-Stadium). Wie bereits erläutert, ist eine Eizelle imprägniert, wenn die Samenzelle zwar in das Plasma der Eizelle eingedrungen ist bzw. eingebracht wurde, aber noch keine Kernverschmelzung stattgefunden hat. Wird also eine lediglich imprägnierte Eizelle in die Gebärmutter einer anderen Frau implantiert, ist dieses Verfahren straflos, wenn man eine lediglich imprägnierte Eizelle noch nicht als befruchtete Eizelle ansieht. Eine Straflosigkeit besteht auch dann, wenn man eine imprägnierte Eizelle kryokonserviert und dabei nicht von einer Befruchtung ausgeht. Die entscheidenden Fragen lauten also: Handelt es sich bei einer imprägnierten Eizelle bereits um eine befruchtete Eizelle oder muss dazu eine Konjugation erforderlich sein? Und handelt es sich bei der kryokonservierten Eizelle bereits um eine befruchtete Eizelle?
III. Rechtliche Ausgangslage (Mutterschaft/Embryonentransfer)
Das BGB knüpft bei der Mutterschaft an die Geburt an. So ist nach § 1591 BGB Mutter eines Kindes die Frau, die es geboren hat. Eine so definierte Mutterschaft kann auf verschiedene (legale und illegale) Weisen entstehen (Übersicht nach R. Schmidt, FamR, 10. Aufl. 2018, Rn. 462m):
- „Normale“ Mutterschaft, bei der die gebärende Mutter auch die genetische Mutter ist:
- Intrakorporale Befruchtung der Eizelle (In-vivo-Fertilisation; in vivo = lat.: „im Lebendigen“. In-vivo-Fertilisation bedeutet also eine im lebenden Körper einer Frau vorgenommene Befruchtung der Eizelle)
auf natürliche Weise (d.h. durch Geschlechtsverkehr)
mit dem Samen des Ehemanns
mit dem Samen eines anderen Mannes („Fremdinsemination“)
durch künstliche Befruchtung
mit dem Samen des Ehemanns (homologe intrakorporale Insemination)
mit dem Samen eines anderen Mannes (heterologe intrakorporale Insemination)
- Extrakorporale Befruchtung der Eizelle (IVF oder ICSI)
- durch Entnahme einer Eizelle und Befruchtung außerhalb des Mutterleibs
mit dem Samen des Ehemanns (homologe extrakorporale Insemination)
mit dem Samen eines anderen Mannes (heterologe extrakorporale Insemination
und anschließende Einsetzung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter der Frau, von der die Eizelle stammt
- Genetische Mutter und gebärende Mutter sind nicht identisch:
- Eizellspende: Eine unbefruchtete fremde Eizelle wird in den Körper der Wunschmutter eingepflanzt und anschließend dort mit dem Samen ihres (oder eines anderen) Mannes befruchtet. Dieses Verfahren ist gem. § 1 I Nr. 1 ESchG für den Übertragenden strafbar. Darüber herrscht – soweit ersichtlich – juristisch kein Streit.
- Embryonenspende:
Unter diesen Begriff fallen verschiedene, zulässige wie unzulässige Konstellationen.
Zunächst ist es möglich, dass die Eizelle einer anderen Frau mit dem Samen des Ehemanns oder eines anderen Mannes in vitro bzw. durch intracytoplasmatischer Spermieninjektion befruchtet und anschließend in die Gebärmutter der (Ehe-)Frau eingesetzt wird. Dieses Verfahren ist nicht von den Strafnormen des ESchG erfasst, mithin straflos und in der Fortpflanzungsmedizin üblich (s.o.).
Jedoch macht sich gem. § 1 I Nr. 2 ESchG strafbar, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Hier stellt sich also die vorliegende Problematik nach dem Zeitpunkt, in dem von einer Befruchtung auszugehen ist.
Strafbar gem. § 1 I Nr. 6 ESchG ist auch die Entnahme einer bereits befruchteten Eizelle, d.h. eines Embryos (§ 8 I ESchG), aus dem Körper einer Frau, um diesen auf eine andere Frau zu übertragen oder ihn für einen nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu verwenden.
Gemäß § 1 I Nr. 7 ESchG macht sich auch strafbar, wer es unternimmt, bei einer Ersatzmutter (dazu R. Schmidt, FamR, 10. Aufl. 2018, Rn. 462a) eine künstliche Befruchtung durchzuführen oder auf sie einen menschlichen Embryo zu übertragen.
Vorliegend von keiner Relevanz ist der Fall, dass der Wunschmutter Eizellen zwecks In-vitro-Fertilisation bzw. intracytoplasmatischer Spermieninjektion entnommen werden, sich dann aber herausstellt, dass eine Einpflanzung einer imprägnierten bzw. befruchteten Eizelle in den Körper der Wunschmutter (medizinisch oder faktisch) unmöglich ist. Wird in diesem Fall ein Embryo in eine andere Frau übertragen, liegt kein Fall des § 1 II ESchG vor, da es allein schon an der zeitlichen Koinzidenz (vgl. § 1 II a.E. ESchG: „...ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt“) fehlt. Gleiches gilt hinsichtlich der in § 1 I Nr. 6 ESchG beschriebenen Handlung, wenn die zeitliche Koinzidenz fehlt. Rechtspolitisch lässt sich die Straflosigkeit dieser Verfahren damit begründen, dass der Embryo anderenfalls verworfen werden müsste und dass die Ratio des ESchG, Vermeidung einer gespaltenen Mutterschaft, in diesen Fällen nicht greift (vgl. dazu Taupitz/Hermes, NJW 2015, 1802, 1803; Taupitz, NJW 2019, 337).
Jedoch ist unklar, ob ein Fall des § 1 I Nr. 2 ESchG auch dann vorliegt, wenn die in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzte Eizelle von einer anderen Frau stammt. Das ist vorstellbar in dem Fall, in dem diese andere Frau und ihr Partner, von dem die Samenzelle stammt, die imprägnierte Eizelle nicht mehr benötigen, etwa, weil die Schwangerschaft bereits (durch eine IVF bzw. ICSI) eingetreten ist oder der Kinderwunsch sich erledigt hat. Wird die dann freigegebene imprägnierte Eizelle in eine andere Frau implantiert, könnte der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt sein. Ob das der Fall ist, hängt davon ab, ob eine Befruchtung bereits mit der Imprägnation vorliegt (dann kein Fall des § 1 I Nr. 2 ESchG) oder erst mit der Kernverschmelzung/Konjugation (dann Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG).
IV. Prüfung des Falls/Entscheidung des BayObLG
Der im Sachverhalt genannte Arzt könnte sich durch die Implantation einer aufgetauten imprägnierten bzw. befruchteten Eizelle in die Gebärmutter einer Frau, von der die Eizelle nicht stammt, nach § 1 I Nr. 2 ESchG strafbar gemacht haben. Nach dieser Norm macht sich strafbar, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Entscheidend ist also, in welchem Stadium des Befruchtungsprozesses die „Befruchtung“ i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG anzunehmen ist. Teilweise wird auf den Zeitpunkt der Imprägnation abgestellt. Andere erachten den Zeitpunkt der Konjugation für maßgeblich. Das BayObLG hat entschieden, dass die Befruchtung einer Eizelle nicht schon durch das Einbringen der Samenzelle in die Eizelle geschehe (was also die Imprägnation als Akt der Befruchtung ausschließt), sondern sich über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden bis zur Entstehung eines Embryos (womit das Gericht wohl die Konjugation meint) vollziehe. Danach ist die Befruchtung also erst mit der Konjugation abgeschlossen. Schließt man sich dem an, kann man also lediglich von einem „Befruchtungsprozess“ sprechen, nicht aber von einer „fertigen Befruchtung“, solange die Konjugation noch nicht stattgefunden hat. Das wiederum führt zur Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG: Werden zwecks assistierter Reproduktion Eizellen der Wunschmutter entnommen, mit Samenzellen des Partners/Samenspenders imprägniert und sodann kryokonserviert, um sie später aufzutauen und der Wunschmutter zu implantieren, liegt darin noch keine Befruchtung, wenn man bei der Frage nach der Befruchtung auf das Stadium der Konjugation abstellt. Dann aber ist der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt, wenn eine imprägnierte Eizelle aufgetaut wird, diese dann das Stadium der Konjugation erreicht und sodann einer anderen Frau implantiert wird. Diese Lesart vertritt das BayObLG: Da die Befruchtung erst ihren Abschluss finde, wenn die Eizelle wieder aufgetaut werde, geschehe dann das Auftauen nicht mehr mit dem Ziel, eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, sondern werde vorgenommen, um die Eizelle einer anderen Frau einzupflanzen. Damit sei der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG erfüllt.
Stellungnahme: Nach dem soeben Aufgezeigten ist es also entscheidend, ob man die Imprägnation oder die Konjugation als Befruchtung ansieht. Rechtlich vertretbar ist beides, zumal das ESchG dies nicht annähernd beschreibt. Zieht man aber die Ratio der Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG heran, wonach man in erster Linie einer gespaltenen Mutterschaft (Auseinanderfallen von genetischer und gebärender Mutterschaft) begegnen wollte, weil dies als „Kindeswohlgefährdung“ angesehen wurde (siehe BT-Drs. 11/5460, S. 8), erscheint die Lesart des BayObLG auf den ersten Blick überzeugend. Jedoch bei einer gespaltenen Mutterschaft (zwingend) eine Kindeswohlgefährdung anzunehmen, ist zum einen nicht dargelegt und entspricht zum anderen auch nicht modernen Familienstrukturen. Zudem erscheint es nicht nachvollziehbar, warum es einerseits strafbar ist, wenn imprägnierte Eizellen eingefroren, später aufgetaut und einer anderen Frau eingesetzt werden, wohingegen es straflos ist, wenn die eingefrorenen Eizellen bereits konjugiert waren. Ähnlich argumentierte auch der angeklagte Arzt gegenüber der LTO: „Das versteht kein Mensch. Wenn man nun einen Tag später einfriert, ist es legal“ (https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bayoblg-206strr1461-19-netzwerk-embryonenspende-eizellspende-freispruch-revision-stattgegeben).
Insofern wäre eine teleologische Reduktion des § 1 I Nr. 2 ESchG angebracht gewesen und es hätte sich die gegenteilige Handhabung der mittlerweile 30 Jahre alten Strafnorm des § 1 I Nr. 2 ESchG angeboten: Wenn das Kryokonservieren eines bereits weiterentwickelten werdenden Menschen straflos ist, kann es nicht strafbar sein, wenn der werdende Mensch in einem früheren Stadium seiner Entwicklung kryokonserviert (und später einer anderen Frau eingesetzt) wird.
Ergebnis: Entgegen der Entscheidung des BayObLG ist der Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG nicht erfüllt. Richtigerweise ist eine Eizelle bereits mit der Imprägnation und nicht erst mit der Konjugation „befruchtet“ i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG. Die vom BayObLG vorgenommene Auslegung des Begriffs der „Befruchtung“ war weder rechtspolitisch noch kriminologisch geboten. Auch aus teleologischer Sicht gibt es keinen überzeugenden Grund, die „Befruchtung“ mit dem Stadium der Konjugation zu definieren. Die Entscheidung des BayObLG war damit also jedenfalls nicht zwingend. Ob das BVerfG eine Grundrechtsverletzung (Art. 12 I GG; Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG) auf Seiten des verurteilten Arztes zu prüfen haben wird, bleibt (vorerst) abzuwarten.
Weiterführender Hinweis:
Das BayObLG hat auf die Möglichkeit eines Verbotsirrtums hingewiesen, d.h. dem Berufungsgericht aufgetragen, die Voraussetzungen des § 17 StGB zu prüfen. Diese Vorschrift regelt zunächst den Fall, dass der Täter glaubt, es gebe gar keine Verbotsnorm, die sein Verhalten erfasst, oder das von ihm gewählte rechtliche Konstrukt sei zulässig (siehe die Fälle BGH NJW 2017, 1487 – Parkkralle; LG Passau 13.1.2016 – 1 Ns 35 Js 4140/13; AG Erfurt 28.4.2016 – 880 Js 10703/13 Ds mit Bespr. v. Putzke, ZJS 2016, 787 – dazu R. Schmidt, Strafrecht BT II, 21. Aufl. 2019, Rn. 546) und er habe sich daher nicht strafbar gemacht. Mithin geht es um die Konstellation, in der der Täter glaubt, er begehe kein Unrecht bzw. sein Handeln sei nicht verboten und daher nicht strafbar. Die rechtliche Behandlung erfolgt nach § 17 StGB. Jedoch handelt der Täter nach § 17 S. 1 StGB nur dann ohne Schuld, wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte; anderenfalls (bei Vermeidbarkeit des Irrtums) kann die Strafe lediglich gemildert werden (§ 17 S. 2 StGB i.V.m. § 49 I StGB).
Hier ist übrigens die (aus dem römischen Recht stammende) Volksweisheit „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“ (Ignorantia legis non excusat) anzusiedeln. Insbesondere betrifft dieser Rechtsirrtum nicht die Frage nach den Fehlerfolgen infolge Unkenntnis von Tatsachen, die dem gesetzlichen Tatbestand unterfallen (Ignorantia facti). Letzteres ist von § 16 StGB erfasst und führt zum Ausschluss des Vorsatzes.
An die Unvermeidbarkeit des Irrtums stellt der BGH durchweg hohe Anforderungen, da er dem Täter die Pflicht auferlegt, sich in zumutbarer Weise zu erkundigen (etwa durch Gesetzeslektüre bzw. Einholung von qualifiziertem Rechtsrat), damit dieser auf diesem Wege zur richtigen Einschätzung der Rechtslage gekommen wäre (Fischer, § 17 Rn. 7; SK-Rudolphi, § 17 Rn. 44; BGH NStZ 2013, 461 f.; NJW 2006, 522, 523; NStZ 2000, 307, 309; BayObLG wistra 2000, 117; OLG Karlsruhe NJW 2003, 1061, 1062; vgl. auch BGH NJW 2004, 2459, 2460). In ständiger Rechtsprechung führt der BGH aus, dass ein Verbotsirrtum i.S.v. § 17 S. 1 StGB (nur dann) unvermeidbar ist, „wenn der Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falls, seiner Persönlichkeit sowie seines Lebens- und Berufskreises zuzumutenden Anspannung des Gewissens die Einsicht in das Unrechtmäßige nicht zu gewinnen vermochte“. Im Zweifel treffe ihn eine Erkundigungspflicht (BGH NJW 2017, 2463, 2464 m.w.N.). Etwa aufkommende Zweifel seien erforderlichenfalls durch verlässliche und sachkundige Auskunft auszuräumen (BGH NJW 2017, 2463, 2464).
Der verurteilte Arzt hat sein Verhalten auf ein Gutachten einer Rechtsprofessorin gestützt, die das beschriebene Verfahren als straflos erachtet. Jedoch führt das nach der hier vertretenen Auffassung nicht dazu, dass sich der Arzt in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befand, da die Frage, ob eine Befruchtung i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG bereits mit der Imprägnation oder erst mit der Konjugation vorliegt, umstritten ist und v.a. einige Instanzgerichte das bislang anders sahen. Bei einer unsicheren Rechtslage kann man sich nicht nur auf ein Rechtsgutachten stützen und kann demnach nicht allein deshalb von einem unvermeidbaren Verbotsirrtum ausgehen. Mithin befand sich der Arzt nicht in einem schuldausschließenden unvermeidbaren Verbotsirrtum. Es greift dann § 17 S. 2 StGB, der gem. § 49 I StGB zur Strafmilderung führt. All das setzt jedoch voraus, dass man (mit dem BayObLG) den Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG als erfüllt ansieht, was nach der hier vertretenen Auffassung aber nicht der Fall ist. Insofern stellt sich von dem hier vertretenen Standpunkt aus schon gar nicht die Problematik des Verbotsirrtums.
An die Unvermeidbarkeit des Irrtums stellt der BGH durchweg hohe Anforderungen, da er dem Täter die Pflicht auferlegt, sich in zumutbarer Weise zu erkundigen (etwa durch Gesetzeslektüre bzw. Einholung von qualifiziertem Rechtsrat), damit dieser auf diesem Wege zur richtigen Einschätzung der Rechtslage gekommen wäre (Fischer, § 17 Rn. 7; SK-Rudolphi, § 17 Rn. 44; BGH NStZ 2013, 461 f.; NJW 2006, 522, 523; NStZ 2000, 307, 309; BayObLG wistra 2000, 117; OLG Karlsruhe NJW 2003, 1061, 1062; vgl. auch BGH NJW 2004, 2459, 2460). In ständiger Rechtsprechung führt der BGH aus, dass ein Verbotsirrtum i.S.v. § 17 S. 1 StGB (nur dann) unvermeidbar ist, „wenn der Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falls, seiner Persönlichkeit sowie seines Lebens- und Berufskreises zuzumutenden Anspannung des Gewissens die Einsicht in das Unrechtmäßige nicht zu gewinnen vermochte“. Im Zweifel treffe ihn eine Erkundigungspflicht (BGH NJW 2017, 2463, 2464 m.w.N.). Etwa aufkommende Zweifel seien erforderlichenfalls durch verlässliche und sachkundige Auskunft auszuräumen (BGH NJW 2017, 2463, 2464).
Der verurteilte Arzt hat sein Verhalten auf ein Gutachten einer Rechtsprofessorin gestützt, die das beschriebene Verfahren als straflos erachtet. Jedoch führt das nach der hier vertretenen Auffassung nicht dazu, dass sich der Arzt in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befand, da die Frage, ob eine Befruchtung i.S.d. § 1 I Nr. 2 ESchG bereits mit der Imprägnation oder erst mit der Konjugation vorliegt, umstritten ist und v.a. einige Instanzgerichte das bislang anders sahen. Bei einer unsicheren Rechtslage kann man sich nicht nur auf ein Rechtsgutachten stützen und kann demnach nicht allein deshalb von einem unvermeidbaren Verbotsirrtum ausgehen. Mithin befand sich der Arzt nicht in einem schuldausschließenden unvermeidbaren Verbotsirrtum. Es greift dann § 17 S. 2 StGB, der gem. § 49 I StGB zur Strafmilderung führt. All das setzt jedoch voraus, dass man (mit dem BayObLG) den Tatbestand des § 1 I Nr. 2 ESchG als erfüllt ansieht, was nach der hier vertretenen Auffassung aber nicht der Fall ist. Insofern stellt sich von dem hier vertretenen Standpunkt aus schon gar nicht die Problematik des Verbotsirrtums.
Rolf Schmidt (07.11.2020)
21.10.2020: Gutgläubiger Erwerb einer unterschlagenen Sache vom Nichtberechtigten
BGH, Urt. v. 18.09.2020 – V ZR 8/19
Mit Urteil v. 18.09.2020 (V ZR 8/19) hat der BGH entschieden, dass die Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Verkäufer zu einer unbegleiteten und auch nicht anderweitig überwachten Probefahrt eines Kaufinteressenten auf öffentlichen Straßen für eine gewisse Dauer (hier eine Stunde) keine Besitzlockerung sei, sondern zu einem freiwilligen Besitzverlust führe, der gem. § 932 I BGB einen gutgläubigen Erwerb durch einen Dritten ermögliche und kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB begründe, das einen gutgläubigen Erwerb ausschließe. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Unter Vorlage eines gefälschten Personalausweises und eines gefälschten Führerscheins bekundete T im Autohaus des A Kaufinteresse an einem bisher als Vorführwagen genutzten Pkw der Oberklasse. Auf diese Weise erschlich er sich eine Probefahrt, von der er aber nicht zu A zurückkehrte.
Ein paar Wochen später inserierte T den Wagen in einem Internet-Verkaufsportal. O, einem Interessenten, mit dem sich T in der Innenstadt am Bahnhof traf, legte T gefälschte (auf seinen Namen ausgestellte) Fahrzeugpapiere, den seinerzeit von A erhaltenen Originalschlüssel sowie einen als Zweitschlüssel ausgegebenen anderen (jedoch nicht funktionierenden) Schlüssel vor. Die gefälschten Fahrzeugpapiere waren für O als solche nicht erkennbar, da die Blanko-Dokumente aus einem Einbruchdiebstahl bei einer Kfz-Zulassungsstelle stammten. O, der keinerlei Anlass sah, an der Eigentümerstellung des T und der Echtheit der Papiere zu zweifeln, kaufte daraufhin das Fahrzeug zu einem Preis von rund 44.000 €. Als O den Wagen am nächsten Tag bei der Zulassungsstelle auf seinen Namen umschreiben lassen wollte, verweigerte diese dies, da der Wagen von A als gestohlen gemeldet worden war. Der Geschäftsführer von A verlangt daraufhin von O die Herausgabe des Fahrzeugs.
II. Rechtliche Ausgangslage
Das Eigentum an Sachen kann einerseits durch Rechtsgeschäft und andererseits durch Gesetz erworben werden. Der rechtsgeschäftliche Erwerb ist für Immobilien in §§ 873, 925 BGB und für bewegliche Sachen in §§ 929 ff. BGB geregelt. Ein gesetzlicher Eigentumserwerb findet sich für Immobilien bspw. in § 900 BGB (Buchersitzung) und für Mobilien bspw. in § 937 BGB (Ersitzung) oder § 946 BGB (Verbindung). Der gesetzliche Eigentumserwerb wegen eines Erbfalls richtet sich nach § 1922 BGB. Im vorliegenden Zusammenhang ist allein der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb bzgl. beweglicher Sachen von Relevanz.
In §§ 929-931 BGB ist zunächst der Erwerb vom Berechtigten normiert. Dabei erfolgt die Prüfung nach folgendem Grundschema: Erforderlich sind eine dingliche Einigung, jedenfalls grundsätzlich ein Publizitätsakt und schließlich die Berechtigung und die Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Der Publizitätsakt besteht nach der Grundnorm des § 929 S. 1 BGB in der Übergabe der Sache. Die Übergabe kann aber u.U. entbehrlich sein (§ 929 S. 2 BGB) oder durch ein Übergabesurrogat ersetzt werden (§§ 930, 931 BGB). Das in § 929 S. 1 BGB genannte Erfordernis der Einigung setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus, die auf die Eigentumsübertragung gerichtet sind. Die Einigung ist damit als dinglicher Vertrag anzusehen. Der für eine Verfügung grundsätzlich erforderliche Publizitätsakt wird von § 929 S. 1 BGB durch die Notwendigkeit einer Übergabe angeordnet. Mit „Übergabe“ ist der Besitzübergang vom Veräußerer auf den Erwerber gemeint; der Veräußerer muss dazu jeglichen Besitz aufgeben (klarstellend BGH NJW 2013, 3525, 3526). Eine Regelung über die Berechtigung und die Verfügungsbefugnis des Veräußerers wird dagegen in § 929 S. 1 BGB nicht ausdrücklich getroffen. Dieses Erfordernis folgt vielmehr aus der Natur der Sache, namentlich daraus, dass niemand über mehr Rechtsmacht verfügen kann, als ihm zusteht (Ausnahmen: Einwilligung/Ermächtigung bzw. Genehmigung des Berechtigten oder Gutglaubenserwerb). Zudem wird in tatbestandlicher Abgrenzung zu § 932 BGB deutlich, dass § 929 S. 1 BGB von einer Berechtigung (bzw. Eigentümerstellung) des Veräußerers ausgeht.
Verfügt jemand über ein dingliches Recht, ohne dessen Inhaber zu sein, besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dass die Verfügung dennoch wirksam ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn er kraft Gesetzes (vgl. z.B. §§ 2205 BGB, 80 I InsO) oder kraft eines Rechtsgeschäfts mit dem Rechtsinhaber (§ 185 BGB) zur Veräußerung ermächtigt ist. Liegt keiner dieser Fälle vor, kann eine wirksame Verfügung darüber hinaus in Gestalt eines Gutglaubenserwerbs vorliegen. Die Tatbestände für einen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten sind in §§ 932 ff. BGB kodifiziert. Diese Vorschriften ermöglichen einen Rechtserwerb vom Nichteigentümer/Nichtberechtigten und zielen darauf ab, den Rechtsverkehr mit beweglichen Sachen zu erleichtern und rechtssicher zu gestalten (BGHZ 122, 180, 197), mithin einen Verkehrsschutz zu gewährleisten. Es mag zwar dem (Alt-)Eigentümer unbillig erscheinen, dass er aufgrund der Verfügung eines anderen sein Eigentum verliert. Jedoch darf man auch nicht die Interessen des gutgläubigen Erwerbers unberücksichtigt lassen. Man möge sich in die Situation versetzen, dass man im guten Glauben eine Sache von einem unbekannten Händler im Internet kauft und bezahlt und anschließend vom (Alt-)Eigentümer auf Herausgabe in Anspruch genommen wird. Müsste hier der Erwerber die Sache herausgeben, wäre dies aus seiner Sicht ebenso unbillig, auch wenn er ggf. Rückforderungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Veräußerer hätte. Daher musste der Gesetzgeber eine Entscheidung treffen, wen er letztlich in Bezug auf die Eigentümerstellung als schutzwürdiger ansieht. Dabei hat er wie folgt differenziert: Hat der (bisherige) Eigentümer den Besitz an der Sache zuvor freiwillig aufgegeben, ist er weniger schutzwürdig, als wenn ihm die Sache unfreiwillig abhandengekommen wäre.
So ist gem. § 932 I BGB ein gutgläubiger Erwerb die Regel, wenn der Eigentümer den Besitz freiwillig aufgibt (etwa im Zuge eines Miet- oder Leihvertrags) und der Besitzer dann unberechtigt die Sache an einen Dritten veräußert, der gutgläubig davon ausging, der Veräußerer sei Eigentümer. Unter welchen Voraussetzungen die Gutgläubigkeit angekommen werden kann, regelt § 932 II BGB: „Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.“ Diese Negativformulierung trifft eine Beweislastzuordnung: Wer sich auf einen gutgläubigen Erwerb beruft, muss die Voraussetzungen des Erwerbstatbestands (wie die des § 929 BGB) beweisen. Bestreitet dann der (Alt-)Eigentümer den Eigentumserwerb, muss dieser beweisen, dass der Erwerber nicht in gutem Glauben war.
Beispiel: Adelheid (A) leiht sich von ihrer Freundin Brunhilde (B) deren Mountainbike, um ins Kino zu fahren. Auf dem Nachhauseweg begegnet sie der redlichen Neele (N), der sie unter Vorspiegelung, Eigentümerin des Fahrrads zu sein, das Fahrrad für (angemessene) 100,- € verkauft und übergibt. B verlangt von N die Herausgabe des Fahrrades.
BGH, Urt. v. 18.09.2020 – V ZR 8/19
Mit Urteil v. 18.09.2020 (V ZR 8/19) hat der BGH entschieden, dass die Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Verkäufer zu einer unbegleiteten und auch nicht anderweitig überwachten Probefahrt eines Kaufinteressenten auf öffentlichen Straßen für eine gewisse Dauer (hier eine Stunde) keine Besitzlockerung sei, sondern zu einem freiwilligen Besitzverlust führe, der gem. § 932 I BGB einen gutgläubigen Erwerb durch einen Dritten ermögliche und kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB begründe, das einen gutgläubigen Erwerb ausschließe. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen und methodisch geordneten Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Unter Vorlage eines gefälschten Personalausweises und eines gefälschten Führerscheins bekundete T im Autohaus des A Kaufinteresse an einem bisher als Vorführwagen genutzten Pkw der Oberklasse. Auf diese Weise erschlich er sich eine Probefahrt, von der er aber nicht zu A zurückkehrte.
Ein paar Wochen später inserierte T den Wagen in einem Internet-Verkaufsportal. O, einem Interessenten, mit dem sich T in der Innenstadt am Bahnhof traf, legte T gefälschte (auf seinen Namen ausgestellte) Fahrzeugpapiere, den seinerzeit von A erhaltenen Originalschlüssel sowie einen als Zweitschlüssel ausgegebenen anderen (jedoch nicht funktionierenden) Schlüssel vor. Die gefälschten Fahrzeugpapiere waren für O als solche nicht erkennbar, da die Blanko-Dokumente aus einem Einbruchdiebstahl bei einer Kfz-Zulassungsstelle stammten. O, der keinerlei Anlass sah, an der Eigentümerstellung des T und der Echtheit der Papiere zu zweifeln, kaufte daraufhin das Fahrzeug zu einem Preis von rund 44.000 €. Als O den Wagen am nächsten Tag bei der Zulassungsstelle auf seinen Namen umschreiben lassen wollte, verweigerte diese dies, da der Wagen von A als gestohlen gemeldet worden war. Der Geschäftsführer von A verlangt daraufhin von O die Herausgabe des Fahrzeugs.
II. Rechtliche Ausgangslage
Das Eigentum an Sachen kann einerseits durch Rechtsgeschäft und andererseits durch Gesetz erworben werden. Der rechtsgeschäftliche Erwerb ist für Immobilien in §§ 873, 925 BGB und für bewegliche Sachen in §§ 929 ff. BGB geregelt. Ein gesetzlicher Eigentumserwerb findet sich für Immobilien bspw. in § 900 BGB (Buchersitzung) und für Mobilien bspw. in § 937 BGB (Ersitzung) oder § 946 BGB (Verbindung). Der gesetzliche Eigentumserwerb wegen eines Erbfalls richtet sich nach § 1922 BGB. Im vorliegenden Zusammenhang ist allein der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb bzgl. beweglicher Sachen von Relevanz.
In §§ 929-931 BGB ist zunächst der Erwerb vom Berechtigten normiert. Dabei erfolgt die Prüfung nach folgendem Grundschema: Erforderlich sind eine dingliche Einigung, jedenfalls grundsätzlich ein Publizitätsakt und schließlich die Berechtigung und die Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Der Publizitätsakt besteht nach der Grundnorm des § 929 S. 1 BGB in der Übergabe der Sache. Die Übergabe kann aber u.U. entbehrlich sein (§ 929 S. 2 BGB) oder durch ein Übergabesurrogat ersetzt werden (§§ 930, 931 BGB). Das in § 929 S. 1 BGB genannte Erfordernis der Einigung setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus, die auf die Eigentumsübertragung gerichtet sind. Die Einigung ist damit als dinglicher Vertrag anzusehen. Der für eine Verfügung grundsätzlich erforderliche Publizitätsakt wird von § 929 S. 1 BGB durch die Notwendigkeit einer Übergabe angeordnet. Mit „Übergabe“ ist der Besitzübergang vom Veräußerer auf den Erwerber gemeint; der Veräußerer muss dazu jeglichen Besitz aufgeben (klarstellend BGH NJW 2013, 3525, 3526). Eine Regelung über die Berechtigung und die Verfügungsbefugnis des Veräußerers wird dagegen in § 929 S. 1 BGB nicht ausdrücklich getroffen. Dieses Erfordernis folgt vielmehr aus der Natur der Sache, namentlich daraus, dass niemand über mehr Rechtsmacht verfügen kann, als ihm zusteht (Ausnahmen: Einwilligung/Ermächtigung bzw. Genehmigung des Berechtigten oder Gutglaubenserwerb). Zudem wird in tatbestandlicher Abgrenzung zu § 932 BGB deutlich, dass § 929 S. 1 BGB von einer Berechtigung (bzw. Eigentümerstellung) des Veräußerers ausgeht.
Verfügt jemand über ein dingliches Recht, ohne dessen Inhaber zu sein, besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dass die Verfügung dennoch wirksam ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn er kraft Gesetzes (vgl. z.B. §§ 2205 BGB, 80 I InsO) oder kraft eines Rechtsgeschäfts mit dem Rechtsinhaber (§ 185 BGB) zur Veräußerung ermächtigt ist. Liegt keiner dieser Fälle vor, kann eine wirksame Verfügung darüber hinaus in Gestalt eines Gutglaubenserwerbs vorliegen. Die Tatbestände für einen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten sind in §§ 932 ff. BGB kodifiziert. Diese Vorschriften ermöglichen einen Rechtserwerb vom Nichteigentümer/Nichtberechtigten und zielen darauf ab, den Rechtsverkehr mit beweglichen Sachen zu erleichtern und rechtssicher zu gestalten (BGHZ 122, 180, 197), mithin einen Verkehrsschutz zu gewährleisten. Es mag zwar dem (Alt-)Eigentümer unbillig erscheinen, dass er aufgrund der Verfügung eines anderen sein Eigentum verliert. Jedoch darf man auch nicht die Interessen des gutgläubigen Erwerbers unberücksichtigt lassen. Man möge sich in die Situation versetzen, dass man im guten Glauben eine Sache von einem unbekannten Händler im Internet kauft und bezahlt und anschließend vom (Alt-)Eigentümer auf Herausgabe in Anspruch genommen wird. Müsste hier der Erwerber die Sache herausgeben, wäre dies aus seiner Sicht ebenso unbillig, auch wenn er ggf. Rückforderungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Veräußerer hätte. Daher musste der Gesetzgeber eine Entscheidung treffen, wen er letztlich in Bezug auf die Eigentümerstellung als schutzwürdiger ansieht. Dabei hat er wie folgt differenziert: Hat der (bisherige) Eigentümer den Besitz an der Sache zuvor freiwillig aufgegeben, ist er weniger schutzwürdig, als wenn ihm die Sache unfreiwillig abhandengekommen wäre.
So ist gem. § 932 I BGB ein gutgläubiger Erwerb die Regel, wenn der Eigentümer den Besitz freiwillig aufgibt (etwa im Zuge eines Miet- oder Leihvertrags) und der Besitzer dann unberechtigt die Sache an einen Dritten veräußert, der gutgläubig davon ausging, der Veräußerer sei Eigentümer. Unter welchen Voraussetzungen die Gutgläubigkeit angekommen werden kann, regelt § 932 II BGB: „Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.“ Diese Negativformulierung trifft eine Beweislastzuordnung: Wer sich auf einen gutgläubigen Erwerb beruft, muss die Voraussetzungen des Erwerbstatbestands (wie die des § 929 BGB) beweisen. Bestreitet dann der (Alt-)Eigentümer den Eigentumserwerb, muss dieser beweisen, dass der Erwerber nicht in gutem Glauben war.
Beispiel: Adelheid (A) leiht sich von ihrer Freundin Brunhilde (B) deren Mountainbike, um ins Kino zu fahren. Auf dem Nachhauseweg begegnet sie der redlichen Neele (N), der sie unter Vorspiegelung, Eigentümerin des Fahrrads zu sein, das Fahrrad für (angemessene) 100,- € verkauft und übergibt. B verlangt von N die Herausgabe des Fahrrades.
Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB?
Der geltend gemachte Herausgabeanspruch könnte sich aus § 985 BGB ergeben. Danach kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe verlangen (wobei gem. § 986 BGB der Besitzer die Herausgabe verweigern kann, wenn er – etwa aus einem Miet- oder Leihvertrag – ein Recht zum Besitz hat).
Ursprünglich war B Eigentümerin des Fahrrades. Zu prüfen ist aber, ob sie zwischenzeitlich das Eigentum verloren hat.
Jedenfalls hat B nicht in Folge des Leihvertrags (§ 598 BGB) Eigentum (zunächst an A) verloren. Zum einen ist ein Leihvertrag nur auf Besitzübertragung (und nicht auch auf Eigentumsübertragung) gerichtet und zum anderen fand in diesem Zusammenhang auch keine Übereignung (an A) statt.
Möglicherweise hat B aber Eigentum aufgrund des Verhaltens A ggü N verloren:
- Eigentumsverlust gem. § 929 S. 1 BGB? (-), da A weder Eigentümerin noch sonst berechtigt; sie hatte das Fahrrad lediglich geliehen (§ 598 BGB) und war von B auch nicht zur Veräußerung ermächtigt worden (§ 185 I BGB).
- Eigentumsverlust gem. § 932 I BGB? (+), da N gutgläubig (siehe § 1006 I S. 1 BGB; ein krasses Missverhältnis zwischen Wert und Preis, das gem. § 932 II BGB den guten Glauben hätte erschüttern können, ist nicht erkennbar).
- Auch kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB.
B ist also nicht mehr Eigentümerin; sie hat keinen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB.
Herausgabeanspruch gem. § 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB?
(-), da B nicht an N geleistet hat. Ein grds. denkbarer Herausgabeanspruch aus § 812 I S. 1 Var. 2 BGB (allg. Nichtleistungskondiktion: Bereicherung „auf sonstige Weise“) scheidet wegen Subsidiarität aus. Denn ließe man § 812 I S. 1 Var. 2 BGB zu, nivellierte man den gutgläubigen Erwerbstatbestand bei N.
Herausgabeanspruch gem. § 822 BGB?
(-), da A der N das Fahrrad nicht unentgeltlich zugewendet hat.
Herausgabeanspruch gem. § 604 IV BGB?
Vordergründig denkbar, da es auf die Berechtigung zur Überlassung nicht ankommt und A zudem das Mountainbike weitergegeben hat. Allerdings spricht § 604 IV BGB von „Gebrauchsüberlassung“ und meint damit nur eine Besitzüberlassung. Wie geprüft, ist N aber Eigentümerin geworden gem. §§ 929 S. 1, 932 I BGB.
Ergebnis
B kann das Fahrrad von N weder vindizieren noch kondizieren.
Demgegenüber scheidet gem. § 935 I BGB ein gutgläubiger Erwerb aus, wenn die Sache abhandengekommen ist. Das ist der Fall, wenn der Eigentümer (oder – wie sich aus § 935 I S. 2 BGB ergibt – sein Besitzmittler) den unmittelbaren Besitz ohne – nicht notwendig gegen – seinen Willen verloren hat.
Beispiel: Adelheid hat sich von ihrer Freundin Brunhilde das Mountainbike nicht geliehen, sondern von ihr gestohlen, bevor sie es der redlichen Neele unter Vorspiegelung, Eigentümerin des Fahrrads zu sein, für 100,- € verkauft und übergibt.
Der geltend gemachte Herausgabeanspruch könnte sich aus § 985 BGB ergeben. Danach kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe verlangen (wobei gem. § 986 BGB der Besitzer die Herausgabe verweigern kann, wenn er – etwa aus einem Miet- oder Leihvertrag – ein Recht zum Besitz hat).
Ursprünglich war B Eigentümerin des Fahrrades. Zu prüfen ist aber, ob sie zwischenzeitlich das Eigentum verloren hat.
Jedenfalls hat B nicht in Folge des Leihvertrags (§ 598 BGB) Eigentum (zunächst an A) verloren. Zum einen ist ein Leihvertrag nur auf Besitzübertragung (und nicht auch auf Eigentumsübertragung) gerichtet und zum anderen fand in diesem Zusammenhang auch keine Übereignung (an A) statt.
Möglicherweise hat B aber Eigentum aufgrund des Verhaltens A ggü N verloren:
- Eigentumsverlust gem. § 929 S. 1 BGB? (-), da A weder Eigentümerin noch sonst berechtigt; sie hatte das Fahrrad lediglich geliehen (§ 598 BGB) und war von B auch nicht zur Veräußerung ermächtigt worden (§ 185 I BGB).
- Eigentumsverlust gem. § 932 I BGB? (+), da N gutgläubig (siehe § 1006 I S. 1 BGB; ein krasses Missverhältnis zwischen Wert und Preis, das gem. § 932 II BGB den guten Glauben hätte erschüttern können, ist nicht erkennbar).
- Auch kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB.
B ist also nicht mehr Eigentümerin; sie hat keinen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB.
Herausgabeanspruch gem. § 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB?
(-), da B nicht an N geleistet hat. Ein grds. denkbarer Herausgabeanspruch aus § 812 I S. 1 Var. 2 BGB (allg. Nichtleistungskondiktion: Bereicherung „auf sonstige Weise“) scheidet wegen Subsidiarität aus. Denn ließe man § 812 I S. 1 Var. 2 BGB zu, nivellierte man den gutgläubigen Erwerbstatbestand bei N.
Herausgabeanspruch gem. § 822 BGB?
(-), da A der N das Fahrrad nicht unentgeltlich zugewendet hat.
Herausgabeanspruch gem. § 604 IV BGB?
Vordergründig denkbar, da es auf die Berechtigung zur Überlassung nicht ankommt und A zudem das Mountainbike weitergegeben hat. Allerdings spricht § 604 IV BGB von „Gebrauchsüberlassung“ und meint damit nur eine Besitzüberlassung. Wie geprüft, ist N aber Eigentümerin geworden gem. §§ 929 S. 1, 932 I BGB.
Ergebnis
B kann das Fahrrad von N weder vindizieren noch kondizieren.
Demgegenüber scheidet gem. § 935 I BGB ein gutgläubiger Erwerb aus, wenn die Sache abhandengekommen ist. Das ist der Fall, wenn der Eigentümer (oder – wie sich aus § 935 I S. 2 BGB ergibt – sein Besitzmittler) den unmittelbaren Besitz ohne – nicht notwendig gegen – seinen Willen verloren hat.
Beispiel: Adelheid hat sich von ihrer Freundin Brunhilde das Mountainbike nicht geliehen, sondern von ihr gestohlen, bevor sie es der redlichen Neele unter Vorspiegelung, Eigentümerin des Fahrrads zu sein, für 100,- € verkauft und übergibt.
Hier konnte N trotz ihrer Gutgläubigkeit kein Eigentum am Fahrrad erwerben (§§ 929 S. 1, 932 I, 935 I BGB). B kann das Fahrrad also bei N vindizieren (§ 985 BGB).
Weiterführender Hinweis: Sollte das Fahrrad inzwischen aber beschädigt oder nicht mehr auffindbar sein, macht der Vindikationsanspruch regelmäßig keinen Sinn. Das Gleiche gilt, wenn B eher Interesse an den 100,- € hat (etwa, weil das Fahrrad einen geringeren Wert hat). In Fällen dieser Art ist ihr zu empfehlen, das Geschäft zwischen A und N zu genehmigen (§ 185 II S. 1 BGB). Die Genehmigung hat zur Folge, dass die Verfügung der A wirksam wird und diese den Verkaufserlös gem. § 816 I S. 1 BGB an B herausgeben muss. Da eine Genehmigung auch konkludent erfolgen kann, genügt die schlichte Aufforderung gegenüber A, das Geld herauszugeben. Selbstverständlich ist A der B auch in diesem Fall zum Schadensersatz (deliktisch aus § 823 I BGB, aus § 823 II BGB i.V.m. § 242 StGB und aus § 826 BGB; sachenrechtlich aus §§ 989, 990 BGB) und nach § 687 II BGB (Geschäftsanmaßung) verpflichtet.
Im Verhältnis zu N ist jedoch zu beachten, dass B durch die Genehmigung selbstverständlich den Vindikationsanspruch aus § 985 BGB verliert.
Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, ist trotz des Glaubens, der Veräußerer sei Eigentümer (bzw. zur Veräußerung berechtigt), gem. § 935 I BGB ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen, wenn die Sache „abhandengekommen" war. Im Sinne des § 935 I BGB ist eine Sache abhandengekommen, wenn der Eigentümer (oder – wie sich aus § 935 I S. 2 BGB ergibt – sein Besitzmittler) den unmittelbaren Besitz ohne – nicht notwendig gegen – seinen Willen verloren hat. Wer Besitzmittler ist, ist in § 868 BGB geregelt: „Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer“. Nach dieser Legaldefinition zum mittelbaren Besitz ist der mittelbare Besitzer also derjenige, der die tatsächliche Gewalt durch einen unmittelbaren Besitzer – den Besitzmittler – für sich ausüben lässt. Dabei handelt es sich wie beim unmittelbaren Besitz ebenfalls um eine tatsächliche Herrschaftsbeziehung einer Person zu einer Sache, die allerdings nicht direkt, sondern durch einen Dritten vermittelt wird.
Beispiel: Vermietet V eine Wohnung an M, ist M der unmittelbare Fremdbesitzer und mittelt V den Besitz, der dadurch zum mittelbaren Eigenbesitzer wird. M ist also Besitzmittler; er vermittelt V den Besitz (Wellenhofer, SachenR, § 4 Rn. 20).
Weiterführender Hinweis: Sollte das Fahrrad inzwischen aber beschädigt oder nicht mehr auffindbar sein, macht der Vindikationsanspruch regelmäßig keinen Sinn. Das Gleiche gilt, wenn B eher Interesse an den 100,- € hat (etwa, weil das Fahrrad einen geringeren Wert hat). In Fällen dieser Art ist ihr zu empfehlen, das Geschäft zwischen A und N zu genehmigen (§ 185 II S. 1 BGB). Die Genehmigung hat zur Folge, dass die Verfügung der A wirksam wird und diese den Verkaufserlös gem. § 816 I S. 1 BGB an B herausgeben muss. Da eine Genehmigung auch konkludent erfolgen kann, genügt die schlichte Aufforderung gegenüber A, das Geld herauszugeben. Selbstverständlich ist A der B auch in diesem Fall zum Schadensersatz (deliktisch aus § 823 I BGB, aus § 823 II BGB i.V.m. § 242 StGB und aus § 826 BGB; sachenrechtlich aus §§ 989, 990 BGB) und nach § 687 II BGB (Geschäftsanmaßung) verpflichtet.
Im Verhältnis zu N ist jedoch zu beachten, dass B durch die Genehmigung selbstverständlich den Vindikationsanspruch aus § 985 BGB verliert.
Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, ist trotz des Glaubens, der Veräußerer sei Eigentümer (bzw. zur Veräußerung berechtigt), gem. § 935 I BGB ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen, wenn die Sache „abhandengekommen" war. Im Sinne des § 935 I BGB ist eine Sache abhandengekommen, wenn der Eigentümer (oder – wie sich aus § 935 I S. 2 BGB ergibt – sein Besitzmittler) den unmittelbaren Besitz ohne – nicht notwendig gegen – seinen Willen verloren hat. Wer Besitzmittler ist, ist in § 868 BGB geregelt: „Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer“. Nach dieser Legaldefinition zum mittelbaren Besitz ist der mittelbare Besitzer also derjenige, der die tatsächliche Gewalt durch einen unmittelbaren Besitzer – den Besitzmittler – für sich ausüben lässt. Dabei handelt es sich wie beim unmittelbaren Besitz ebenfalls um eine tatsächliche Herrschaftsbeziehung einer Person zu einer Sache, die allerdings nicht direkt, sondern durch einen Dritten vermittelt wird.
Beispiel: Vermietet V eine Wohnung an M, ist M der unmittelbare Fremdbesitzer und mittelt V den Besitz, der dadurch zum mittelbaren Eigenbesitzer wird. M ist also Besitzmittler; er vermittelt V den Besitz (Wellenhofer, SachenR, § 4 Rn. 20).
Ist also ein Besitzmittler „dazwischengeschaltet“, kommt es bei der Frage nach dem Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB auf dessen Willen an. Handelt es sich bei der „dazwischengeschalteten“ Person lediglich um einen Besitzdiener, ist hingegen auf den Willen des „Besitzherrn“ abzustellen. Denn nach § 855 BGB ist im Fall, dass jemand die tatsächliche Gewalt als Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB für einen anderen ausübt, nur der andere (d.h. der „Besitzherr“) Besitzer. Bei der Frage nach dem „Abhandenkommen“ ist bei Besitzdienerschaft also auf den Willen des „Besitzherrn“ abzustellen. Bei der Frage nach dem gutgläubigen Erwerb
vom Nichtberechtigten kann es also entscheidend
sein, ob es sich bei der „dazwischengeschalteten“ Person um einen Besitzmittler
oder um einen Besitzdiener
handelt. Um ebendiese Frage geht es im vorliegend zu besprechenden (und zu prüfenden) Fall.
III. Prüfung des Falls/Entscheidung des BGH
Der vom Geschäftsführer von A (im Folgenden: A) geltend gemachte Herausgabeanspruch könnte sich zunächst auf § 985 BGB stützen. Dazu müsste A zunächst (noch) Eigentümer des Fahrzeugs sein.
Ursprünglich war A Eigentümer. Er könnte das Eigentum aber verloren haben. Keinesfalls hat A das Eigentum durch die Aushändigung des Wagens an T verloren, weil hierin keine Übereignung i.S.d. § 929 S. 1 BGB lag, sondern allenfalls eine Besitzübertragung. A könnte aber das Eigentum durch das Verhalten des T gegenüber O verloren haben. T war weder Eigentümer noch sonst berechtigt, über das Fahrzeug zu verfügen. Mithin war er Nichtberechtigter und daher nicht befugt, Eigentum auf O zu übertragen. § 929 S. 1 BGB geht aber von der Eigentümerstellung oder Berechtigung des Veräußerers aus. Möglicherweise konnte O aber gem. § 932 BGB (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 468 ff.) gutgläubig Eigentum erwerben, da er davon ausging, T sei Eigentümer des Wagens.
Beim Gebrauchtwagenkauf gehört regelmäßig zu den Mindesterfordernissen für den gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens, dass sich der Erwerber die Zulassungsbescheinigung II (früher: Kfz-Brief) vorlegen lässt, um die Berechtigung des Veräußerers zu prüfen (st. Rspr., vgl. etwa BGH NJW 2013, 1946, 1947; BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 35). Zwar verbrieft die Zulassungsbescheinigung II nicht das Eigentum am Kfz, sondern ist eine öffentliche Urkunde über die Einzelbetriebserlaubnis des Fahrzeugs, gleichwohl ist aber anhand der Eintragungen die Möglichkeit gegeben, bei dem eingetragenen Berechtigten die Übereignungsbefugnis des Veräußerers nachzuprüfen (BGH NJW 2013, 1946, 1947; siehe auch BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 35).
Anm.: Die Zulassungsbescheinigung II bescheinigt ausschließlich, dass das Fahrzeug, auf das sie ausgestellt ist, nach seiner Bauart für den Straßenverkehr zugelassen ist. Daher müssen auch bestimmte Veränderungen am Fahrzeug (z.B. Leistungssteigerung, Änderung des Abgasverhaltens, Einbau einer Autogasanlage etc.) in diese Urkunde eingetragen werden, damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird. Des Weiteren bescheinigt die Zulassungsbescheinigung II, wer über das Fahrzeug öffentlich-rechtlich verfügungsberechtigt ist, d.h., wer die Berechtigung zur Fahrzeuganmeldung, -ummeldung und -abmeldung hat. Aus diesem Grund geht die Zulassungsbescheinigung II analog § 952 II BGB bei einer Veräußerung des Fahrzeugs automatisch auf das Eigentum des Erwerbers mit über. Sie ist daher dem Erwerber des Kfz mit auszuhändigen.
Vor diesem Hintergrund wird eine grobe Fahrlässigkeit (i.S.d. § 932 II BGB) z.B. angenommen, wenn jemand (von privat) einen Gebrauchtwagen kauft und vom Veräußerer keine – oder eine auf einen fremden Namen lautende – Kfz-Zulassungsbescheinigung II ausgehändigt bekommt und keine weiteren Nachforschungen anstellt (BGH NJW 1975, 735, 736; NJW 2006, 2226, 2227; NJW 2006, 3488; NJW 2013, 1946, 1947; Gursky, JZ 2005, 285, 289; vgl. aber den Fall BGH NJW 2014, 1524, wo sich der BGH an die Feststellungen des Berufungsgerichts gebunden sieht und eine Gutgläubigkeit jedenfalls dann nicht in Frage stellt, wenn das Fahrzeug in einem (seriösen) Autohaus gekauft wird). Auch macht es für die Frage nach der Gutgläubigkeit einen Unterschied, ob Vertragsunterzeichnung und Fahrzeugübergabe in bzw. bei der Wohnung des Veräußerers oder bspw. auf einem öffentlichen Parkplatz (sog. Straßenverkauf, vgl. dazu den Fall BGH NJW 2014, 1946, 1947) stattfinden, ob sämtliche Fahrzeugschlüssel, Servicenachweise (Werkstattrechnungen) etc. vorhanden sind (vgl. OLG Koblenz NJW-RR 2011, 555) oder ob die dem Erwerber gegenüberstehende Person ihre Identität preisgibt (vgl. dazu ebenfalls den Fall BGH NJW 2014, 1946, 1947).
Danach erscheint der gute Glaube bei O nicht zweifelsfrei, da er den Wagen am Bahnhof übernahm (und nicht in der Privatwohnung des T), was insbesondere bei hochpreisigen Gütern den Käufer dazu veranlassen sollte, Argwohn zu hegen. Auch stellt sich die Frage, ob er den zweiten Schlüssel auf seine Funktionalität hätte prüfen sollen.
Möglicherweise kommt es aber darauf nicht an, wenn bei T die Besitzereigenschaft fehlte. Denn nicht nur bei § 929 S. 1 BGB, sondern auch bei § 932 BGB muss der unmittelbare Besitz auf den Erwerber übergehen. Jedoch kann der Erwerber auch dann unmittelbaren Besitz erwerben, wenn der „Veräußerer“ keinen Besitz im Rechtssinne hatte, was z.B. beim Geheißerwerb (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 392 ff.) bzw. für den Fall anzunehmen ist, in dem der „Veräußerer“ lediglich Besitzdiener (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 192 ff.) ist. Bei einer Besitzdienerschaft ist gem. § 855 BGB allein derjenige, für den der Besitzdiener die tatsächliche Gewalt ausübt, Besitzer. Daher kann auch nicht der Besitzdiener über die Weggabe entscheiden. Gibt also der Besitzdiener die Sache freiwillig, aber ohne oder gegen den Willen des Besitzherrn weg, gilt der Gegenstand auch dann als abhandengekommen i.S.d. § 935 I BGB, wenn der Besitzdiener „freiwillig“ durch sein eigenmächtiges Handeln die Sache aus den Händen gibt (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 22). Ein gutgläubiger Erwerb i.S.d. § 932 BGB scheidet aus (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 15 ff.).
Ob vorliegend T unmittelbarer Besitzer war oder lediglich Besitzdiener (zur Abgrenzung siehe oben, II.), kann dahinstehen, wenn O gleichwohl unmittelbarer Besitzer geworden ist. Denn durch die Übernahme des Wagens übte dieser die von einem Sachherrschaftswillen getragene tatsächliche Herrschaft über eine Sache aus. Das aber bestimmt sich letztlich nach der Verkehrsauffassung (siehe nur BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 11 f.), weshalb angesichts des Vorverhaltens des T Zweifel angebracht sind. Aber auch diese Frage kann insoweit dahinstehen, wenn der gutgläubige Erwerb wegen § 935 I BGB ausgeschlossen war. Nach § 935 I BGB ist auch ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen, wenn die Sache dem Eigentümer (oder dessen Besitzmittler) gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhandengekommen war.
Da T den Wagen von A nicht gestohlen hat, kommt lediglich ein „,sonstiges" Abhandenkommen in Betracht. Ein Abhandenkommen setzt einen unfreiwilligen Besitzverlust voraus. Daran könnte es fehlen, da A Wagen und Wagenschlüssel T ja freiwillig überlassen hat. Daran ändert auch die Täuschungshandlung des T nichts (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 9). Wie der BGH richtig formuliert, bewirkt die Übergabe eines Schlüssels allerdings nur dann einen Besitzübergang am Wagen, wenn der Übergeber die tatsächliche Gewalt an der Sache willentlich und erkennbar aufgegeben und der Empfänger des Schlüssels sie in gleicher Weise erlangt hat (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 12 – mit Verweis auf BGH NJW-RR 2017, 818; BGHZ 199, 227). Hieran fehle es etwa, wenn der Schlüssel zwecks bloßer Besichtigung des Fahrzeugs übergeben wird (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 12 – mit Verweis auf BGH NJW-RR 2017, 818; BGHZ 199, 227). In einem solchen Fall liegt lediglich eine Besitzlockerung vor bzw. der Kaufinteressent wird lediglich Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB, nicht aber Besitzer. A hat den Schlüssel (und den Wagen) jedoch nicht lediglich zwecks Besichtigung übergeben, sondern er gestattete T eine unbegleitete Probefahrt. Die Überlassung eines Kfz durch den Verkäufer zu einer unbegleiteten und auch nicht anderweitig überwachten Probefahrt eines Kaufinteressenten für eine gewisse Dauer führt nach dem BGH weder zu einer bloßen Besitzlockerung noch zur Annahme einer Besitzdienerschaft, sondern zu einem Besitzübergang auf den Kaufinteressenten (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 10). Mit der (freiwilligen) Überlassung des Fahrzeugs zur Probefahrt gehe der Besitz auf den vermeintlichen Kaufinteressenten über und der Wagen sei nicht abhandengekommen (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 10).
Ergebnis: Findet also mit der Überlassung des Fahrzeugs zur unbegleiteten Probefahrt und der Aushändigung des Fahrzeugschlüssels eine echte Besitzübertragung statt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Kaufinteressenten (hier: T) nicht um einen Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB, sondern um einen Besitzmittler i.S.d. § 868 BGB mit der Folge, dass bei der Frage nach dem (un-)freiwilligen Besitzverlust auf dessen Willen abzustellen ist. Überträgt dieser also freiwillig den Besitz auf einen Dritten (hier: O), ist damit der Wagen nicht abhandengekommen i.S.d. § 935 I S. 1 BGB. Verneint man (mit dem BGH) also die Bösgläubigkeit i.S.d. § 932 II BGB bei O, konnte dieser somit gutgläubig Eigentum vom Nichtberechtigten erwerben (nach der hier vertretenen Auffassung sind Zweifel an der Verneinung der grob fahrlässigen Unkenntnis i.S.d. § 932 II BGB angebracht; der BGH hat die Feststellungen der Vorinstanz aber nicht beanstandet (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 28 ff.). Der von A geltend gemachte Herausgabeanspruch aus § 985 BGB besteht dann nicht. Um dieses Ergebnis nicht in Frage zu stellen, darf A auch nicht gem. § 812 I S. 1 Var. 2 BGB den Wagen kondizieren.
Rolf Schmidt (21.10.2020)
III. Prüfung des Falls/Entscheidung des BGH
Der vom Geschäftsführer von A (im Folgenden: A) geltend gemachte Herausgabeanspruch könnte sich zunächst auf § 985 BGB stützen. Dazu müsste A zunächst (noch) Eigentümer des Fahrzeugs sein.
Ursprünglich war A Eigentümer. Er könnte das Eigentum aber verloren haben. Keinesfalls hat A das Eigentum durch die Aushändigung des Wagens an T verloren, weil hierin keine Übereignung i.S.d. § 929 S. 1 BGB lag, sondern allenfalls eine Besitzübertragung. A könnte aber das Eigentum durch das Verhalten des T gegenüber O verloren haben. T war weder Eigentümer noch sonst berechtigt, über das Fahrzeug zu verfügen. Mithin war er Nichtberechtigter und daher nicht befugt, Eigentum auf O zu übertragen. § 929 S. 1 BGB geht aber von der Eigentümerstellung oder Berechtigung des Veräußerers aus. Möglicherweise konnte O aber gem. § 932 BGB (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 468 ff.) gutgläubig Eigentum erwerben, da er davon ausging, T sei Eigentümer des Wagens.
Beim Gebrauchtwagenkauf gehört regelmäßig zu den Mindesterfordernissen für den gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens, dass sich der Erwerber die Zulassungsbescheinigung II (früher: Kfz-Brief) vorlegen lässt, um die Berechtigung des Veräußerers zu prüfen (st. Rspr., vgl. etwa BGH NJW 2013, 1946, 1947; BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 35). Zwar verbrieft die Zulassungsbescheinigung II nicht das Eigentum am Kfz, sondern ist eine öffentliche Urkunde über die Einzelbetriebserlaubnis des Fahrzeugs, gleichwohl ist aber anhand der Eintragungen die Möglichkeit gegeben, bei dem eingetragenen Berechtigten die Übereignungsbefugnis des Veräußerers nachzuprüfen (BGH NJW 2013, 1946, 1947; siehe auch BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 35).
Anm.: Die Zulassungsbescheinigung II bescheinigt ausschließlich, dass das Fahrzeug, auf das sie ausgestellt ist, nach seiner Bauart für den Straßenverkehr zugelassen ist. Daher müssen auch bestimmte Veränderungen am Fahrzeug (z.B. Leistungssteigerung, Änderung des Abgasverhaltens, Einbau einer Autogasanlage etc.) in diese Urkunde eingetragen werden, damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird. Des Weiteren bescheinigt die Zulassungsbescheinigung II, wer über das Fahrzeug öffentlich-rechtlich verfügungsberechtigt ist, d.h., wer die Berechtigung zur Fahrzeuganmeldung, -ummeldung und -abmeldung hat. Aus diesem Grund geht die Zulassungsbescheinigung II analog § 952 II BGB bei einer Veräußerung des Fahrzeugs automatisch auf das Eigentum des Erwerbers mit über. Sie ist daher dem Erwerber des Kfz mit auszuhändigen.
Vor diesem Hintergrund wird eine grobe Fahrlässigkeit (i.S.d. § 932 II BGB) z.B. angenommen, wenn jemand (von privat) einen Gebrauchtwagen kauft und vom Veräußerer keine – oder eine auf einen fremden Namen lautende – Kfz-Zulassungsbescheinigung II ausgehändigt bekommt und keine weiteren Nachforschungen anstellt (BGH NJW 1975, 735, 736; NJW 2006, 2226, 2227; NJW 2006, 3488; NJW 2013, 1946, 1947; Gursky, JZ 2005, 285, 289; vgl. aber den Fall BGH NJW 2014, 1524, wo sich der BGH an die Feststellungen des Berufungsgerichts gebunden sieht und eine Gutgläubigkeit jedenfalls dann nicht in Frage stellt, wenn das Fahrzeug in einem (seriösen) Autohaus gekauft wird). Auch macht es für die Frage nach der Gutgläubigkeit einen Unterschied, ob Vertragsunterzeichnung und Fahrzeugübergabe in bzw. bei der Wohnung des Veräußerers oder bspw. auf einem öffentlichen Parkplatz (sog. Straßenverkauf, vgl. dazu den Fall BGH NJW 2014, 1946, 1947) stattfinden, ob sämtliche Fahrzeugschlüssel, Servicenachweise (Werkstattrechnungen) etc. vorhanden sind (vgl. OLG Koblenz NJW-RR 2011, 555) oder ob die dem Erwerber gegenüberstehende Person ihre Identität preisgibt (vgl. dazu ebenfalls den Fall BGH NJW 2014, 1946, 1947).
Danach erscheint der gute Glaube bei O nicht zweifelsfrei, da er den Wagen am Bahnhof übernahm (und nicht in der Privatwohnung des T), was insbesondere bei hochpreisigen Gütern den Käufer dazu veranlassen sollte, Argwohn zu hegen. Auch stellt sich die Frage, ob er den zweiten Schlüssel auf seine Funktionalität hätte prüfen sollen.
Möglicherweise kommt es aber darauf nicht an, wenn bei T die Besitzereigenschaft fehlte. Denn nicht nur bei § 929 S. 1 BGB, sondern auch bei § 932 BGB muss der unmittelbare Besitz auf den Erwerber übergehen. Jedoch kann der Erwerber auch dann unmittelbaren Besitz erwerben, wenn der „Veräußerer“ keinen Besitz im Rechtssinne hatte, was z.B. beim Geheißerwerb (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 392 ff.) bzw. für den Fall anzunehmen ist, in dem der „Veräußerer“ lediglich Besitzdiener (dazu Hütte/Hütte, Sachenrecht I, 8. Aufl. 2019, Rn. 192 ff.) ist. Bei einer Besitzdienerschaft ist gem. § 855 BGB allein derjenige, für den der Besitzdiener die tatsächliche Gewalt ausübt, Besitzer. Daher kann auch nicht der Besitzdiener über die Weggabe entscheiden. Gibt also der Besitzdiener die Sache freiwillig, aber ohne oder gegen den Willen des Besitzherrn weg, gilt der Gegenstand auch dann als abhandengekommen i.S.d. § 935 I BGB, wenn der Besitzdiener „freiwillig“ durch sein eigenmächtiges Handeln die Sache aus den Händen gibt (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 22). Ein gutgläubiger Erwerb i.S.d. § 932 BGB scheidet aus (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 15 ff.).
Ob vorliegend T unmittelbarer Besitzer war oder lediglich Besitzdiener (zur Abgrenzung siehe oben, II.), kann dahinstehen, wenn O gleichwohl unmittelbarer Besitzer geworden ist. Denn durch die Übernahme des Wagens übte dieser die von einem Sachherrschaftswillen getragene tatsächliche Herrschaft über eine Sache aus. Das aber bestimmt sich letztlich nach der Verkehrsauffassung (siehe nur BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 11 f.), weshalb angesichts des Vorverhaltens des T Zweifel angebracht sind. Aber auch diese Frage kann insoweit dahinstehen, wenn der gutgläubige Erwerb wegen § 935 I BGB ausgeschlossen war. Nach § 935 I BGB ist auch ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen, wenn die Sache dem Eigentümer (oder dessen Besitzmittler) gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhandengekommen war.
Da T den Wagen von A nicht gestohlen hat, kommt lediglich ein „,sonstiges" Abhandenkommen in Betracht. Ein Abhandenkommen setzt einen unfreiwilligen Besitzverlust voraus. Daran könnte es fehlen, da A Wagen und Wagenschlüssel T ja freiwillig überlassen hat. Daran ändert auch die Täuschungshandlung des T nichts (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 9). Wie der BGH richtig formuliert, bewirkt die Übergabe eines Schlüssels allerdings nur dann einen Besitzübergang am Wagen, wenn der Übergeber die tatsächliche Gewalt an der Sache willentlich und erkennbar aufgegeben und der Empfänger des Schlüssels sie in gleicher Weise erlangt hat (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 12 – mit Verweis auf BGH NJW-RR 2017, 818; BGHZ 199, 227). Hieran fehle es etwa, wenn der Schlüssel zwecks bloßer Besichtigung des Fahrzeugs übergeben wird (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 12 – mit Verweis auf BGH NJW-RR 2017, 818; BGHZ 199, 227). In einem solchen Fall liegt lediglich eine Besitzlockerung vor bzw. der Kaufinteressent wird lediglich Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB, nicht aber Besitzer. A hat den Schlüssel (und den Wagen) jedoch nicht lediglich zwecks Besichtigung übergeben, sondern er gestattete T eine unbegleitete Probefahrt. Die Überlassung eines Kfz durch den Verkäufer zu einer unbegleiteten und auch nicht anderweitig überwachten Probefahrt eines Kaufinteressenten für eine gewisse Dauer führt nach dem BGH weder zu einer bloßen Besitzlockerung noch zur Annahme einer Besitzdienerschaft, sondern zu einem Besitzübergang auf den Kaufinteressenten (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 10). Mit der (freiwilligen) Überlassung des Fahrzeugs zur Probefahrt gehe der Besitz auf den vermeintlichen Kaufinteressenten über und der Wagen sei nicht abhandengekommen (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 10).
Ergebnis: Findet also mit der Überlassung des Fahrzeugs zur unbegleiteten Probefahrt und der Aushändigung des Fahrzeugschlüssels eine echte Besitzübertragung statt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Kaufinteressenten (hier: T) nicht um einen Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB, sondern um einen Besitzmittler i.S.d. § 868 BGB mit der Folge, dass bei der Frage nach dem (un-)freiwilligen Besitzverlust auf dessen Willen abzustellen ist. Überträgt dieser also freiwillig den Besitz auf einen Dritten (hier: O), ist damit der Wagen nicht abhandengekommen i.S.d. § 935 I S. 1 BGB. Verneint man (mit dem BGH) also die Bösgläubigkeit i.S.d. § 932 II BGB bei O, konnte dieser somit gutgläubig Eigentum vom Nichtberechtigten erwerben (nach der hier vertretenen Auffassung sind Zweifel an der Verneinung der grob fahrlässigen Unkenntnis i.S.d. § 932 II BGB angebracht; der BGH hat die Feststellungen der Vorinstanz aber nicht beanstandet (BGH 18.9.2020 – V ZR 8/19 Rn. 28 ff.). Der von A geltend gemachte Herausgabeanspruch aus § 985 BGB besteht dann nicht. Um dieses Ergebnis nicht in Frage zu stellen, darf A auch nicht gem. § 812 I S. 1 Var. 2 BGB den Wagen kondizieren.
Rolf Schmidt (21.10.2020)
17.08.2020: Zur Aufhebbarkeit von im Ausland geschlossenen Ehen mit Minderjährigen
BGH, Beschl. v. 22.07.2020 – XII ZB 131/20
Mit Beschluss v. 22.07.2020 (XII ZB 131/20) hat der BGH entschieden, dass sich die Aufhebbarkeit einer Auslandsehe, die mit einem Ehegatten geschlossen worden ist, der bei Eheschließung zwar das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, nach §§ 1313 ff. BGB in der aktuell geltenden Fassung richtet. Die Überleitungsvorschriften der Art. 229 § 44 I und II EGBGB seien auf solche Ehen nicht – auch nicht entsprechend – anzuwenden. Bei der Frage, ob eine Minderjährigenehe bei Vorliegen des Aufhebungsgrundes des § 1314 I Nr. 1 BGB aufzuheben sei, komme dem Richter ein eingeschränktes Ermessen zu. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Die Ehegatten, damals beide libanesische Staatsangehörige muslimischen Glaubens, schlossen vor rund 19 Jahren im Libanon die Ehe. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war der Mann (M) 21 Jahre alt, die Frau (F) stand rund zwei Monate vor ihrem 17. Geburtstag. 2 Jahre später immigrierte das Ehepaar nach Deutschland. In der Folgezeit wurden vier Kinder geboren. Vor ca. 2 Jahren trennten sich die Eheleute. Seit der Trennung leben die vier Kinder im Haushalt der F, die einen neuen Lebensgefährten hat. Die Ehegatten sind inzwischen nach islamischem Recht geschieden. Anlässlich einer standesamtlichen Beurkundung teilte F auf Nachfrage der Standesbeamtin mit, die Ehe nicht fortsetzen zu wollen. Daraufhin beantragte die Standesbehörde beim Amtsgericht, die Ehe aufzuheben, weil F bei der Eheschließung minderjährig gewesen sei.
II. Rechtliche Ausgangslage
Aufgrund des Umstands, dass eine Ehe sowohl besondere personenrechtliche als auch vermögensrechtliche Verpflichtungen beinhaltet, die (jedenfalls, was die vermögensrechtlichen Verpflichtungen betrifft) auch nach einer Scheidung fortwirken können (man denke an Zugewinnausgleich, Unterhaltsansprüche, Versorgungsausgleich, Erbrechte etc.), versteht es sich von selbst, dass die Rechtsordnung nur solche Eheschließungen zulassen kann, bei denen die Eheschließungswilligen die Tragweite ihrer Entscheidung auch absehen können. Es erschiene geradezu paradox, wenn z.B. ein Minderjähriger nicht am allgemeinen Rechtsverkehr teilnehmen, aber die Ehe schließen dürfte. Daher setzt eine Eheschließung Ehemündigkeit der Ehewilligen voraus. Diese ist vom Gesetzgeber an die auch sonst maßgebliche Volljährigkeit, also an die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 2 BGB) gekoppelt (§ 1303 BGB).
Die bislang bestehende Möglichkeit, dass das Familiengericht auf Antrag eine Befreiung von dem erforderlichen Mindestalter erteilen kann, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger Ehepartner volljährig ist (§ 1303 II BGB a.F.), wurde mit Wirkung zum 22.7.2017 abgeschafft (BGBl I 2017, S. 2429). Diese anachronistische Regelung, die offenbar dem Umstand geschuldet war, eine schwangere minderjährige Frau verheiraten zu können, damit diese nicht ein „uneheliches“ Kind gebären muss, mag bis Mitte des 20. Jahrhunderts ihre Berechtigung gehabt haben, ist aber in einer modernen Gesellschaft, in der sowohl die unverheiratete Mutter als auch das nichteheliche Kind den gleichen Schutz genießen wie verheiratete Mütter und eheliche Kinder (vgl. Art. 6 IV und V GG), nicht mehr erforderlich; im Übrigen sind die ursprünglichen Beweggründe für diese Regelung auch nicht mehr gewichtig genug, um die Argumente, die eine Ehemündigkeit begründen, zu tragen.
Ein weiterer Grund für die Knüpfung der Ehemündigkeit an die Volljährigkeit besteht darin, dass im Zuge der Migration von Flüchtlingen junge Frauen in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, die teilweise bereits mit einem Alter von unter 14 Jahren (zwangsweise) verheiratet worden sind. Bei derart jungen Mädchen wird man kaum annehmen können, sie hätten die Tragweite ihrer Entscheidung erfasst oder gar eine Wahl gehabt. Richtig ist daher der Vorstoß des Gesetzgebers, eine Aufhebbarkeit bzgl. Ehen, die entgegen § 1303 S. 1 BGB mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die zum Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatten, anzuordnen, und sogar eine Unwirksamkeit bzgl. solcher Ehen anzuordnen, die mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 1303 S. 2 BGB).
Ist die Unwirksamkeitsanordnung bzgl. solcher Ehen, die mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 1303 S. 2 BGB), noch so sehr zu begrüßen, darf nicht übersehen werden, dass sie auch Probleme mit sich bringen kann, etwa für den Fall des Vorhandenseins von Kindern, die bei einer Unwirksamkeitserklärung in Bezug auf die Ehe ohne juristischen Vater dastünden. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Regelung in Art. 229 § 44 I S. 1 EGBGB eine Überleitungsvorschrift geschaffen, wonach die Neuregelung (d.h. § 1303 S. 2 BGB n.F.) für Ehen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung geschlossen worden sind, nicht anzuwenden ist. An die Stelle der Unwirksamkeit tritt die Aufhebbarkeit nach den Regelungen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung bestanden, Art. 229 § 44 I S. 2 EGBGB. Jedoch ist zu beachten, dass sich die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 I EGBGB aufgrund der ausdrücklichen Bezugnahme auf § 1303 S. 2 BGB nur auf im Inland geschlossener Ehen beziehen kann (BGH 22.7.2020 – XII ZB 131/20 Rn. 20 unter Berufung auf BT-Drs. 18/12086 S. 24; BR-Drs. 275/17 S. 26). Bezüglich im Ausland geschlossener Ehen mit Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt die Regelung des Art. 229 § 44 IV EGBGB, der auf Art. 13 III Nr. 1 EGBGB verweist (BGH 22.7.2020 – XII ZB 131/20 Rn. 20).
In Bezug auf eine Ehe, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, greift die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 EGBGB nicht. So bezieht sich Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich auf eine Ehe, die mit einer Person geschlossen worden ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Zudem betrifft Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich Inlandsehen (s.o.). Art. 229 § 44 II EGBGB bezieht sich zwar auch auf § 1303 S. 1 BGB, knüpft allerdings an den Umstand an, dass die Ehe unter Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. (das sind die oben genannten Fälle) geschlossen worden ist. Das impliziert zugleich, dass es sich zwingend um Inlandsehen handeln muss, denn hinsichtlich Auslandsehen konnte es keine Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. geben. Daher gilt in Bezug auf eine Ehe, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die Regelung des § 1303 S. 1 BGB mit der Möglichkeit der Aufhebung nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das gilt auch für Ehen, die im Ausland geschlossen worden sind. Denn nach Art. 13 III Nr. 2 EGBGB ist die Ehe, auch wenn die Ehemündigkeit eines Verlobten nach Art. 13 I EGBGB ausländischem Recht unterliegt, aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Die auf den ersten Blick freilich nicht leicht zu überblickende Regelung war Gegenstand des vorliegend besprochenen BGH-Beschlusses.
BGH, Beschl. v. 22.07.2020 – XII ZB 131/20
Mit Beschluss v. 22.07.2020 (XII ZB 131/20) hat der BGH entschieden, dass sich die Aufhebbarkeit einer Auslandsehe, die mit einem Ehegatten geschlossen worden ist, der bei Eheschließung zwar das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, nach §§ 1313 ff. BGB in der aktuell geltenden Fassung richtet. Die Überleitungsvorschriften der Art. 229 § 44 I und II EGBGB seien auf solche Ehen nicht – auch nicht entsprechend – anzuwenden. Bei der Frage, ob eine Minderjährigenehe bei Vorliegen des Aufhebungsgrundes des § 1314 I Nr. 1 BGB aufzuheben sei, komme dem Richter ein eingeschränktes Ermessen zu. Ob die Entscheidung überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Die Ehegatten, damals beide libanesische Staatsangehörige muslimischen Glaubens, schlossen vor rund 19 Jahren im Libanon die Ehe. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war der Mann (M) 21 Jahre alt, die Frau (F) stand rund zwei Monate vor ihrem 17. Geburtstag. 2 Jahre später immigrierte das Ehepaar nach Deutschland. In der Folgezeit wurden vier Kinder geboren. Vor ca. 2 Jahren trennten sich die Eheleute. Seit der Trennung leben die vier Kinder im Haushalt der F, die einen neuen Lebensgefährten hat. Die Ehegatten sind inzwischen nach islamischem Recht geschieden. Anlässlich einer standesamtlichen Beurkundung teilte F auf Nachfrage der Standesbeamtin mit, die Ehe nicht fortsetzen zu wollen. Daraufhin beantragte die Standesbehörde beim Amtsgericht, die Ehe aufzuheben, weil F bei der Eheschließung minderjährig gewesen sei.
II. Rechtliche Ausgangslage
Aufgrund des Umstands, dass eine Ehe sowohl besondere personenrechtliche als auch vermögensrechtliche Verpflichtungen beinhaltet, die (jedenfalls, was die vermögensrechtlichen Verpflichtungen betrifft) auch nach einer Scheidung fortwirken können (man denke an Zugewinnausgleich, Unterhaltsansprüche, Versorgungsausgleich, Erbrechte etc.), versteht es sich von selbst, dass die Rechtsordnung nur solche Eheschließungen zulassen kann, bei denen die Eheschließungswilligen die Tragweite ihrer Entscheidung auch absehen können. Es erschiene geradezu paradox, wenn z.B. ein Minderjähriger nicht am allgemeinen Rechtsverkehr teilnehmen, aber die Ehe schließen dürfte. Daher setzt eine Eheschließung Ehemündigkeit der Ehewilligen voraus. Diese ist vom Gesetzgeber an die auch sonst maßgebliche Volljährigkeit, also an die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 2 BGB) gekoppelt (§ 1303 BGB).
Die bislang bestehende Möglichkeit, dass das Familiengericht auf Antrag eine Befreiung von dem erforderlichen Mindestalter erteilen kann, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger Ehepartner volljährig ist (§ 1303 II BGB a.F.), wurde mit Wirkung zum 22.7.2017 abgeschafft (BGBl I 2017, S. 2429). Diese anachronistische Regelung, die offenbar dem Umstand geschuldet war, eine schwangere minderjährige Frau verheiraten zu können, damit diese nicht ein „uneheliches“ Kind gebären muss, mag bis Mitte des 20. Jahrhunderts ihre Berechtigung gehabt haben, ist aber in einer modernen Gesellschaft, in der sowohl die unverheiratete Mutter als auch das nichteheliche Kind den gleichen Schutz genießen wie verheiratete Mütter und eheliche Kinder (vgl. Art. 6 IV und V GG), nicht mehr erforderlich; im Übrigen sind die ursprünglichen Beweggründe für diese Regelung auch nicht mehr gewichtig genug, um die Argumente, die eine Ehemündigkeit begründen, zu tragen.
Ein weiterer Grund für die Knüpfung der Ehemündigkeit an die Volljährigkeit besteht darin, dass im Zuge der Migration von Flüchtlingen junge Frauen in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, die teilweise bereits mit einem Alter von unter 14 Jahren (zwangsweise) verheiratet worden sind. Bei derart jungen Mädchen wird man kaum annehmen können, sie hätten die Tragweite ihrer Entscheidung erfasst oder gar eine Wahl gehabt. Richtig ist daher der Vorstoß des Gesetzgebers, eine Aufhebbarkeit bzgl. Ehen, die entgegen § 1303 S. 1 BGB mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die zum Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatten, anzuordnen, und sogar eine Unwirksamkeit bzgl. solcher Ehen anzuordnen, die mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 1303 S. 2 BGB).
Ist die Unwirksamkeitsanordnung bzgl. solcher Ehen, die mit Minderjährigen geschlossen worden sind, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben (§ 1303 S. 2 BGB), noch so sehr zu begrüßen, darf nicht übersehen werden, dass sie auch Probleme mit sich bringen kann, etwa für den Fall des Vorhandenseins von Kindern, die bei einer Unwirksamkeitserklärung in Bezug auf die Ehe ohne juristischen Vater dastünden. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Regelung in Art. 229 § 44 I S. 1 EGBGB eine Überleitungsvorschrift geschaffen, wonach die Neuregelung (d.h. § 1303 S. 2 BGB n.F.) für Ehen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung geschlossen worden sind, nicht anzuwenden ist. An die Stelle der Unwirksamkeit tritt die Aufhebbarkeit nach den Regelungen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung bestanden, Art. 229 § 44 I S. 2 EGBGB. Jedoch ist zu beachten, dass sich die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 I EGBGB aufgrund der ausdrücklichen Bezugnahme auf § 1303 S. 2 BGB nur auf im Inland geschlossener Ehen beziehen kann (BGH 22.7.2020 – XII ZB 131/20 Rn. 20 unter Berufung auf BT-Drs. 18/12086 S. 24; BR-Drs. 275/17 S. 26). Bezüglich im Ausland geschlossener Ehen mit Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt die Regelung des Art. 229 § 44 IV EGBGB, der auf Art. 13 III Nr. 1 EGBGB verweist (BGH 22.7.2020 – XII ZB 131/20 Rn. 20).
In Bezug auf eine Ehe, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, greift die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 EGBGB nicht. So bezieht sich Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich auf eine Ehe, die mit einer Person geschlossen worden ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Zudem betrifft Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich Inlandsehen (s.o.). Art. 229 § 44 II EGBGB bezieht sich zwar auch auf § 1303 S. 1 BGB, knüpft allerdings an den Umstand an, dass die Ehe unter Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. (das sind die oben genannten Fälle) geschlossen worden ist. Das impliziert zugleich, dass es sich zwingend um Inlandsehen handeln muss, denn hinsichtlich Auslandsehen konnte es keine Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. geben. Daher gilt in Bezug auf eine Ehe, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die Regelung des § 1303 S. 1 BGB mit der Möglichkeit der Aufhebung nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das gilt auch für Ehen, die im Ausland geschlossen worden sind. Denn nach Art. 13 III Nr. 2 EGBGB ist die Ehe, auch wenn die Ehemündigkeit eines Verlobten nach Art. 13 I EGBGB ausländischem Recht unterliegt, aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Die auf den ersten Blick freilich nicht leicht zu überblickende Regelung war Gegenstand des vorliegend besprochenen BGH-Beschlusses.
III. Die Entscheidung des BGH
Die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Ehe könnten gem. § 1314 I Nr. 1 BGB vorliegen. Danach kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn sie entgegen § 1303 S. 1 BGB mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatte. Jedoch könnte sich etwas anderes aus der Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 I S. 1 EGBGB ergeben, wonach die Neuregelung (d.h. § 1303 S. 1 und § 1314 I Nr. 1 BGB n.F.) für Ehen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung geschlossen worden sind, nicht anzuwenden ist. Die vorliegend zu beurteilende Ehe fällt in diese zeitliche Ebene. Allerdings greift die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 EGBGB nicht. So bezieht sich Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich auf eine Ehe, die mit einer Person geschlossen worden ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. F war zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits 16 Jahre alt. Zudem betrifft Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich Inlandsehen (s.o.). Art. 229 § 44 II EGBGB bezieht sich zwar auch auf § 1303 S. 1 BGB (und damit auf Ehen, bei denen einer der Eheschließenden das 16., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat), knüpft allerdings an den Umstand an, dass die Ehe unter Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. (das sind die oben genannten Fälle) geschlossen worden ist. Das impliziert zugleich, dass es sich zwingend um Inlandsehen handeln muss, denn hinsichtlich Auslandsehen konnte es keine Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. geben. Daher gilt in Bezug auf eine Ehe wie die vorliegend zu beurteilende, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die Regelung des § 1303 S. 1 BGB mit der Möglichkeit der Aufhebung nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das gilt auch für Ehen, die im Ausland geschlossen worden sind. Denn nach Art. 13 III Nr. 2 EGBGB ist die Ehe, auch wenn die Ehemündigkeit eines Verlobten nach Art. 13 I EGBGB ausländischem Recht unterliegt, aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte.
Der BGH greift bei Rn. 21-24 seines Beschlusses noch die Auffassung auf, die eine analoge Anwendung des (wie aufgezeigt nur für Inlandsehen geltenden) Art. 229 § 44 II EGBGB auf vor dem 22.7.2017 geschlossene Auslandsehen von Minderjährigen annimmt. Zu Recht folgt der BGH dieser Auffassung nicht. Der Gesetzgeber habe klar formuliert, dass die Regelung, die zur Aufhebbarkeit von Ehen getroffen wurde, die mit einer Person geschlossen worden sind, die bei Eheschließung das 16., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet hatte, auch für nach ausländischem Recht wirksam geschlossene Ehen gelten soll (Rn. 23 des Beschlusses mit Verweis auf BT-Drs. 18/12086 S. 1 f.; BR-Drs. 275/17 S. 1 f.). Für eine Analogie fehlt daher bereits die Planwidrigkeit einer etwaigen Regelungslücke.
Zwischenergebnis: Insoweit bleibt festzuhalten, dass die zwischen M und F geschlossene Ehe der Aufhebungsmöglichkeit des § 1314 I Nr. 1 BGB unterliegt.
Dem könnte allerdings der Ausschlussgrund des § 1315 I S. 1 Nr. 1 BGB entgegenstehen. Danach ist bei einem Verstoß gegen § 1303 S. 1 BGB eine Aufhebung der Ehe ausgeschlossen, wenn der minderjährige Ehegatte, nachdem er volljährig geworden ist, zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen will (Bestätigung), oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände die Aufhebung der Ehe eine so schwere Härte für den minderjährigen Ehegatten darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint.
F hat nicht zu erkennen gegeben, dass sie die Ehe fortsetzen will. Im Gegenteil, sie hat ausdrücklich zu verstehen gegeben, die Ehe nicht fortsetzen zu wollen. Außergewöhnliche Umstände, nach denen die Aufhebung der Ehe eine so schwere Härte für F darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Der Ausschlusstatbestand des § 1315 I S. 1 Nr. 1 BGB greift also nicht.
Mithin bleibt es also bei der Aufhebbarkeit nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das wirft aber die Frage auf, ob bei Vorliegen dieses (oder eines anderen) Aufhebungsgrundes die Ehe auch aufgehoben werden muss. Dagegen spricht der klare Wortlaut des § 1314 I Nr. 1 BGB, wo von „kann aufgehoben werden“ die Rede ist. Der Wortsinn dieser Formulierung deutet also auf ein Ermessen hin. Gleichwohl wird insbesondere in der Literatur die Auffassung vertreten, dass das Familiengericht bei Vorliegen eines Aufhebungsgrundes die Ehe auch aufheben muss (der BGH verweist bei Rn. 35 seines Beschlusses auf Coester-Waltjen, IPrax 2017, 429, 434; Erbarth, FamRB 2018, 296, 297; Löhnig, FamRZ 2018, 749, 750; Onwuagbaizu, NZFam 2019, 465, 467; Rauscher, NJW 2018, 3421, 3422). Das „kann“ in § 1314 BGB stelle die Aufhebung einer Ehe lediglich in den Machtbereich des Gerichts, nicht in dessen Ermessen (Hahn, in: BeckOK, § 1314 Rn. 1 (54. Edition, Stand: 1.5.2020) mit Verweis auf Löhnig, FamRZ 2018, 749. Auch bei Brudermüller, in: Palandt, 79. Aufl. 2020, § 1314 Rn. 1, heißt es: „ermöglichen soll“, was nicht auf ein Ermessen des Gerichts hindeutet.). Diese Auffassung versteht das Wort „kann“ also als „Kompetenz-Kann“, nicht als „Ermessens-Kann“. Der BGH ist dieser Auffassung entgegengetreten (Rn. 37 des Beschlusses). Er hat beschlossen, dass dem Familiengericht ein Ermessen bei der Entscheidung über die Aufhebung zusteht. Zwar sprächen die Erwägungen des Gesetzgebers in den Gesetzesmaterialien eher gegen die Annahme, dass § 1314 I Nr. 1 BGB dem Familiengericht bei einem Verstoß gegen das Ehemündigkeitsalter durch Eheschließung eines 16 oder 17 Jahre alten Minderjährigen bei der Aufhebungsentscheidung ein Ermessen einräume (Rn. 38 des Beschlusses mit Verweis auf den Willen des Gesetzgebers). Der Gesetzgeber führe aus, die Aufhebung habe „grundsätzlich immer zu erfolgen“ (BT-Drs. 18/12086 S. 2; BR-Drs. 275/17 S. 1) bzw. solle „den Regelfall darstellen“ (BT-Drs. 18/12086 S. 15; BR-Drs. 275/17 S. 15), gleichwohl spreche der Wortlaut des § 1314 BGB für die Einräumung eines Ermessens; anderenfalls hätte es „muss“ lauten müssen (Rn. 39 des Beschlusses). Die Verneinung eines gerichtlichen Ermessens würde in den Fällen der Eheaufhebung wegen Verstoßes gegen das Erfordernis der Ehemündigkeit zudem zur Verfassungswidrigkeit der Norm führen, weshalb sie verfassungskonform ausgelegt werden müsse (Rn. 42 ff. des Beschlusses). Denn eine – außer bei Vorliegen eines Aufhebungsausschlusses – zwingende Eheaufhebung würde eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung sowohl mit nach deutschem Recht geschlossenen Ehen als auch mit Auslandsehen darstellen, bei denen ein Ehegatte bei Eheschließung jünger als 16 Jahre gewesen sei (Rn. 46 des Beschlusses). Die Annahme einer zwingenden Eheaufhebung unter Ausschluss eines gerichtlichen Ermessens wäre zudem unvereinbar mit dem von Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 GG gebotenen Schutz des Kindeswohls (Rn. 47 des Beschlusses). Schließlich verstieße eine Auslegung, nach der § 1314 I Nr. 1 BGB dem Gericht bei Vorliegen des Eheaufhebungsgrundes kein Ermessen gewährt, auch gegen Art. 6 I GG unter dem Gesichtspunkt des aus Art. 20 III GG abgeleiteten Vertrauensschutzes (Rn. 48 des Beschlusses). Dem sei mit einer Gesetzesauslegung zu begegnen, nach der das Gericht von einer Eheaufhebung ausnahmsweise absehen könne, wenn feststehe, dass die Aufhebung in keiner Hinsicht unter Gesichtspunkten des Minderjährigenschutzes geboten sei, sondern vielmehr gewichtige Umstände gegen sie sprächen (Rn. 50 des Beschlusses). Im zu entscheidenden Fall führe diese Ermessensausübung zum Absehen von der Eheaufhebung. Umstände, die eine Eheaufhebung zum Schutz der bei Eheschließung fast 17-jährigen Ehefrau gebieten würden, lägen nicht vor. Vielmehr sei sie inzwischen 35 Jahre alt, habe die fast 14 Jahre des ehelichen Zusammenlebens mit dem Antragsgegner ausschließlich in Deutschland verbracht und nach Erreichen der Volljährigkeit mit diesem zusammen vier eheliche Kinder gezeugt. Eine Eheaufhebung würde mithin in krassem Gegensatz zu der langjährig bewusst im Erwachsenenalter gelebten Familienwirklichkeit stehen. Soweit die Ehefrau die Aufhebung der langjährig gelebten Ehe wünsche, führe dies zu keinem anderen Ergebnis der Ermessensausübung, weil die Ehefrau über die Aufhebung der Ehe nicht disponieren könne. Vielmehr stehe ihr insoweit die Scheidung der Ehe offen (Rn. 52 des Beschlusses).
Stellungnahme: Der BGH begründet seine Auffassung ausführlich und zeigt auf, warum nicht nur das Wortlautargument für die Annahme einer gerichtlichen Ermessensentscheidung spricht, sondern auch eine verfassungskonforme Auslegung zu diesem Ergebnis zwingt. Zwar hat der Gesetzgeber bereits mit § 1315 I Nr. 1 BGB Ausschlussgründe formuliert, dabei aber nicht die Kindeswohlinteressen berücksichtigt, die einer Eheauflösung entgegenstehen könnten. Und auch für die Frau, die sich aus der Ehe lösen möchte, könnte die Aufhebung, über die sie ja nicht disponieren kann, unzumutbare Folgen bewirken, denn das nacheheliche Unterhaltsrecht, der Versorgungsausgleich und der Zugewinnausgleich knüpfen an die Scheidung an. § 1318 BGB ordnet zwar die Geltung der meisten, aber nicht aller Scheidungsfolgenrechte an. Der BGH-Beschluss führt also richtigerweise dazu, dass trotz Vorliegens eines Aufhebungsgrundes (§ 1314 BGB) und Nichtvorliegens eines Ausschlussgrundes (§ 1315 BGB) die Aufhebung nicht die zwingende Rechtsfolge ist. Vielmehr ist dem Gericht ein Ermessen einzuräumen, um den Grundrechten der Beteiligten auf Rechtsfolgenseite hinreichend Rechnung tragen zu können. Daher kann das Familiengericht etwa auch die Aufhebung der Ehe versagen, wenn sie mit Kindeswohlinteressen nicht vereinbar wäre.
Rolf Schmidt (17.08.2020)
Die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Ehe könnten gem. § 1314 I Nr. 1 BGB vorliegen. Danach kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn sie entgegen § 1303 S. 1 BGB mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatte. Jedoch könnte sich etwas anderes aus der Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 I S. 1 EGBGB ergeben, wonach die Neuregelung (d.h. § 1303 S. 1 und § 1314 I Nr. 1 BGB n.F.) für Ehen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung geschlossen worden sind, nicht anzuwenden ist. Die vorliegend zu beurteilende Ehe fällt in diese zeitliche Ebene. Allerdings greift die Überleitungsvorschrift des Art. 229 § 44 EGBGB nicht. So bezieht sich Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich auf eine Ehe, die mit einer Person geschlossen worden ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. F war zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits 16 Jahre alt. Zudem betrifft Art. 229 § 44 I EGBGB lediglich Inlandsehen (s.o.). Art. 229 § 44 II EGBGB bezieht sich zwar auch auf § 1303 S. 1 BGB (und damit auf Ehen, bei denen einer der Eheschließenden das 16., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat), knüpft allerdings an den Umstand an, dass die Ehe unter Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. (das sind die oben genannten Fälle) geschlossen worden ist. Das impliziert zugleich, dass es sich zwingend um Inlandsehen handeln muss, denn hinsichtlich Auslandsehen konnte es keine Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit nach § 1303 II-IV BGB a.F. geben. Daher gilt in Bezug auf eine Ehe wie die vorliegend zu beurteilende, die mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die Regelung des § 1303 S. 1 BGB mit der Möglichkeit der Aufhebung nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das gilt auch für Ehen, die im Ausland geschlossen worden sind. Denn nach Art. 13 III Nr. 2 EGBGB ist die Ehe, auch wenn die Ehemündigkeit eines Verlobten nach Art. 13 I EGBGB ausländischem Recht unterliegt, aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte.
Der BGH greift bei Rn. 21-24 seines Beschlusses noch die Auffassung auf, die eine analoge Anwendung des (wie aufgezeigt nur für Inlandsehen geltenden) Art. 229 § 44 II EGBGB auf vor dem 22.7.2017 geschlossene Auslandsehen von Minderjährigen annimmt. Zu Recht folgt der BGH dieser Auffassung nicht. Der Gesetzgeber habe klar formuliert, dass die Regelung, die zur Aufhebbarkeit von Ehen getroffen wurde, die mit einer Person geschlossen worden sind, die bei Eheschließung das 16., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet hatte, auch für nach ausländischem Recht wirksam geschlossene Ehen gelten soll (Rn. 23 des Beschlusses mit Verweis auf BT-Drs. 18/12086 S. 1 f.; BR-Drs. 275/17 S. 1 f.). Für eine Analogie fehlt daher bereits die Planwidrigkeit einer etwaigen Regelungslücke.
Zwischenergebnis: Insoweit bleibt festzuhalten, dass die zwischen M und F geschlossene Ehe der Aufhebungsmöglichkeit des § 1314 I Nr. 1 BGB unterliegt.
Dem könnte allerdings der Ausschlussgrund des § 1315 I S. 1 Nr. 1 BGB entgegenstehen. Danach ist bei einem Verstoß gegen § 1303 S. 1 BGB eine Aufhebung der Ehe ausgeschlossen, wenn der minderjährige Ehegatte, nachdem er volljährig geworden ist, zu erkennen gegeben hat, dass er die Ehe fortsetzen will (Bestätigung), oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände die Aufhebung der Ehe eine so schwere Härte für den minderjährigen Ehegatten darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint.
F hat nicht zu erkennen gegeben, dass sie die Ehe fortsetzen will. Im Gegenteil, sie hat ausdrücklich zu verstehen gegeben, die Ehe nicht fortsetzen zu wollen. Außergewöhnliche Umstände, nach denen die Aufhebung der Ehe eine so schwere Härte für F darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Der Ausschlusstatbestand des § 1315 I S. 1 Nr. 1 BGB greift also nicht.
Mithin bleibt es also bei der Aufhebbarkeit nach § 1314 I Nr. 1 BGB. Das wirft aber die Frage auf, ob bei Vorliegen dieses (oder eines anderen) Aufhebungsgrundes die Ehe auch aufgehoben werden muss. Dagegen spricht der klare Wortlaut des § 1314 I Nr. 1 BGB, wo von „kann aufgehoben werden“ die Rede ist. Der Wortsinn dieser Formulierung deutet also auf ein Ermessen hin. Gleichwohl wird insbesondere in der Literatur die Auffassung vertreten, dass das Familiengericht bei Vorliegen eines Aufhebungsgrundes die Ehe auch aufheben muss (der BGH verweist bei Rn. 35 seines Beschlusses auf Coester-Waltjen, IPrax 2017, 429, 434; Erbarth, FamRB 2018, 296, 297; Löhnig, FamRZ 2018, 749, 750; Onwuagbaizu, NZFam 2019, 465, 467; Rauscher, NJW 2018, 3421, 3422). Das „kann“ in § 1314 BGB stelle die Aufhebung einer Ehe lediglich in den Machtbereich des Gerichts, nicht in dessen Ermessen (Hahn, in: BeckOK, § 1314 Rn. 1 (54. Edition, Stand: 1.5.2020) mit Verweis auf Löhnig, FamRZ 2018, 749. Auch bei Brudermüller, in: Palandt, 79. Aufl. 2020, § 1314 Rn. 1, heißt es: „ermöglichen soll“, was nicht auf ein Ermessen des Gerichts hindeutet.). Diese Auffassung versteht das Wort „kann“ also als „Kompetenz-Kann“, nicht als „Ermessens-Kann“. Der BGH ist dieser Auffassung entgegengetreten (Rn. 37 des Beschlusses). Er hat beschlossen, dass dem Familiengericht ein Ermessen bei der Entscheidung über die Aufhebung zusteht. Zwar sprächen die Erwägungen des Gesetzgebers in den Gesetzesmaterialien eher gegen die Annahme, dass § 1314 I Nr. 1 BGB dem Familiengericht bei einem Verstoß gegen das Ehemündigkeitsalter durch Eheschließung eines 16 oder 17 Jahre alten Minderjährigen bei der Aufhebungsentscheidung ein Ermessen einräume (Rn. 38 des Beschlusses mit Verweis auf den Willen des Gesetzgebers). Der Gesetzgeber führe aus, die Aufhebung habe „grundsätzlich immer zu erfolgen“ (BT-Drs. 18/12086 S. 2; BR-Drs. 275/17 S. 1) bzw. solle „den Regelfall darstellen“ (BT-Drs. 18/12086 S. 15; BR-Drs. 275/17 S. 15), gleichwohl spreche der Wortlaut des § 1314 BGB für die Einräumung eines Ermessens; anderenfalls hätte es „muss“ lauten müssen (Rn. 39 des Beschlusses). Die Verneinung eines gerichtlichen Ermessens würde in den Fällen der Eheaufhebung wegen Verstoßes gegen das Erfordernis der Ehemündigkeit zudem zur Verfassungswidrigkeit der Norm führen, weshalb sie verfassungskonform ausgelegt werden müsse (Rn. 42 ff. des Beschlusses). Denn eine – außer bei Vorliegen eines Aufhebungsausschlusses – zwingende Eheaufhebung würde eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung sowohl mit nach deutschem Recht geschlossenen Ehen als auch mit Auslandsehen darstellen, bei denen ein Ehegatte bei Eheschließung jünger als 16 Jahre gewesen sei (Rn. 46 des Beschlusses). Die Annahme einer zwingenden Eheaufhebung unter Ausschluss eines gerichtlichen Ermessens wäre zudem unvereinbar mit dem von Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 GG gebotenen Schutz des Kindeswohls (Rn. 47 des Beschlusses). Schließlich verstieße eine Auslegung, nach der § 1314 I Nr. 1 BGB dem Gericht bei Vorliegen des Eheaufhebungsgrundes kein Ermessen gewährt, auch gegen Art. 6 I GG unter dem Gesichtspunkt des aus Art. 20 III GG abgeleiteten Vertrauensschutzes (Rn. 48 des Beschlusses). Dem sei mit einer Gesetzesauslegung zu begegnen, nach der das Gericht von einer Eheaufhebung ausnahmsweise absehen könne, wenn feststehe, dass die Aufhebung in keiner Hinsicht unter Gesichtspunkten des Minderjährigenschutzes geboten sei, sondern vielmehr gewichtige Umstände gegen sie sprächen (Rn. 50 des Beschlusses). Im zu entscheidenden Fall führe diese Ermessensausübung zum Absehen von der Eheaufhebung. Umstände, die eine Eheaufhebung zum Schutz der bei Eheschließung fast 17-jährigen Ehefrau gebieten würden, lägen nicht vor. Vielmehr sei sie inzwischen 35 Jahre alt, habe die fast 14 Jahre des ehelichen Zusammenlebens mit dem Antragsgegner ausschließlich in Deutschland verbracht und nach Erreichen der Volljährigkeit mit diesem zusammen vier eheliche Kinder gezeugt. Eine Eheaufhebung würde mithin in krassem Gegensatz zu der langjährig bewusst im Erwachsenenalter gelebten Familienwirklichkeit stehen. Soweit die Ehefrau die Aufhebung der langjährig gelebten Ehe wünsche, führe dies zu keinem anderen Ergebnis der Ermessensausübung, weil die Ehefrau über die Aufhebung der Ehe nicht disponieren könne. Vielmehr stehe ihr insoweit die Scheidung der Ehe offen (Rn. 52 des Beschlusses).
Stellungnahme: Der BGH begründet seine Auffassung ausführlich und zeigt auf, warum nicht nur das Wortlautargument für die Annahme einer gerichtlichen Ermessensentscheidung spricht, sondern auch eine verfassungskonforme Auslegung zu diesem Ergebnis zwingt. Zwar hat der Gesetzgeber bereits mit § 1315 I Nr. 1 BGB Ausschlussgründe formuliert, dabei aber nicht die Kindeswohlinteressen berücksichtigt, die einer Eheauflösung entgegenstehen könnten. Und auch für die Frau, die sich aus der Ehe lösen möchte, könnte die Aufhebung, über die sie ja nicht disponieren kann, unzumutbare Folgen bewirken, denn das nacheheliche Unterhaltsrecht, der Versorgungsausgleich und der Zugewinnausgleich knüpfen an die Scheidung an. § 1318 BGB ordnet zwar die Geltung der meisten, aber nicht aller Scheidungsfolgenrechte an. Der BGH-Beschluss führt also richtigerweise dazu, dass trotz Vorliegens eines Aufhebungsgrundes (§ 1314 BGB) und Nichtvorliegens eines Ausschlussgrundes (§ 1315 BGB) die Aufhebung nicht die zwingende Rechtsfolge ist. Vielmehr ist dem Gericht ein Ermessen einzuräumen, um den Grundrechten der Beteiligten auf Rechtsfolgenseite hinreichend Rechnung tragen zu können. Daher kann das Familiengericht etwa auch die Aufhebung der Ehe versagen, wenn sie mit Kindeswohlinteressen nicht vereinbar wäre.
Rolf Schmidt (17.08.2020)
14.08.2020: Zur Strafbarbeit des sog. Stealthing
KG, Beschl. v. 27.07.2020 – 4 Ss 58/20; 161 Ss 48/20
Mit Beschluss v. 27.7.2020 (4 Ss 58/20) hat das Kammergericht (so lautet die Bezeichnung des Oberlandesgerichts Berlin) entschieden, dass das sog. Stealthing (also das heimliche Abstreifen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr) jedenfalls dann den Tatbestand des sexuellen Übergriffs gem. § 177 I StGB erfüllt, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriert, sondern im weiteren Verlauf dieses ungeschützten Geschlechtsverkehrs darüber hinaus in den Körper des bzw. der Geschädigten ejakuliert. Auch liege unter diesen Voraussetzungen das Regelbeispiel des § 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB (Vergewaltigung) vor. Ob das auch gilt, wenn es nicht zu einer Ejakulation gekommen wäre, und ob die Entscheidung generell überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Zwischen dem zum Tatzeitpunkt 36 Jahre alten Täter (einem Bundespolizisten) und dem zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alten Opfer (einer Polizeianwärterin, welche er zuvor auf einer Internetplattform kennengelernt hatte), kam es bei einem Treffen zunächst einvernehmlich zu sexuellen Handlungen. Vor dem eigentlichen Geschlechtsverkehr hatte das spätere Opfer jedoch mehrfach deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie auf keinen Fall Geschlechtsverkehr ohne Kondom haben wolle. Daraufhin zog der spätere Täter vor dem Eindringen ein Kondom über seinen Penis. Während des Geschlechtsakts hat der Täter dann jedoch das Kondom im Zuge eines Stellungwechsels heimlich abgestreift und anschließend in die Vagina der Geschädigten ejakuliert.
II. Rechtliche Ausgangslage
Als Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung werden die im 13. Abschnitt des StGB genannten Straftatbestände der §§ 174 bis 184j bezeichnet. Bei diesen geht es um die strafrechtliche Sanktionierung von unterschiedlichen Verhaltensweisen, die unterschiedliche Rechtsgüter verletzen. Allen gemeinsam ist der Sexualbezug der Tathandlungen. Es steht die sexuelle Handlung im Mittelpunkt der Strafnormen. Diese liegt gemäß der Legaldefinition des § 184h Nr. 1 StGB vor, wenn die Handlung im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist. Als erheblich in diesem Sinne sind nach dem BGH solche sexualbezogenen Handlungen zu werten, die nach Art, Intensität und Dauer eine sozial nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des im jeweiligen Tatbestand geschützten Rechtsguts bedeuten. Dazu bedürfe es einer Gesamtbetrachtung aller Umstände im Hinblick auf die Gefährlichkeit der Handlung für das jeweils betroffene Rechtsgut (BGH NStZ 2018, 91, 92 m.w.Nachw. aus der Rspr. des BGH).
KG, Beschl. v. 27.07.2020 – 4 Ss 58/20; 161 Ss 48/20
Mit Beschluss v. 27.7.2020 (4 Ss 58/20) hat das Kammergericht (so lautet die Bezeichnung des Oberlandesgerichts Berlin) entschieden, dass das sog. Stealthing (also das heimliche Abstreifen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr) jedenfalls dann den Tatbestand des sexuellen Übergriffs gem. § 177 I StGB erfüllt, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriert, sondern im weiteren Verlauf dieses ungeschützten Geschlechtsverkehrs darüber hinaus in den Körper des bzw. der Geschädigten ejakuliert. Auch liege unter diesen Voraussetzungen das Regelbeispiel des § 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB (Vergewaltigung) vor. Ob das auch gilt, wenn es nicht zu einer Ejakulation gekommen wäre, und ob die Entscheidung generell überzeugt, soll im Folgenden – anhand einer systematischen Aufbereitung – untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
Zwischen dem zum Tatzeitpunkt 36 Jahre alten Täter (einem Bundespolizisten) und dem zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alten Opfer (einer Polizeianwärterin, welche er zuvor auf einer Internetplattform kennengelernt hatte), kam es bei einem Treffen zunächst einvernehmlich zu sexuellen Handlungen. Vor dem eigentlichen Geschlechtsverkehr hatte das spätere Opfer jedoch mehrfach deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie auf keinen Fall Geschlechtsverkehr ohne Kondom haben wolle. Daraufhin zog der spätere Täter vor dem Eindringen ein Kondom über seinen Penis. Während des Geschlechtsakts hat der Täter dann jedoch das Kondom im Zuge eines Stellungwechsels heimlich abgestreift und anschließend in die Vagina der Geschädigten ejakuliert.
II. Rechtliche Ausgangslage
Als Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung werden die im 13. Abschnitt des StGB genannten Straftatbestände der §§ 174 bis 184j bezeichnet. Bei diesen geht es um die strafrechtliche Sanktionierung von unterschiedlichen Verhaltensweisen, die unterschiedliche Rechtsgüter verletzen. Allen gemeinsam ist der Sexualbezug der Tathandlungen. Es steht die sexuelle Handlung im Mittelpunkt der Strafnormen. Diese liegt gemäß der Legaldefinition des § 184h Nr. 1 StGB vor, wenn die Handlung im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist. Als erheblich in diesem Sinne sind nach dem BGH solche sexualbezogenen Handlungen zu werten, die nach Art, Intensität und Dauer eine sozial nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des im jeweiligen Tatbestand geschützten Rechtsguts bedeuten. Dazu bedürfe es einer Gesamtbetrachtung aller Umstände im Hinblick auf die Gefährlichkeit der Handlung für das jeweils betroffene Rechtsgut (BGH NStZ 2018, 91, 92 m.w.Nachw. aus der Rspr. des BGH).
1. Sexueller Übergriff (§ 177 I StGB)
Den Grundtatbestand innerhalb der Strafnorm des § 177 StGB bildet § 177 I StGB. Danach macht sich strafbar, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt. Schutzgut der Vorschrift ist nach allgemeiner Auffassung die sexuelle Selbstbestimmung. Darunter ist die Freiheit zu verstehen, über Zeitpunkt, Art, Form und Partner sexueller Betätigung selbst zu entscheiden (KG 27.7.2020 – 4 Ss 58/20). Die Strafandrohung liegt bei sechs Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe), ist gem. § 12 II StGB also ein Vergehen.
Maßgebliches Tatbestandsmerkmal ist der erkennbare entgegenstehende Wille des Opfers. Ein sexuellen Handlungen entgegenstehender Wille liegt vor, wenn die betroffene Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen nicht bereit ist, wenn also die Freiwilligkeit nicht vorliegt. Der innerlich gebildete entgegenstehende Wille muss (aus der Sicht eines objektiven Dritten) auch erkennbar sein. „Erkennbar“ soll nach Auffassung des Gesetzgebers der entgegenstehende Wille sein, wenn das Opfer ihn zum Tatzeitpunkt entweder ausdrücklich (verbal) erklärt oder zumindest konkludent (etwa durch Weinen oder Abwehren der sexuellen Handlung) zum Ausdruck bringt (BT-Drs. 18/9097, S. 22 f.; siehe auch BGH NStZ 2019, 516, 517). Damit folgt der Gesetzgeber der sog. „Nein-heißt-nein-Lösung“.
2. Ausnutzen besonderer Umstände; sexuelle Nötigung (§ 177 II StGB)
Gemäß § 177 II StGB wird ebenso bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt. Diese Vorschrift, die eine Erkennbarkeit des entgegenstehenden Willens nicht voraussetzt, erfasst nach dem Willen des Gesetzgebers Konstellationen, in denen (1) dem Opfer das Erklären eines entgegenstehenden Willens entweder nicht zumutbar ist, sodass selbst eine geäußerte Zustimmung nicht tragfähig wäre, oder (2) ihm das Erklären eines entgegenstehenden Willens objektiv nicht möglich ist (vgl. BT-Drs. 18/9097, S. 23). Hinzukommen muss aber die Verwirklichung eine der in der Vorschrift genannten Nummern.
Den Grundtatbestand innerhalb der Strafnorm des § 177 StGB bildet § 177 I StGB. Danach macht sich strafbar, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt. Schutzgut der Vorschrift ist nach allgemeiner Auffassung die sexuelle Selbstbestimmung. Darunter ist die Freiheit zu verstehen, über Zeitpunkt, Art, Form und Partner sexueller Betätigung selbst zu entscheiden (KG 27.7.2020 – 4 Ss 58/20). Die Strafandrohung liegt bei sechs Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe), ist gem. § 12 II StGB also ein Vergehen.
Maßgebliches Tatbestandsmerkmal ist der erkennbare entgegenstehende Wille des Opfers. Ein sexuellen Handlungen entgegenstehender Wille liegt vor, wenn die betroffene Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen nicht bereit ist, wenn also die Freiwilligkeit nicht vorliegt. Der innerlich gebildete entgegenstehende Wille muss (aus der Sicht eines objektiven Dritten) auch erkennbar sein. „Erkennbar“ soll nach Auffassung des Gesetzgebers der entgegenstehende Wille sein, wenn das Opfer ihn zum Tatzeitpunkt entweder ausdrücklich (verbal) erklärt oder zumindest konkludent (etwa durch Weinen oder Abwehren der sexuellen Handlung) zum Ausdruck bringt (BT-Drs. 18/9097, S. 22 f.; siehe auch BGH NStZ 2019, 516, 517). Damit folgt der Gesetzgeber der sog. „Nein-heißt-nein-Lösung“.
2. Ausnutzen besonderer Umstände; sexuelle Nötigung (§ 177 II StGB)
Gemäß § 177 II StGB wird ebenso bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt. Diese Vorschrift, die eine Erkennbarkeit des entgegenstehenden Willens nicht voraussetzt, erfasst nach dem Willen des Gesetzgebers Konstellationen, in denen (1) dem Opfer das Erklären eines entgegenstehenden Willens entweder nicht zumutbar ist, sodass selbst eine geäußerte Zustimmung nicht tragfähig wäre, oder (2) ihm das Erklären eines entgegenstehenden Willens objektiv nicht möglich ist (vgl. BT-Drs. 18/9097, S. 23). Hinzukommen muss aber die Verwirklichung eine der in der Vorschrift genannten Nummern.
3. Strafbarkeit des Versuchs (§ 177 III StGB)
§ 177 III StGB ordnet die Strafbarkeit des Versuchs an und bezieht sich systematisch auf die Tatbestände der Absätze I und II des § 177 StGB. Bei diesen Tatbeständen handelt es sich um Vergehen gem. § 12 II StGB, da die Mindeststrafe unter einem Jahr Freiheitsstrafe liegt. Da nur der Versuch eines Verbrechens, also gem. § 12 I StGB einer rechtswidrigen Tat, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist, stets strafbar ist und der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich anordnet (siehe § 23 I StGB), bedurfte es einer Strafbarkeitsandrohung, die der Gesetzgeber mit § 177 III StGB vorgenommen hat. Freilich sind damit nicht die Probleme gelöst, die sich bei einem Vergewaltigungsversuch ergeben können, siehe hierzu Punkt 6a.
§ 177 III StGB ordnet die Strafbarkeit des Versuchs an und bezieht sich systematisch auf die Tatbestände der Absätze I und II des § 177 StGB. Bei diesen Tatbeständen handelt es sich um Vergehen gem. § 12 II StGB, da die Mindeststrafe unter einem Jahr Freiheitsstrafe liegt. Da nur der Versuch eines Verbrechens, also gem. § 12 I StGB einer rechtswidrigen Tat, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist, stets strafbar ist und der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich anordnet (siehe § 23 I StGB), bedurfte es einer Strafbarkeitsandrohung, die der Gesetzgeber mit § 177 III StGB vorgenommen hat. Freilich sind damit nicht die Probleme gelöst, die sich bei einem Vergewaltigungsversuch ergeben können, siehe hierzu Punkt 6a.
4. Sexueller Missbrauch kranker oder behinderter Menschen (§ 177 IV StGB)
§ 177 IV StGB qualifiziert die Tat (nach § 177 I StGB oder § 177 II StGB) zu einem Verbrechen und ist verwirklicht, wenn die Unfähigkeit des Opfers, einen Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung beruht. Vorausgesetzt wird also eine Krankheit oder Behinderung, die die Willensbildung oder -äußerung ausschließt. Zur Definition des Begriffs „Behinderung“ stellt der Gesetzgeber auf § 2 I S. 1 SGB IX ab, wonach eine Behinderung gegeben ist, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit und/oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe des Betroffenen am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Hinsichtlich des Begriffs „Krankheit“ verweist der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung der Sozialgerichte, wonach Krankheit als ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand definiert wird, der Behandlungsbedürftigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge habe (BT-Drs. 18/9097, S. 26). Verwirklicht ist § 177 IV StGB, wenn der Täter an einem kranken oder behinderten Menschen eine Tathandlung i.S.d. § 177 I oder § 177 II StGB begeht. Das Mindesttrafmaß des § 177 IV StGB liegt bei einem Jahr Freiheitsstrafe. Wegen § 38 II StGB liegt das Höchstmaß bei 15 Jahren.
5. Sexuelle Nötigung; Ausnutzung von Schutzlosigkeit (§ 177 V StGB)
Ebenfalls eine Tatbestandsqualifikation mit der Einstufung als Verbrechen normiert § 177 V StGB, wenn der Täter mindestens eine der in der Vorschrift genannten Handlungen vornimmt. So erfasst Nr. 1 den Fall, dass der Täter Gewalt anwendet. Erforderlich ist eine gegen den Körper gerichtete Kraftentfaltung zur Überwindung eines Widerstands. Dazu zählen bspw. das Festhalten des Opfers, dessen Fesselung oder Betäubung (etwa mit K.-o.-Tropfen). Nr. 2 sanktioniert den Fall, dass der Täter dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht und nach Nr. 3 macht sich der Täter schließlich strafbar, wenn er eine Lage ausnutzt, in der das Opfer seiner Einwirkung schutzlos ausgeliefert ist, was etwa der Fall ist, wenn der Täter das Opfer zunächst einsperrt und dann aufgrund eines neuen Tatentschlusses sexuell missbraucht. Das Mindesttrafmaß des § 177 V StGB liegt (wie das des § 177 IV StGB) bei einem Jahr Freiheitsstrafe. Wegen § 38 II StGB liegt das Höchstmaß ebenfalls bei 15 Jahren.
6. Besonders schwere Fälle (§ 177 VI StGB)
a. Rechtsnatur des § 177 VI StGB als Strafzumessungsvorschrift
Bei § 177 VI StGB handelt es nicht um einen Tatbestand, sondern um eine sog. Strafzumessungsvorschrift mit zwei Regelbeispielen besonders schwerer Fälle:
Bei § 177 VI StGB handelt es nicht um einen Tatbestand, sondern um eine sog. Strafzumessungsvorschrift mit zwei Regelbeispielen besonders schwerer Fälle:
- Der Täter vergewaltigt das Opfer (Nr. 1)
- Die Tat wird von mehreren gemeinschaftlich begangen (Nr. 2)
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Begriff des „besonders schweren Falls“ um einen höchst unbestimmten Rechtsbegriff (Gesetzesbegriff) handelt. Um daher dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot (Art. 103 II GG), das nicht nur für Straftatbestände, sondern selbstverständlich auch für die Vorschriften über besonders schwere Fälle gilt, gerecht zu werden, hat der Gesetzgeber in den meisten Vorschriften über besonders schwere Fälle (so auch bei § 177 VI StGB) Regelbeispiele genannt, die eine widerlegliche Vermutung für das Vorliegen eines besonders schweren Falls aussprechen. Die Verwirklichung eines Regelbeispiels hat also Indizwirkung zur Annahme eines besonders schweren Falls: Bei Vorliegen eines Regelbeispiels besteht eine widerlegliche Vermutung dafür, dass die Tat insgesamt als besonders schwer einzustufen ist und damit der in der Vorschrift genannte strengere Strafrahmen Anwendung findet. Bestehen also keine Anhaltspunkte, die den erhöhten Unrechts- und Schuldgehalt kompensieren, ist der Täter – in Bezug auf § 177 StGB – aus dem im Vergleich zu § 177 I oder II StGB höheren Strafrahmen des § 177 VI S. 1 StGB (2-15 Jahre Freiheitsstrafe) zu bestrafen.
Diese Vorgehensweise ist nicht zufällig, sondern hat mit Blick auf § 12 III StGB und § 22 StGB ganz bestimmte Auswirkungen:
- Zunächst bleibt die Tat wegen § 12 III StGB ein Vergehen, wenn es sich bei dem Grunddelikt um ein Vergehen handelt. In Bezug auf die Vergewaltigung bedeutet das: Handelt es sich bei der Grundtat lediglich um einen sexuellen Übergriff gem. § 177 I StGB bzw. eine sexuelle Nötigung gem. § 177 II StGB (der Täter hat also nicht noch einen der Verbrechenstatbestände des § 177 IV, V, VII oder VIII StGB verwirklicht), bleibt auch die Vergewaltigung trotz der angedrohten Mindeststrafe von zwei Jahren ein Vergehen i.S.d. § 12 II StGB.
oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, für die Einteilung in Verbrechen und Vergehen außer Betracht (s.o.). So bleibt der
sexuelle Übergriff i.S.d. § 177 I StGB auch dann ein Vergehen i.S.d. § 12 II StGB, wenn ein besonders schwerer Fall gem. § 177 VI S. 2
Nr. 1 StGB (Vergewaltigung) vorliegt.
- Auf den ersten Blick hat das zwar keine Auswirkungen auf die Versuchsstrafbarkeit, da § 177 III StGB die Strafbarkeit des Versuchs des § 177 I bzw. II StGB anordnet. Jedoch ist gesetzessystematisch – wie sich aus § 22 StGB ergibt – ein Versuch lediglich bei Tatbeständen denkbar, nicht auch bei Strafzumessungsvorschriften wie § 177 VI StGB. Jedoch ist zumindest in einigen Konstellationen anerkannt, die straferhöhende Wirkung des Regelbeispiels bei der Versuchsstrafbarkeit zu berücksichtigen. Es lassen sich drei Konstellationen unterscheiden:
- Grundtatbestand erfüllt – Regelbeispiel „versucht“
- Grundtatbestand versucht – Regelbeispiel „versucht“
- Grundtatbestand versucht – Regelbeispiel erfüllt
In der zweiten Konstellation stellt sich die gleiche Frage, nämlich, ob das gewollte, aber nicht verwirklichte Regelbeispiel zur Annahme eines Versuchs in einem besonders schweren Fall führen kann. Folgt man der aus gesetzessystematischer Sicht allein richtigen Auffassung, ist ein Täter, der einen der Tatbestände des § 177 I oder II StGB versucht, um das Opfer zu vergewaltigen, nicht aus §§ 177 I oder II, 22, 23 I, 12 II i.V.m. § 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB strafbar, sondern (lediglich) aus §§ 177 I oder II, 22, 23 I, 12 II StGB. Freilich ist auch hier denkbar, aufgrund einer Gesamtbewertung der Tat einen unbenannten besonders schweren Fall (§§ 177 I oder II, 22, 23 I, 12 II i.V.m. § 177 VI S. 1 StGB) anzunehmen. Das Wort „Vergewaltigungsversuch“ findet sich aber auch hier nicht im Urteilstenor wieder, weswegen erneut deutlich wird, dass die Einstufung der Vergewaltigung als Regelbeispiel dem Opferschutz nicht gerecht wird.
Die dritte Konstellation ist im Rahmen einer Vergewaltigung nicht vorstellbar. Denn es müsste ja ein Fall vorliegen, in dem der Täter keinen der Tatbestände des § 177 I oder II StGB objektiv erfüllt, gleichwohl aber das Opfer vergewaltigt.
Die Strafandrohung von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gesetzgeber leider auch in der jüngsten Gesetzesreform 2017 offenbar nach wie vor keine Veranlassung gesehen hat, die Vergewaltigung als Tatbestandsqualifikation einzustufen. Der Vergewaltigung und der gemeinschaftlichen Tatausübung lediglich mit Strafzumessungsvorschriften (und nicht mit eigenen Tatbeständen) zu begegnen, wird – wie aus den obigen Ausführungen deutlich geworden sein sollte – weder dem Unrechtsgehalt noch dem Opferschutz gerecht. Davon abgesehen gilt aber:
a. Vergewaltigung
§ 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB erfasst die Vergewaltigung, die gemäß der in der Vorschrift formulierten Legaldefinition vorliegt, wenn der Täter (nach § 177 I oder § 177 II StGB), ggf. unter Verwirklichung einer Qualifikation nach § 177 IV, V, VII oder VIII StGB) mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper (also mit einer Penetration) verbunden sind.
Die dritte Konstellation ist im Rahmen einer Vergewaltigung nicht vorstellbar. Denn es müsste ja ein Fall vorliegen, in dem der Täter keinen der Tatbestände des § 177 I oder II StGB objektiv erfüllt, gleichwohl aber das Opfer vergewaltigt.
- Schließlich kann der nach ganz h.M. für Strafzumessungsvorschriften geltende Aufbaugrundsatz, dass sie zwingend nach der Schuld des Grunddelikts zu prüfen sind, misslich sein, wenn der Täter bspw. schuldunfähig ist. Denn dann kann insbesondere der Erschwernisgrund der Vergewaltigung nicht mehr geprüft werden.
Die Strafandrohung von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gesetzgeber leider auch in der jüngsten Gesetzesreform 2017 offenbar nach wie vor keine Veranlassung gesehen hat, die Vergewaltigung als Tatbestandsqualifikation einzustufen. Der Vergewaltigung und der gemeinschaftlichen Tatausübung lediglich mit Strafzumessungsvorschriften (und nicht mit eigenen Tatbeständen) zu begegnen, wird – wie aus den obigen Ausführungen deutlich geworden sein sollte – weder dem Unrechtsgehalt noch dem Opferschutz gerecht. Davon abgesehen gilt aber:
a. Vergewaltigung
§ 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB erfasst die Vergewaltigung, die gemäß der in der Vorschrift formulierten Legaldefinition vorliegt, wenn der Täter (nach § 177 I oder § 177 II StGB), ggf. unter Verwirklichung einer Qualifikation nach § 177 IV, V, VII oder VIII StGB) mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper (also mit einer Penetration) verbunden sind.
- Unter Beischlaf ist das Eindringen des Gliedes in die Scheide zu verstehen. Eindringen anderer Körperteile in die Scheide und das Eindringen des Gliedes in andere Körperöffnungen sind zwar ebenfalls Formen der Penetration, aber keine des Beischlafs; sie stellen aber ähnliche sexuelle Handlungen dar, wozu gerade das Einführen des Gliedes in Mund oder Anus (siehe dazu auch BGH NStZ 2019, 516, 517 - Versuch der Analpenetration), das Einführen anderer Körperglieder (wie z.B. Finger) in Scheide, Mund oder Anus und das Einführen körperfremder Gegenstände in Scheide, Mund oder Anus zählen.
- Eine besondere Erniedrigung
liegt vor, wenn das Opfer in gravierender, über die Verwirklichung der Tatbestände des § 177 I oder II hinausgehender Weise zum bloßen Objekt sexueller Willkür des Täters herabgewürdigt wird und dies gerade in der Art und Ausführung der sexuellen Handlung zum Ausdruck kommt (vgl. Fischer, § 177 Rn 150). Ein Eindringen in den Körper stellt gemäß der gesetzlichen Formulierung (siehe § 177 VI S. 2 Nr. 1 a.E. StGB) stets eine besondere Erniedrigung dar. Das Einführen des Gliedes in Mund oder Anus, das Einführen anderer Körperglieder in Scheide, Mund oder Anus und das Einführen körperfremder Gegenstände in Scheide, Mund oder Anus erfüllen dieses Kriterium regelmäßig.
Das Regelbeispiel der Nr. 2 verlangt, dass die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird, was im vorliegenden Zusammenhang jedoch keine Rolle spielt.
III. Zum Ausgangsfall
Das im Sachverhalt beschriebene, als Stealthing bezeichnete Phänomen dürfte, da der ungeschützte Geschlechtsverkehr nicht konsentiert war, jedenfalls den Straftatbestand des § 177 I StGB verwirklichen, da er der ungeschützte Geschlechtsverkehr dem erkennbaren Willen der O zuwiderlief. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass O das Stealthing (erst) später bemerkte. Denn zum Zeitpunkt des Beginns der Ausübung des Geschlechtsverkehrs ging sie davon aus, dass T ein Kondom benutzt. Das heimliche Abstreifen des Kondoms verletzte O in ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht (So bereits R. Schmidt, StrafR BT I, 21. Aufl. 2019, Rn. 567f; vgl. später auch die vorliegend besprochene Entscheidung KG 27.7.2020 – 4 Ss 58/20). Denn sie machte die Zustimmung zum Geschlechtsverkehr von der Benutzung eines Kondoms abhängig. Irrelevant ist daher auch ein Ausbleiben einer Schwangerschaft oder einer Geschlechtskrankheit. Denn die Motive, auf die Benutzung eines Kondoms zu bestehen, sind unbedeutend.
Das Kammergericht (KG) ist bzgl. der Annahme des § 177 I StGB etwas zurückhaltender. Es hat entschieden, dass das Stealthing jedenfalls dann den Tatbestand des sexuellen Übergriffs gem. § 177 I StGB erfüllt, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriert, sondern im weiteren Verlauf dieses ungeschützten Geschlechtsverkehrs darüber hinaus in den Körper des bzw. der Geschädigten ejakuliert. Denn in diesem Fall weise das Verhalten des Täters im Vergleich zum konsentierten Verkehr mit Kondom eine andere (sexualstraf-)rechtliche Qualität von strafbarkeitsbegründender Erheblichkeit auf, sodass dieser Geschlechtsverkehr als tatbestandsmäßige sexuelle Handlung im Sinne des § 177 I StGB anzusehen sei (KG 27.7.2020 – 4 Ss 58/20). Mit Blick gerade auf diese Begründung wird man davon ausgehen müssen, dass das KG wohl keinen Fall des § 177 I StGB angenommen hätte, wenn es nicht zu einer Ejakulation in den Körper des Opfers gekommen wäre. Das wäre aber abzulehnen. Denn wie aufgezeigt, umfasst das Recht der sexuellen Selbstbestimmung auch die Entscheidung, nur geschützten Geschlechtsverkehr auszuüben. Denn die Benutzung eines Kondoms soll nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften schützen, sondern auch vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten. Daher kann es bei § 177 I StGB nicht darauf ankommen, ob der Täter in den Körper des Opfers ejakuliert. Der Tatbestand des § 177 I StGB ist stets erfüllt, wenn der Täter absprachewidrig das Kondom abstreift und in einer die sexuelle Selbstbestimmung verletzenden Weise den Geschlechtsverkehr fortsetzt. Das Ejakulieren in den Körper des Opfers ist also nicht strafbarkeitsbegründend (das ist allein das Stealthing), sondern führt zu einer Erhöhung der Strafbemessung (§ 177 I StGB lässt eine Bestrafung von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu).
Ergebnis zu § 177 I StGB: Beim Stealthing verwirklicht der Täter den Tatbestand des § 177 I StGB. Denn er missachtet die Entscheidung des Opfers, Geschlechtsverkehr nur mit Kondom auszuüben, und verletzt damit dessen sexuelles Selbstbestimmungsrecht. Dabei spielt es keine Rolle, ob
- das Opfer das Abziehen des Kondoms zunächst nicht bemerkt und der Täter dann ohne Kondom den Geschlechtsverkehr fortsetzt,
- das Opfer das Abziehen des Kondoms bemerkt und der Täter dann unter Missachtung des erkennbaren entgegenstehenden Willens ohne Kondom den Geschlechtsverkehr fortsetzt,
- der Täter in den Körper des Opfers ejakuliert.
Ergebnis zu § 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB: Beim Stealthing verwirklicht der Täter regelmäßig auch die Strafzumessungsregel des § 177 VI S. 2 Nr. 1 StGB, die Vergewaltigung. Denn er dringt konsenswidrig ungeschützt in den Körper des Opfers ein und missachtet damit in besonderem Maße das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers. Er erhebt seine Sexualinteressen über die des Opfers. Dabei spielt es ebenfalls keine Rolle, ob
- das Opfer das Abziehen des Kondoms zunächst nicht bemerkt und der Täter dann ohne Kondom den Geschlechtsverkehr fortsetzt,
- das Opfer das Abziehen des Kondoms bemerkt und der Täter dann unter Missachtung des erkennbaren entgegenstehenden Willens ohne Kondom den Geschlechtsverkehr fortsetzt,
- der Täter in den Körper des Opfers ejakuliert.
Rolf Schmidt (14.08.2020)
05.08.2020: Namensführung der Kinder nach der Scheidung – hier: Einbenennung (§ 1618 BGB)
OLG Oldenburg, Beschl. v. 12.11.2019 – 3 UF 145/19, OLG Frankfurt, Beschl. v. 18.12.2019 – 1 UF 140/19, und OLG Hamm, Beschl. v. 28.04.2020 – 2 WF 14/20
In den drei hier besprochenen OLG-Beschlüssen ging es zum einen um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein gemeinsames Kind nach der Scheidung den Nachnamen des Elternteils bekommen kann, bei dem es nach der Scheidung lebt, obwohl es während der Ehe den Namen des anderen Elternteils getragen hat (sog. Einbenennung, § 1618 BGB), und zum anderen um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Weigerung der Zustimmung des früheren Ehegatten zur Einbenennung durch familiengerichtliche Entscheidung ersetzt werden kann. Zwar lässt § 1618 S. 4 BGB die gerichtliche Ersetzung zu, „wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich ist“, zu klären galt es aber, wie eng oder weit der Begriff der Erforderlichkeit zu verstehen ist. Während das OLG Oldenburg und das OLG Hamm unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH den Begriff der Erforderlichkeit eng auslegen und eine Kindeswohlgefährdung verlangen, damit die Einbenennungsentscheidung rechtmäßig ist, legt das OLG Frankfurt den Begriff der Erforderlichkeit weit aus und lässt es für die Zulässigkeit der Einbenennung genügen, wenn „die Aufrechterhaltung des Namensbandes zum anderen Elternteil nicht zumutbar erscheint“. Welche Auffassung überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalte (leicht verändert)
Gemäß den auf den Internetseiten der Gerichte veröffentlichten Sachverhaltsangaben liegen der folgenden Darstellung folgende Sachverhalte zugrunde, die, um die Probleme zu fokussieren, vom Verfasser teilweise leicht verändert wurden:
Sachverhalt OLG Oldenburg: Ein siebenjähriger Junge war nach der Trennung der unverheirateten Eltern zunächst bei der Mutter geblieben. Er trug auch den Nachnamen der Mutter. Später wechselte er zum Vater. Er lebt jetzt mit seinem Vater und dessen neuer Ehefrau in einem Haushalt. Der Vater wollte, dass das Kind seinen Nachnamen annehme, weil dies u.a. in der Schule einfacher sei. Das Kind identifiziere sich auch mit dem väterlichen Namen. Die Mutter war damit nicht einverstanden und verweigerte die Zustimmung zur Einbenennung, worauf der Vater Klage auf Einbenennung erhob. Das OLG Oldenburg bestätigte die erstinstanzliche familiengerichtliche Entscheidung und ersetzte die Zustimmung der Mutter nicht, da die Voraussetzungen für eine Einbenennung nicht vorlägen.
Sachverhalt OLG Frankfurt: Die Ehe der Eltern wurde vor rund 8 Jahren geschieden. Der Vater hat seit ca. 4 Jahren keine Umgangskontakte mit der Tochter mehr. Die Mutter ist inzwischen neu verheiratet. Sie trägt den Namen des zweiten Ehemannes als Familiennamen ebenso wie ihre in dieser Ehe geborene weitere Tochter. Die Mutter möchte, dass ihre erste Tochter ebenfalls diesen Familiennamen trägt. Da der Vater seine Einwilligung verweigerte, beantragte sie vor dem Familiengericht die Ersetzung seiner Einwilligung in die Einbenennung, was das Familiengericht ablehnte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. Die Voraussetzungen für die gerichtliche Ersetzung der Einwilligung des Vaters seien erfüllt. Die Namensänderung sei hier zum Wohl des Kindes erforderlich.
Sachverhalt OLG Hamm: Im Zuge der Scheidung der Eltern wurde die elterliche Sorge für das aus der Ehe hervorgegangene Kind der Mutter zur alleinigen Ausübung übertragen. Umgangskontakte zwischen dem heute 12 Jahre alten Kind und dem Kindesvater finden seit ca. 1 Jahr nicht mehr statt. Nunmehr hat die Mutter erneut geheiratet und nahm den Nachnamen ihres neuen Ehemannes (L) an. Aus ihrer Ehe mit Herrn L ist zwischenzeitlich eine Tochter hervorgegangen. Vor diesem Hintergrund wünschen Herr und Frau L sowie das Kind aus erster Ehe die Einbenennung. Der Kindsvater befinde sich aufgrund seiner Drogenabhängigkeit – nach wie vor – in einem Methadonprogramm, wechsele häufig seinen Wohnsitz und übe den Umgang mit dem Kind nicht verantwortungsbewusst aus. Bspw. habe er dem Kind ein Messer gekauft und es mit einem elektrischen Bogen schießen lassen. Einen Nachweis, dass er keine Drogen mehr konsumiere, habe er zu keinem Zeitpunkt erbracht, weshalb die Umgangsregelung auch nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Der Kindsvater beanspruche seitdem auch keine Umgangskontakte mehr. Geschenke habe er dem Kind ebenfalls nie gemacht. Auch Kindesunterhalt zahle er nicht. Auch äußere das Kind den Wunsch, den gleichen Namen zu tragen wie seine Mutter. Es verstehe nicht, warum es einen anderen Nachnamen tragen solle als seine Mutter, sein Stiefvater und seine Halbschwester. Aufgrund der Namensverschiedenheit habe es auch Hänseleien durch Mitschüler gegeben. Es wolle nicht mehr mit seinem leiblichen Vater in Verbindung gebracht werden, sondern „ganz“ zur Familie L gehören. Die Änderung des Familiennamens sei für das Wohl des Kindes daher erforderlich. Da der Vater seine Einwilligung zur Einbenennung verweigerte, beantragte Frau L vor dem Familiengericht die Ersetzung von dessen Einwilligung, was das Familiengericht ablehnte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG ebenfalls keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für die gerichtliche Ersetzung der Einwilligung des Vaters seien nicht erfüllt. Die Namensänderung sei zum Wohl des Kindes nicht erforderlich.
II. Rechtliche Ausgangslage
Das Namensrecht von Kindern ist insbesondere im 4. Buch des BGB, dem Familienrecht, geregelt. Hinsichtlich der Frage nach der Namensgebung des Kindes nach seiner Geburt enthält das Gesetz in §§ 1616, 1617 BGB Regelungen (dazu R. Schmidt, Familienrecht, 10. Auflage 2018, Rn. 87). Eine sich hieran anschließende Frage ist, ob – bei einer Veränderung in den familienrechtlichen Beziehungen – der Familienname des Kindes geändert werden kann. Virulent wird diese Frage insbesondere dann, wenn derjenige Elternteil, der das Sorgerecht innehat oder über das Aufenthaltsbestimmungsrecht verfügt (bei dem also das Kind lebt), entweder seinen Geburtsnamen wieder annimmt oder erneut heiratet und den Namen des neuen Ehepartners annimmt mit der Folge, dass (auch) das Kind den (neuen) Familiennamen tragen soll. Es ist zu unterscheiden (siehe R. Schmidt, Familienrecht, 10. Auflage 2018, Rn. 441a):
1. Namensänderung des Kindes, wenn ein Elternteil seinen Geburtsnamen wieder annimmt
Ändert der Ehegatte, der das alleinige Sorgerecht innehat und bei dem das Kind lebt, nach der Scheidung seinen Familiennamen dergestalt, dass er seinen Geburtsnamen wieder annimmt (was gem. § 1355 V S. 2 BGB ohne weiteres zulässig ist), ist eine Namensänderung des gemeinsamen, bei ihm lebenden Kindes in den Geburtsnamen des betreuenden Elternteils generell möglich. Denn in diesem Fall greift die Regelung des § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB, wonach der neue Familienname (hier: Geburtsname des geschiedenen Ehegatten) auf das Kind übertragen werden kann. Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung allerdings mindestens 5 Jahre alt, erstreckt sich der neue Familienname nur dann auf den Geburtsnamen des Kindes, wenn es sich der Namensgebung anschließt, § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB.
Sofern beide Elternteile aber nach wie vor die gemeinsame Sorge ausüben, steht die Namensänderung des Kindes unter Zustimmungsvorbehalt des anderen Elternteils, § 1617c I, II BGB. Eine Ersetzung der Zustimmung durch das Familiengericht ist – anders als bei der Konstellation, die den drei OLG-Beschlüssen zugrunde liegt – nicht vorgesehen. Die Zustimmung des anderen Elternteils zur Namensänderung ist also konstitutiv.
2. Namensänderung bei Wiederheirat des Elternteils, bei dem das Kind lebt
Schließt ein geschiedener Ehegatte, der das alleinige Sorgerecht ausübt, erneut eine Ehe und nimmt den Namen des neuen Ehegatten an (was gem. § 1355 I S. 1 und 2 BGB zulässig ist), ist eine Namensänderung des Kindes in den neuen Familiennamen des betreuenden Elternteils generell möglich, wenn dieser das alleinige Sorgerecht ausübt. In diesem Fall kann gem. § 1618 BGB der neue Familienname auf das Kind übertragen werden (sog. Einbenennung). Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung mindestens 5 Jahre alt, erstreckt sich der neue Familienname nur dann auf den Geburtsnamen des Kindes, wenn es sich der Namensgebung anschließt, § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB.
Schließt ein geschiedener Ehegatte, der mit dem anderen Elternteil das gemeinsame Sorgerecht innehat, erneut eine Ehe und nimmt den Namen des neuen Ehegatten an, ist eine Einbenennung möglich gem. § 1618 S. 1 BGB i.V.m. § 1617c III BGB, sofern gem. § 1618 S. 3 BGB der anderer Elternteil zustimmt. Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung mind. 5 Jahre alt, greift zusätzlich der Zustimmungsvorbehalt gem. § 1618 S. 3 BGB i.V.m. § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB. Verweigert der zustimmungsberechtigte andere Elternteil seine Zustimmung (bzw. Einwilligung), kann das Familiengericht die Einwilligung ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich ist, § 1618 S. 4 BGB.
Die hier besprochenen OLG-Beschlüsse haben diese zuletzt genannte Konstellation zum Gegenstand. Maßgeblich kommt es darauf an, wie der Begriff der Erforderlichkeit auszulegen ist.
III. Erforderlichkeit der Einbenennung bei gerichtlicher Ersetzungsentscheidung
Verweigert der andere, ebenfalls sorgeberechtigte Elternteil seine Zustimmung zur Einbenennung, ist diese wegen § 1618 S. 3 BGB grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmsweise ist die Einbenennung aber auch ohne die Zustimmung des anderen Elternteils möglich, und zwar gem. § 1618 S. 4 Halbs. 1 BGB durch gerichtliche Ersetzung der Zustimmung, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist (§ 1618 S. 4 Halbs. 2 BGB). Der BGH legt den Begriff der Erforderlichkeit eng aus und stellt hohe Anforderungen an die gerichtliche Ersetzungsentscheidung. Es müssten konkrete Umstände vorliegen, die das Kindeswohl gefährdeten; die Einbenennung müsse „unerlässlich“ (so BGH 30.01.2002 – XII ZB 94/00, FamR 2002, 1331, und BGH 10.03.2005 – XII ZB 153/03, NJW 2005, 1779, 1780) bzw. für das Kindeswohl „unabdingbar notwendig“ (so BGH 24.10.2001 – XII ZB 88/99, FamRZ 2002, 94, 95) sein, um Schäden von dem Kind abzuwenden. Nur dann könne die Zustimmung des sich weigernden Elternteils ersetzt werden.
Von den Instanzgerichten wird diese enge Auslegung teilweise getragen. So hat das OLG Oldenburg entschieden, dass bei Versagung der Einbenennung „konkrete Schäden für das Kind drohen müssen“, etwa dass das Kind durch die Namensdifferenz „außerordentlich psychisch belastet“ wäre (OLG Oldenburg 12.11.2019 – 3 UF 145/19). Nur dann sei eine gerichtliche Ersetzung der Zustimmung mit dem Elternrecht des anderen Elternteils vereinbar. Eine Einbenennung scheide daher grundsätzlich aus, wenn zwischen dem Kind und dem Elternteil, dessen Zustimmung ersetzt werden soll, (nach wie vor) eine tragfähige Beziehung bestehe (OLG Oldenburg 12.11.2019 – 3 UF 145/19). Auch das OLG Hamm ist dieser Ansicht. Eine Einbenennung könne nicht schon dann als erforderlich angesehen werden, wenn die Beseitigung der Namensverschiedenheit innerhalb der neuen Familie des sorgeberechtigten Elternteils zweckmäßig und dem Kindeswohl förderlich erscheine. Vielmehr sei stets zu prüfen, ob die Trennung des Namensbandes aus Gründen des Kindeswohls „unabdingbar notwendig“ sei. Es müssten mithin konkrete Umstände vorliegen, die das Kindeswohl gefährdeten, sodass die Einbenennung daher „unerlässlich“ sei, um Schäden von dem Kind abzuwenden (OLG Hamm mit Verweis u.a. auf BGH FamRZ 2002, 1331).
Diese enge Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit erscheint auf den ersten Blick plausibel, wenn man bedenkt, dass die Einbenennung keinen unerheblichen Eingriff in das Elternrecht (Art. 6 II GG) darstellt. Andererseits sind bei der Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit auch das Elternrecht des die Einbenennung begehrenden Elternteils aus Art. 6 II GG und das Persönlichkeitsrecht des Kindes aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG zu beachten. Das führt ggf. zu einer Absenkung der an eine Einbenennung zu stellenden Anforderungen. So wird von einem anderen Teil der Instanzgerichte (hier: OLG Frankfurt) die Auffassung vertreten, dass eine Ersetzung nicht erst in Betracht komme, wenn konkrete Umstände für eine Kindeswohlgefährdung vorlägen (OLG Frankfurt 18.12.2019 –1 UF 140/19, FamRZ 2020, 591, 592 f.). Vielmehr sei die Ersetzung bereits dann erforderlich, wenn „die Aufrechterhaltung des Namensbandes zum anderen Elternteil nicht zumutbar erscheint“. Das sei etwa der Fall, wenn das Kind seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil habe und selbst auch ausdrücklich eine Namensänderung wünsche. Zudem müsse in die Abwägung einfließen, ob das Kind durch die Namensverschiedenheit mit den anderen Angehörigen in der Familie, in der es lebt, außerordentlichen Belastungen ausgesetzt sei. Schließlich sei der Umstand zu berücksichtigen, dass der Name eines Kindes auch eine persönlichkeitsrechtliche Komponente habe, weshalb im Rahmen der Abwägung auch dem Kindeswillen Rechnung zu tragen sei (OLG Frankfurt 18.12.2019 –1 UF 140/19, FamRZ 2020, 591, 592 f.).
Stellungnahme: Der Auffassung des OLG Frankfurt ist zuzustimmen. Dem Kindesinteresse an der Namensänderung muss im Zweifel Vorrang vor dem Interesse des die Zustimmung verweigernden Elternteils eingeräumt werden. Eine Kindeswohlgefährdung zu fordern, überdehnt den Begriff der Erforderlichkeit in § 1618 BGB und widerspricht zudem der Ratio des Gesetzes. Die vom BGH, OLG Oldenburg und OLG Hamm vorgenommene enge Auslegung entspricht auch nicht dem Willen des Gesetzgebers, denn anderenfalls hätte dieser von Kindeswohlgefährdung sprechen müssen und hätte nicht die Erforderlichkeit genügen lassen dürfen. Schließlich überwiegt das Persönlichkeitsinteresse des Kindes. Pflegte dieses keinen oder nur einen distanzierten Umgang mit dem anderen Elternteil und wäre es durch die Namensverschiedenheit insbesondere zu den anderen Kindern in der neuen Familie (d.h. seinen Halbgeschwistern) erheblichen Belastungen ausgesetzt, stellte es sogar eine Kindeswohlgefährdung dar, sodass auch die enge Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit zur Ersetzung der Zustimmung zur Einbenennung führte. Es überwiegt also regelmäßig das Persönlichkeitsrecht des Kindes (Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG). Andererseits dürfte allein der Umstand, dass der Elternteil, bei dem das Kind lebt, einen anderen Familiennamen hat als das Kind, keinesfalls einen Eingriff in das Elternrecht des anderen Elternteils rechtfertigen.
Einig sind sich alle rekurrierten Spruchkörper aber insoweit, dass eine Ersetzung der Einwilligung des anderen Elternteils in die Einbenennung eine umfassende Abwägung der – grundsätzlich gleichrangigen – Kindes- und Elterninteressen voraussetzt.
OLG Oldenburg, Beschl. v. 12.11.2019 – 3 UF 145/19, OLG Frankfurt, Beschl. v. 18.12.2019 – 1 UF 140/19, und OLG Hamm, Beschl. v. 28.04.2020 – 2 WF 14/20
In den drei hier besprochenen OLG-Beschlüssen ging es zum einen um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein gemeinsames Kind nach der Scheidung den Nachnamen des Elternteils bekommen kann, bei dem es nach der Scheidung lebt, obwohl es während der Ehe den Namen des anderen Elternteils getragen hat (sog. Einbenennung, § 1618 BGB), und zum anderen um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Weigerung der Zustimmung des früheren Ehegatten zur Einbenennung durch familiengerichtliche Entscheidung ersetzt werden kann. Zwar lässt § 1618 S. 4 BGB die gerichtliche Ersetzung zu, „wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich ist“, zu klären galt es aber, wie eng oder weit der Begriff der Erforderlichkeit zu verstehen ist. Während das OLG Oldenburg und das OLG Hamm unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH den Begriff der Erforderlichkeit eng auslegen und eine Kindeswohlgefährdung verlangen, damit die Einbenennungsentscheidung rechtmäßig ist, legt das OLG Frankfurt den Begriff der Erforderlichkeit weit aus und lässt es für die Zulässigkeit der Einbenennung genügen, wenn „die Aufrechterhaltung des Namensbandes zum anderen Elternteil nicht zumutbar erscheint“. Welche Auffassung überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalte (leicht verändert)
Gemäß den auf den Internetseiten der Gerichte veröffentlichten Sachverhaltsangaben liegen der folgenden Darstellung folgende Sachverhalte zugrunde, die, um die Probleme zu fokussieren, vom Verfasser teilweise leicht verändert wurden:
Sachverhalt OLG Oldenburg: Ein siebenjähriger Junge war nach der Trennung der unverheirateten Eltern zunächst bei der Mutter geblieben. Er trug auch den Nachnamen der Mutter. Später wechselte er zum Vater. Er lebt jetzt mit seinem Vater und dessen neuer Ehefrau in einem Haushalt. Der Vater wollte, dass das Kind seinen Nachnamen annehme, weil dies u.a. in der Schule einfacher sei. Das Kind identifiziere sich auch mit dem väterlichen Namen. Die Mutter war damit nicht einverstanden und verweigerte die Zustimmung zur Einbenennung, worauf der Vater Klage auf Einbenennung erhob. Das OLG Oldenburg bestätigte die erstinstanzliche familiengerichtliche Entscheidung und ersetzte die Zustimmung der Mutter nicht, da die Voraussetzungen für eine Einbenennung nicht vorlägen.
Sachverhalt OLG Frankfurt: Die Ehe der Eltern wurde vor rund 8 Jahren geschieden. Der Vater hat seit ca. 4 Jahren keine Umgangskontakte mit der Tochter mehr. Die Mutter ist inzwischen neu verheiratet. Sie trägt den Namen des zweiten Ehemannes als Familiennamen ebenso wie ihre in dieser Ehe geborene weitere Tochter. Die Mutter möchte, dass ihre erste Tochter ebenfalls diesen Familiennamen trägt. Da der Vater seine Einwilligung verweigerte, beantragte sie vor dem Familiengericht die Ersetzung seiner Einwilligung in die Einbenennung, was das Familiengericht ablehnte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. Die Voraussetzungen für die gerichtliche Ersetzung der Einwilligung des Vaters seien erfüllt. Die Namensänderung sei hier zum Wohl des Kindes erforderlich.
Sachverhalt OLG Hamm: Im Zuge der Scheidung der Eltern wurde die elterliche Sorge für das aus der Ehe hervorgegangene Kind der Mutter zur alleinigen Ausübung übertragen. Umgangskontakte zwischen dem heute 12 Jahre alten Kind und dem Kindesvater finden seit ca. 1 Jahr nicht mehr statt. Nunmehr hat die Mutter erneut geheiratet und nahm den Nachnamen ihres neuen Ehemannes (L) an. Aus ihrer Ehe mit Herrn L ist zwischenzeitlich eine Tochter hervorgegangen. Vor diesem Hintergrund wünschen Herr und Frau L sowie das Kind aus erster Ehe die Einbenennung. Der Kindsvater befinde sich aufgrund seiner Drogenabhängigkeit – nach wie vor – in einem Methadonprogramm, wechsele häufig seinen Wohnsitz und übe den Umgang mit dem Kind nicht verantwortungsbewusst aus. Bspw. habe er dem Kind ein Messer gekauft und es mit einem elektrischen Bogen schießen lassen. Einen Nachweis, dass er keine Drogen mehr konsumiere, habe er zu keinem Zeitpunkt erbracht, weshalb die Umgangsregelung auch nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Der Kindsvater beanspruche seitdem auch keine Umgangskontakte mehr. Geschenke habe er dem Kind ebenfalls nie gemacht. Auch Kindesunterhalt zahle er nicht. Auch äußere das Kind den Wunsch, den gleichen Namen zu tragen wie seine Mutter. Es verstehe nicht, warum es einen anderen Nachnamen tragen solle als seine Mutter, sein Stiefvater und seine Halbschwester. Aufgrund der Namensverschiedenheit habe es auch Hänseleien durch Mitschüler gegeben. Es wolle nicht mehr mit seinem leiblichen Vater in Verbindung gebracht werden, sondern „ganz“ zur Familie L gehören. Die Änderung des Familiennamens sei für das Wohl des Kindes daher erforderlich. Da der Vater seine Einwilligung zur Einbenennung verweigerte, beantragte Frau L vor dem Familiengericht die Ersetzung von dessen Einwilligung, was das Familiengericht ablehnte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG ebenfalls keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für die gerichtliche Ersetzung der Einwilligung des Vaters seien nicht erfüllt. Die Namensänderung sei zum Wohl des Kindes nicht erforderlich.
II. Rechtliche Ausgangslage
Das Namensrecht von Kindern ist insbesondere im 4. Buch des BGB, dem Familienrecht, geregelt. Hinsichtlich der Frage nach der Namensgebung des Kindes nach seiner Geburt enthält das Gesetz in §§ 1616, 1617 BGB Regelungen (dazu R. Schmidt, Familienrecht, 10. Auflage 2018, Rn. 87). Eine sich hieran anschließende Frage ist, ob – bei einer Veränderung in den familienrechtlichen Beziehungen – der Familienname des Kindes geändert werden kann. Virulent wird diese Frage insbesondere dann, wenn derjenige Elternteil, der das Sorgerecht innehat oder über das Aufenthaltsbestimmungsrecht verfügt (bei dem also das Kind lebt), entweder seinen Geburtsnamen wieder annimmt oder erneut heiratet und den Namen des neuen Ehepartners annimmt mit der Folge, dass (auch) das Kind den (neuen) Familiennamen tragen soll. Es ist zu unterscheiden (siehe R. Schmidt, Familienrecht, 10. Auflage 2018, Rn. 441a):
1. Namensänderung des Kindes, wenn ein Elternteil seinen Geburtsnamen wieder annimmt
Ändert der Ehegatte, der das alleinige Sorgerecht innehat und bei dem das Kind lebt, nach der Scheidung seinen Familiennamen dergestalt, dass er seinen Geburtsnamen wieder annimmt (was gem. § 1355 V S. 2 BGB ohne weiteres zulässig ist), ist eine Namensänderung des gemeinsamen, bei ihm lebenden Kindes in den Geburtsnamen des betreuenden Elternteils generell möglich. Denn in diesem Fall greift die Regelung des § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB, wonach der neue Familienname (hier: Geburtsname des geschiedenen Ehegatten) auf das Kind übertragen werden kann. Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung allerdings mindestens 5 Jahre alt, erstreckt sich der neue Familienname nur dann auf den Geburtsnamen des Kindes, wenn es sich der Namensgebung anschließt, § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB.
Sofern beide Elternteile aber nach wie vor die gemeinsame Sorge ausüben, steht die Namensänderung des Kindes unter Zustimmungsvorbehalt des anderen Elternteils, § 1617c I, II BGB. Eine Ersetzung der Zustimmung durch das Familiengericht ist – anders als bei der Konstellation, die den drei OLG-Beschlüssen zugrunde liegt – nicht vorgesehen. Die Zustimmung des anderen Elternteils zur Namensänderung ist also konstitutiv.
2. Namensänderung bei Wiederheirat des Elternteils, bei dem das Kind lebt
Schließt ein geschiedener Ehegatte, der das alleinige Sorgerecht ausübt, erneut eine Ehe und nimmt den Namen des neuen Ehegatten an (was gem. § 1355 I S. 1 und 2 BGB zulässig ist), ist eine Namensänderung des Kindes in den neuen Familiennamen des betreuenden Elternteils generell möglich, wenn dieser das alleinige Sorgerecht ausübt. In diesem Fall kann gem. § 1618 BGB der neue Familienname auf das Kind übertragen werden (sog. Einbenennung). Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung mindestens 5 Jahre alt, erstreckt sich der neue Familienname nur dann auf den Geburtsnamen des Kindes, wenn es sich der Namensgebung anschließt, § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB.
Schließt ein geschiedener Ehegatte, der mit dem anderen Elternteil das gemeinsame Sorgerecht innehat, erneut eine Ehe und nimmt den Namen des neuen Ehegatten an, ist eine Einbenennung möglich gem. § 1618 S. 1 BGB i.V.m. § 1617c III BGB, sofern gem. § 1618 S. 3 BGB der anderer Elternteil zustimmt. Ist das Kind zum Zeitpunkt der Namensänderung mind. 5 Jahre alt, greift zusätzlich der Zustimmungsvorbehalt gem. § 1618 S. 3 BGB i.V.m. § 1617c I S. 1, II Nr. 1 BGB. Verweigert der zustimmungsberechtigte andere Elternteil seine Zustimmung (bzw. Einwilligung), kann das Familiengericht die Einwilligung ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich ist, § 1618 S. 4 BGB.
Die hier besprochenen OLG-Beschlüsse haben diese zuletzt genannte Konstellation zum Gegenstand. Maßgeblich kommt es darauf an, wie der Begriff der Erforderlichkeit auszulegen ist.
III. Erforderlichkeit der Einbenennung bei gerichtlicher Ersetzungsentscheidung
Verweigert der andere, ebenfalls sorgeberechtigte Elternteil seine Zustimmung zur Einbenennung, ist diese wegen § 1618 S. 3 BGB grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmsweise ist die Einbenennung aber auch ohne die Zustimmung des anderen Elternteils möglich, und zwar gem. § 1618 S. 4 Halbs. 1 BGB durch gerichtliche Ersetzung der Zustimmung, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist (§ 1618 S. 4 Halbs. 2 BGB). Der BGH legt den Begriff der Erforderlichkeit eng aus und stellt hohe Anforderungen an die gerichtliche Ersetzungsentscheidung. Es müssten konkrete Umstände vorliegen, die das Kindeswohl gefährdeten; die Einbenennung müsse „unerlässlich“ (so BGH 30.01.2002 – XII ZB 94/00, FamR 2002, 1331, und BGH 10.03.2005 – XII ZB 153/03, NJW 2005, 1779, 1780) bzw. für das Kindeswohl „unabdingbar notwendig“ (so BGH 24.10.2001 – XII ZB 88/99, FamRZ 2002, 94, 95) sein, um Schäden von dem Kind abzuwenden. Nur dann könne die Zustimmung des sich weigernden Elternteils ersetzt werden.
Von den Instanzgerichten wird diese enge Auslegung teilweise getragen. So hat das OLG Oldenburg entschieden, dass bei Versagung der Einbenennung „konkrete Schäden für das Kind drohen müssen“, etwa dass das Kind durch die Namensdifferenz „außerordentlich psychisch belastet“ wäre (OLG Oldenburg 12.11.2019 – 3 UF 145/19). Nur dann sei eine gerichtliche Ersetzung der Zustimmung mit dem Elternrecht des anderen Elternteils vereinbar. Eine Einbenennung scheide daher grundsätzlich aus, wenn zwischen dem Kind und dem Elternteil, dessen Zustimmung ersetzt werden soll, (nach wie vor) eine tragfähige Beziehung bestehe (OLG Oldenburg 12.11.2019 – 3 UF 145/19). Auch das OLG Hamm ist dieser Ansicht. Eine Einbenennung könne nicht schon dann als erforderlich angesehen werden, wenn die Beseitigung der Namensverschiedenheit innerhalb der neuen Familie des sorgeberechtigten Elternteils zweckmäßig und dem Kindeswohl förderlich erscheine. Vielmehr sei stets zu prüfen, ob die Trennung des Namensbandes aus Gründen des Kindeswohls „unabdingbar notwendig“ sei. Es müssten mithin konkrete Umstände vorliegen, die das Kindeswohl gefährdeten, sodass die Einbenennung daher „unerlässlich“ sei, um Schäden von dem Kind abzuwenden (OLG Hamm mit Verweis u.a. auf BGH FamRZ 2002, 1331).
Diese enge Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit erscheint auf den ersten Blick plausibel, wenn man bedenkt, dass die Einbenennung keinen unerheblichen Eingriff in das Elternrecht (Art. 6 II GG) darstellt. Andererseits sind bei der Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit auch das Elternrecht des die Einbenennung begehrenden Elternteils aus Art. 6 II GG und das Persönlichkeitsrecht des Kindes aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG zu beachten. Das führt ggf. zu einer Absenkung der an eine Einbenennung zu stellenden Anforderungen. So wird von einem anderen Teil der Instanzgerichte (hier: OLG Frankfurt) die Auffassung vertreten, dass eine Ersetzung nicht erst in Betracht komme, wenn konkrete Umstände für eine Kindeswohlgefährdung vorlägen (OLG Frankfurt 18.12.2019 –1 UF 140/19, FamRZ 2020, 591, 592 f.). Vielmehr sei die Ersetzung bereits dann erforderlich, wenn „die Aufrechterhaltung des Namensbandes zum anderen Elternteil nicht zumutbar erscheint“. Das sei etwa der Fall, wenn das Kind seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil habe und selbst auch ausdrücklich eine Namensänderung wünsche. Zudem müsse in die Abwägung einfließen, ob das Kind durch die Namensverschiedenheit mit den anderen Angehörigen in der Familie, in der es lebt, außerordentlichen Belastungen ausgesetzt sei. Schließlich sei der Umstand zu berücksichtigen, dass der Name eines Kindes auch eine persönlichkeitsrechtliche Komponente habe, weshalb im Rahmen der Abwägung auch dem Kindeswillen Rechnung zu tragen sei (OLG Frankfurt 18.12.2019 –1 UF 140/19, FamRZ 2020, 591, 592 f.).
Stellungnahme: Der Auffassung des OLG Frankfurt ist zuzustimmen. Dem Kindesinteresse an der Namensänderung muss im Zweifel Vorrang vor dem Interesse des die Zustimmung verweigernden Elternteils eingeräumt werden. Eine Kindeswohlgefährdung zu fordern, überdehnt den Begriff der Erforderlichkeit in § 1618 BGB und widerspricht zudem der Ratio des Gesetzes. Die vom BGH, OLG Oldenburg und OLG Hamm vorgenommene enge Auslegung entspricht auch nicht dem Willen des Gesetzgebers, denn anderenfalls hätte dieser von Kindeswohlgefährdung sprechen müssen und hätte nicht die Erforderlichkeit genügen lassen dürfen. Schließlich überwiegt das Persönlichkeitsinteresse des Kindes. Pflegte dieses keinen oder nur einen distanzierten Umgang mit dem anderen Elternteil und wäre es durch die Namensverschiedenheit insbesondere zu den anderen Kindern in der neuen Familie (d.h. seinen Halbgeschwistern) erheblichen Belastungen ausgesetzt, stellte es sogar eine Kindeswohlgefährdung dar, sodass auch die enge Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit zur Ersetzung der Zustimmung zur Einbenennung führte. Es überwiegt also regelmäßig das Persönlichkeitsrecht des Kindes (Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG). Andererseits dürfte allein der Umstand, dass der Elternteil, bei dem das Kind lebt, einen anderen Familiennamen hat als das Kind, keinesfalls einen Eingriff in das Elternrecht des anderen Elternteils rechtfertigen.
Einig sind sich alle rekurrierten Spruchkörper aber insoweit, dass eine Ersetzung der Einwilligung des anderen Elternteils in die Einbenennung eine umfassende Abwägung der – grundsätzlich gleichrangigen – Kindes- und Elterninteressen voraussetzt.
Argumente für Beibehaltung des Familiennamens (also gegen die Einbenennung) sind (wie sich aus den Beschlüssen ergibt):
- Kontinuität der Namensführung
- Beibehaltung des Namens als äußeres Zeichen der für das Wohl des Kindes gleichfalls wichtigen Aufrechterhaltung seiner Beziehung zu diesem Elternteil
- Umstand, dass bestehende Namensverschiedenheit grundsätzlich jedes Kind betrifft, das aus einer geschiedenen Ehe stammt und bei einem wiederverheirateten Elternteil lebt, der den Namen des neuen Ehepartners angenommen hat
- Identifikation mit der neuen Familie (Zugehörigkeitsgefühl) wird auch äußerlich gestärkt
- Mit einer Namensverschiedenheit verbundene psychische Belastungen werden vermieden
Da die genannten gegenläufigen Interessen auch Verfassungsgüter (Grundrechtspositionen) darstellen, haben in rechtsmethodischer Sicht die Familiengerichte die Entscheidung über die Ersetzung der Zustimmung zur Einbenennung unter Abwägung der widerstreitenden Verfassungsgüter (Grundrechtspositionen) zu treffen. Zwar bindet Art. 1 III GG die Grundrechte unmittelbar nur Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung mit der Folge, dass private Rechtssubjekte grundsätzlich keine unmittelbaren Grundrechtsadressaten sein und folgerichtig auch nicht (jedenfalls nicht unmittelbar) Grundrechte anderer Privater verletzen können. Gleichwohl verkörpern die Grundrechte eine objektive Wertordnung und gelten daher für alle Bereiche des Rechts als Richtlinie und Impuls und damit auch mittelbar im Verhältnis der Bürger untereinander (allgemeine Ansicht, vgl. etwa BVerfG NVwZ 2020, 53, 59 – „Recht auf Vergessenwerden I“; BVerfG NJW 2018, 1667, 1668 – Stadionverbot; BGH NJW 2015, 489, 491; BGH NJW 2018, 1884, 1886 – jeweils jameda.de; vgl. auch BVerfG NJW 2015, 2485 f.; grundlegend BVerfGE 7, 198, 203 ff. – Lüth). Dieser Effekt wird allgemein als mittelbare Drittwirkung der Grundrechte bezeichnet: Der Gewährleistungsgehalt der Grundrechte wirkt über das Medium der Vorschriften, die das einzelne Rechtsgebiet unmittelbar beherrschen. Das gilt insbesondere für die Generalklauseln und sonstigen auslegungsfähigen und auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe. „Einfallstore“ der Grundrechte in das Zivilrecht sind unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln. Im vorliegend relevanten Bereich ist dies der Begriff der Erforderlichkeit in § 1618 BGB. Das Familiengericht, das über einen Rechtsstreit zwischen Privaten (hier: die Einbenennung) entscheidet, muss daher bei jeder Entscheidung prüfen, ob und inwieweit das anzuwendende Gesetz (hier: § 1618 BGB) grundrechtlich beeinflusst ist. Bei der Frage der Erforderlichkeit der Einbenennung sind also die Grundrechte aller Beteiligten gegeneinander und untereinander abzuwägen: Das Elternrecht aus Art. 6 II GG aufseiten des die Zustimmung zur Einbenennung verweigernden Elternteils muss mit dem Elternrecht aus Art. 6 II GG aufseiten des die Einbenennung begehrenden Elternteils abgewogen werden. Hierbei ist dann insbesondere das von Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG geschützte Kindeswohlinteresse zu berücksichtigen. Schließlich sind in die Abwägung auch die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; hier: Art. 8 – Recht auf Familienleben) einzubeziehen. Zwar stellt die EMRK lediglich einen völkerrechtlichen Vertrag dar, dem in der Bundesrepublik Deutschland kraft einfachgesetzlicher Übernahme gem. Art. 59 II S. 1 GG innerstaatlich der formale Rang nur eines einfachen Bundesgesetzes zukommt (und der damit formal auf derselben Stufe steht wie § 1618 BGB). Da es jedoch der ständigen Rechtsprechung des BVerfG entspricht, Inhalt und Entwicklungsstand der EMRK auch bei der Anwendung von einfachem Recht zu berücksichtigen und als Auslegungshilfe heranzuziehen (vgl. nur BVerfG 26.2.2020 – 2 BvR 2347/15 u.a. Rn 302, NJW 2020, 905, 917 – Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung – mit Verweis auf BVerfGE 111, 307, 317 f.; 149, 293, 328), müssen die Maßstäbe, die Art. 8 EMRK aufstellt, ebenfalls bei der im Rahmen der Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit vorzunehmenden Abwägung einbezogen werden.
Rolf Schmidt (05.08.2020)
03.08.2020: Kündigung von Fitnessstudio-Verträgen
AG Frankenthal, Urteil v. 05.06.2020 – 3c C 51/19
Das AG Frankenthal hat entschieden, dass für die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags Vorerkrankungen des Kunden dann keine Rolle spielen, wenn die zur Kündigung führenden Beschwerden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bestanden und das Auftreten für den Kunden nicht vorhersehbar war. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
A und B schlossen einen Mitgliedsvertrag über die Nutzung des von B betriebenen Fitnessstudios, dessen Laufzeit zunächst auf 2 Jahre begrenzt war. A litt zu diesem Zeitpunkt u.a. an Bewegungseinschränkungen im Rücken aufgrund einer operativen Versteifung der Wirbelsäule und aufgrund von degenerativen HWS-Veränderungen sowie an Arthrose in den Knien. Ein halbes Jahr nach Vertragsbeginn einigten sich die Parteien auf ein „Ruhen“ des Vertrags für 7 Wochen, wodurch sich die Laufzeit des Vertrags um diese Zeit verlängerte. Eine Woche nach Ende des „Ruhens“ erklärte A die krankheitsbedingte außerordentliche Kündigung des Vertrags unter Bezugnahme auf ein drei Tage zuvor ausgestelltes ärztliches Attest, in dem A eine nach Abschluss des Vertrags erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands bescheinigt wurde. So seien seine chronischen, arthrosebedingten Beschwerden im linken Knie schlimmer geworden, v.a. aber seien Kribbeln und Taubheitsgefühle im linken Arm (Parästhesie) hinzugekommen, die es ihm unmöglich machten, die von B zur Verfügung gestellten Fitnessgeräte zu nutzen. Gleichwohl bestand B auf Zahlung der ausstehenden Mitgliedsbeiträge.
II. Rechtliche Ausgangslage
Bei einem Fitnessstudio-Vertrag handelt es sich nicht um einen reinen Typenvertrag (wie Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag etc.), sondern um einen gemischttypischen Vertrag, da er Elemente eines Mietvertrags (in Bezug auf die Benutzung der Sportgeräte und anderer Einrichtungsgegenstände), eines Kaufvertrags (etwa, wenn Fertigprodukte an der Theke gekauft werden), eines Werkvertrags (etwa, wenn Fitnessdrinks an der Theke zubereitet werden) und eines Dienstvertrags (etwa, wenn Instruktionen des Fitnesstrainers eingeholt werden) vereint (vgl. zur Vertragseinstufung BGH NJW 2016, 3718; NJW 2012, 1431; OLG Hamm NJW-RR 2013, 397; AG Frankfurt/M 25.09.2019 – 31 C 2619/18 (17), wobei in allen Fällen der Schwerpunkt im Mietvertrag gesehen wurde, letztlich aber offenbleiben konnte, ob es sich um Miet-, Dienst- oder typengemischte Verträge handelt). Den Schwerpunkt bilden aber regelmäßig die Mietvertrags- und Dienstvertragskomponenten. Beide Komponenten sind auf länger andauernde und wiederkehrende Leistungserbringungen gerichtet. Insoweit spricht man auch von Dauerschuldverhältnissen. Ein Dauerschuldverhältnis liegt vor, wenn die Leistungspflicht mindestens einer Partei in einem dauernden Verhalten oder in regelmäßig wiederkehrenden Leistungen besteht und der Gesamtumfang der zu erbringenden (Haupt-)Leistungen von der Dauer der Zeit abhängt, während die Leistungen des Schuldners fortlaufend zu erbringen sind (Gaier, in: Münchener Kommentar zum BGB, § 314 Rn. 5). Die Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses erfolgt entweder durch Fristablauf (wenn also der Zeitraum, für den der Vertrag geschlossen wurde, verstrichen ist) oder durch Kündigung. Die Möglichkeit der Kündigung stellt sogar ein Wesenselement eines Dauerschuldverhältnisses dar, leuchtet es doch ein, dass wegen der mit einem jedenfalls unbefristeten Dauerschuldverhältnis verbundenen Rechtswirkungen eine „Bindung auf ewig“ nicht in Betracht kommen kann. Die Möglichkeit der „ordentlichen“ (d.h. mit einer Frist und regelmäßig auch mit dem Erfordernis eines Kündigungsgrundes versehenen) Kündigung ist folgerichtig im Normengefüge der jeweiligen Vertragstypen positivrechtlich geregelt; bei gemischten Verträgen richtet sie sich oftmals nach dem Normengefüge des den Vertragskern ausmachenden Teils.
AG Frankenthal, Urteil v. 05.06.2020 – 3c C 51/19
Das AG Frankenthal hat entschieden, dass für die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags Vorerkrankungen des Kunden dann keine Rolle spielen, wenn die zur Kündigung führenden Beschwerden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bestanden und das Auftreten für den Kunden nicht vorhersehbar war. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt (leicht verändert)
A und B schlossen einen Mitgliedsvertrag über die Nutzung des von B betriebenen Fitnessstudios, dessen Laufzeit zunächst auf 2 Jahre begrenzt war. A litt zu diesem Zeitpunkt u.a. an Bewegungseinschränkungen im Rücken aufgrund einer operativen Versteifung der Wirbelsäule und aufgrund von degenerativen HWS-Veränderungen sowie an Arthrose in den Knien. Ein halbes Jahr nach Vertragsbeginn einigten sich die Parteien auf ein „Ruhen“ des Vertrags für 7 Wochen, wodurch sich die Laufzeit des Vertrags um diese Zeit verlängerte. Eine Woche nach Ende des „Ruhens“ erklärte A die krankheitsbedingte außerordentliche Kündigung des Vertrags unter Bezugnahme auf ein drei Tage zuvor ausgestelltes ärztliches Attest, in dem A eine nach Abschluss des Vertrags erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands bescheinigt wurde. So seien seine chronischen, arthrosebedingten Beschwerden im linken Knie schlimmer geworden, v.a. aber seien Kribbeln und Taubheitsgefühle im linken Arm (Parästhesie) hinzugekommen, die es ihm unmöglich machten, die von B zur Verfügung gestellten Fitnessgeräte zu nutzen. Gleichwohl bestand B auf Zahlung der ausstehenden Mitgliedsbeiträge.
II. Rechtliche Ausgangslage
Bei einem Fitnessstudio-Vertrag handelt es sich nicht um einen reinen Typenvertrag (wie Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag etc.), sondern um einen gemischttypischen Vertrag, da er Elemente eines Mietvertrags (in Bezug auf die Benutzung der Sportgeräte und anderer Einrichtungsgegenstände), eines Kaufvertrags (etwa, wenn Fertigprodukte an der Theke gekauft werden), eines Werkvertrags (etwa, wenn Fitnessdrinks an der Theke zubereitet werden) und eines Dienstvertrags (etwa, wenn Instruktionen des Fitnesstrainers eingeholt werden) vereint (vgl. zur Vertragseinstufung BGH NJW 2016, 3718; NJW 2012, 1431; OLG Hamm NJW-RR 2013, 397; AG Frankfurt/M 25.09.2019 – 31 C 2619/18 (17), wobei in allen Fällen der Schwerpunkt im Mietvertrag gesehen wurde, letztlich aber offenbleiben konnte, ob es sich um Miet-, Dienst- oder typengemischte Verträge handelt). Den Schwerpunkt bilden aber regelmäßig die Mietvertrags- und Dienstvertragskomponenten. Beide Komponenten sind auf länger andauernde und wiederkehrende Leistungserbringungen gerichtet. Insoweit spricht man auch von Dauerschuldverhältnissen. Ein Dauerschuldverhältnis liegt vor, wenn die Leistungspflicht mindestens einer Partei in einem dauernden Verhalten oder in regelmäßig wiederkehrenden Leistungen besteht und der Gesamtumfang der zu erbringenden (Haupt-)Leistungen von der Dauer der Zeit abhängt, während die Leistungen des Schuldners fortlaufend zu erbringen sind (Gaier, in: Münchener Kommentar zum BGB, § 314 Rn. 5). Die Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses erfolgt entweder durch Fristablauf (wenn also der Zeitraum, für den der Vertrag geschlossen wurde, verstrichen ist) oder durch Kündigung. Die Möglichkeit der Kündigung stellt sogar ein Wesenselement eines Dauerschuldverhältnisses dar, leuchtet es doch ein, dass wegen der mit einem jedenfalls unbefristeten Dauerschuldverhältnis verbundenen Rechtswirkungen eine „Bindung auf ewig“ nicht in Betracht kommen kann. Die Möglichkeit der „ordentlichen“ (d.h. mit einer Frist und regelmäßig auch mit dem Erfordernis eines Kündigungsgrundes versehenen) Kündigung ist folgerichtig im Normengefüge der jeweiligen Vertragstypen positivrechtlich geregelt; bei gemischten Verträgen richtet sie sich oftmals nach dem Normengefüge des den Vertragskern ausmachenden Teils.
Beispiele: §§ 542 I, 568, 573 ff. BGB für den Mietvertrag, § 620 II BGB für den Arbeitsvertrag etc.
Daneben ist es allgemein anerkannt und mit § 314 BGB positivrechtlich geregelt, dass jedes Dauerschuldverhältnis von beiden Seiten auch aus wichtigem Grund „außerordentlich“ (d.h. ohne Einhaltung einer Frist) gekündigt werden kann, wobei wegen des grundsätzlich schutzwürdigen Vertrauens der anderen Partei in den Fortbestand des Vertrags strenge Voraussetzungen an die Kündigung zu stellen sind. § 314 BGB bringt dies mit dem Erfordernis des „wichtigen Grundes“ zum Ausdruck. Die Vorschrift hat jedoch nur für solche Dauerschuldverhältnisse Bedeutung, die nicht (oder nicht abschließend) von den gesetzlichen Sonderregelungen erfasst sind. Bei Fitnessstudio-Verträgen könnten also die o.g. Spezialregelungen greifen, weil der Schwerpunkt im Miet- bzw. Dienstvertragsrecht liegt. Gleichwohl geht die h.M. den Weg über § 314 BGB (siehe etwa BGH NJW 2012, 1431 f.).
III. Die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund, § 314 BGB
Voraussetzung für ein Kündigungsrecht nach § 314 BGB ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes, der die Fortsetzung des Schuldverhältnisses bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit oder der Frist für eine ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für den Gläubiger unzumutbar macht (siehe dazu auch BT-Drs. 14/6040, S. 178; BGH NJW 2012, 1431 f.; NJW 2016, 3718, 3719). Es ist also eine Prüfung in zwei Stufen vorzunehmen:
Ein wichtiger Grund ist gemäß der Legaldefinition des § 314 I S. 2 BGB gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags für den Kündigenden unzumutbar machen (siehe BGHZ 41, 104, 108; 133, 316, 320; BGH NJW 2012, 376; NJW 2012, 1431 f.; NJW 2016, 3718, 3719). Streng genommen enthält die Legaldefinition des wichtigen Grundes bereits die gebotene Interessenabwägung. Gleichwohl erscheint es aus rechtsmethodischer Sicht vorzugswürdiger, zunächst den wichtigen Grund abstrakt zu bestimmen und sodann in einem zweiten Schritt die Interessenabwägung vorzunehmen.
Daneben ist es allgemein anerkannt und mit § 314 BGB positivrechtlich geregelt, dass jedes Dauerschuldverhältnis von beiden Seiten auch aus wichtigem Grund „außerordentlich“ (d.h. ohne Einhaltung einer Frist) gekündigt werden kann, wobei wegen des grundsätzlich schutzwürdigen Vertrauens der anderen Partei in den Fortbestand des Vertrags strenge Voraussetzungen an die Kündigung zu stellen sind. § 314 BGB bringt dies mit dem Erfordernis des „wichtigen Grundes“ zum Ausdruck. Die Vorschrift hat jedoch nur für solche Dauerschuldverhältnisse Bedeutung, die nicht (oder nicht abschließend) von den gesetzlichen Sonderregelungen erfasst sind. Bei Fitnessstudio-Verträgen könnten also die o.g. Spezialregelungen greifen, weil der Schwerpunkt im Miet- bzw. Dienstvertragsrecht liegt. Gleichwohl geht die h.M. den Weg über § 314 BGB (siehe etwa BGH NJW 2012, 1431 f.).
III. Die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund, § 314 BGB
Voraussetzung für ein Kündigungsrecht nach § 314 BGB ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes, der die Fortsetzung des Schuldverhältnisses bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit oder der Frist für eine ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für den Gläubiger unzumutbar macht (siehe dazu auch BT-Drs. 14/6040, S. 178; BGH NJW 2012, 1431 f.; NJW 2016, 3718, 3719). Es ist also eine Prüfung in zwei Stufen vorzunehmen:
- Es muss ein wichtiger Grund vorliegen
- und eine umfassende Interessenabwägung muss es gebieten, sich mit sofortiger Wirkung aus dem Vertragsverhältnis zu lösen.
Ein wichtiger Grund ist gemäß der Legaldefinition des § 314 I S. 2 BGB gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags für den Kündigenden unzumutbar machen (siehe BGHZ 41, 104, 108; 133, 316, 320; BGH NJW 2012, 376; NJW 2012, 1431 f.; NJW 2016, 3718, 3719). Streng genommen enthält die Legaldefinition des wichtigen Grundes bereits die gebotene Interessenabwägung. Gleichwohl erscheint es aus rechtsmethodischer Sicht vorzugswürdiger, zunächst den wichtigen Grund abstrakt zu bestimmen und sodann in einem zweiten Schritt die Interessenabwägung vorzunehmen.
Anerkannt ist, dass der wichtige Grund in der Verletzung einer Haupt- oder Nebenpflicht
des Vertrags liegen kann (dazu näher R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn. 844 f.). Verschlechtert
sich z.B. das Leistungsangebot
des Fitnessstudios und entspricht nicht mehr dem im Vertrag zugesagten (d.h. vereinbarten) Leistungsumfang (Beispiele: Reduzierung der Anzahl der Geräte, der Kurse, der Sauna etc.) oder ist die Ausstattung des Fitnessstudios von Anfang an schlechter, als dies vom Betreiber beworben oder zugesagt wurde, kann eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sein. Gleiches gilt bei Verschlechterung der Hygieneverhältnisse, wobei aber auch hier grundsätzlich eine Ermahnung und Fristsetzung zur Abhilfe vorrangig sind (siehe § 314 II S. 1 BGB; zu Ausnahmen siehe § 314 II S. 2 und 3 BGB).
Ein außerordentlicher Kündigungsgrund kann aber auch gegeben sein, wenn sich im Laufe des Vollzugs des Dauerschuldverhältnisses außerhalb des Vertrags liegende Umstände schwerwiegend verändert
haben, was etwa bei Arbeitsplatzverlust, Krankheit, Unfall
oder sonstiger Verhinderung
des Kündigenden denkbar ist. Freilich darf dabei nicht übersehen werden, dass außerordentliche Kündigungen, die an besondere Umstände anknüpfen, die mit der Person des Vertragspartners nichts zu tun haben, das (ebenfalls schutzwürdige) Vertrauen des Vertragspartners in den (unveränderten) Bestand des Vertrags zerstören, weshalb eine restriktive
Handhabung angezeigt ist (siehe R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn 849). Folgerichtig scheidet eine außerordentliche Kündigung aus, wenn sich die Störung durch Anpassung des Vertrags an die veränderten Umstände beseitigen lässt und den Parteien eine Fortsetzung des Vertrags zuzumuten ist. Hier bietet das Institut der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) i.d.R. adäquatere Lösungen wie bspw. Ruhenlassen des Vertrags, Anpassung des Beitrags etc. Auch hierdurch wird deutlich, dass eine außerordentliche Kündigung nur Ultima Ratio sein kann und sie besonderer Gründe
bedarf.
Für das Vorliegen der Gründe, die zur außerordentlichen Kündigung berechtigen sollen, trägt schließlich derjenige, der sich auf deren Vorliegen beruft, die Darlegungs- und Beweislast. Regelmäßig sind also Belege (ärztliche Atteste, Bescheinigungen etc.) beizubringen.
2. Interessenabwägung („Risikozuordnung“)
Dem Kündigenden darf die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden können (§ 314 I S. 2 BGB).
Da die Parteien eigenverantwortlich einen Vertrag geschlossen haben und grundsätzlich daran gebunden bleiben sollen (pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten), fällt im Allgemeinen die Abwägung nur dann zugunsten des Kündigenden aus, wenn Gründe, auf die die Kündigung gestützt werden kann, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen. Anwendungsfälle sind bspw. vom Kündigungsgegner zu verantwortende Gefährdungen des Vertragszwecks (BGH NJW 1981, 1666, 1667). Denn dann ist dessen Vertrauen in den Fortbestand des Vertrags nicht schutzbedürftig. Gleiches gilt bei Verletzung von Vertragspflichten (s.o.). Wird der Kündigungsgrund hingegen aus Vorgängen hergeleitet, die dem Einfluss des Kündigungsgegners entzogen sind bzw. aus der eigenen Interessensphäre des Kündigenden herrühren, rechtfertigt dies grundsätzlich keine außerordentliche Kündigung (vgl. BGH NJW 2016, 3718, 3719; AG Bremen 16.10.2014 – 10 C 47/14; AG Freiburg 23.01.2013 – 1 C 2951/12; LG Gießen 15.02.2012 – 1 S 338/11). Anwendungsfälle sind bspw. private oder berufliche Veränderungen wie Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Unfall des Kündigenden. Aber auch hier kommt es letztlich auf die Zumutbarkeit an. Die Rechtsprechung fragt danach, welcher Partei das Festhalten am Vertrag eher zuzumuten ist (BGHZ 45, 104, 108; BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.), was durch tatrichterliche Würdigung festzustellen ist. Somit wird deutlich, dass eine gewisse Unsicherheit über den Ausgang des Abwägungsprozesses besteht.
So ist es BGH-Rechtsprechung, dass ein Nutzer eines Fitnessstudios, der das Trainingsangebot infolge eines Wohnsitzwechsels wegen der Entfernung nicht mehr in Anspruch nehmen kann, ein nachvollziehbares Interesse daran hat, dem Leistungsanbieter kein Entgelt mehr entrichten zu müssen. Der Umstand, dass der Nutzer aufgrund seines Umzugs die Leistungen des Fitnessstudios nicht mehr in Anspruch nehmen kann, ist nach der Rechtsprechung aber grundsätzlich allein seinem Risikobereich zuzuordnen. Das gilt auch dann, wenn der Wohnsitzwechsel beruflich veranlasst ist (z.B. wegen Versetzung eines Polizisten oder Soldaten). Denn auch in diesem Fall ist der Umstand, dass der Nutzer das Leistungsangebot des Anbieters nicht mehr in zumutbarer Weise nutzen kann, nicht vom Anbieter beeinflussbar. Eine analoge Anwendung von Vorschriften, die bei einem Wohnungswechsel ein Sonderkündigungsrecht vorsehen (wie etwa § 46 VIII S. 3 TKG), lehnt der BGH in Ermangelung einer planwidrigen Regelungslücke ab (BGH NJW 2016, 3718, 3719). Jedoch bleibt Betroffenen ein kleiner „Hoffnungsschimmer“, der darin begründet ist, dass der BGH (lediglich) von „grundsätzlich“ spricht und auch bei einem bloßen Wohnungswechsel eine außerordentliche Kündigung nicht gänzlich ausschließt. Er verweist hierbei auf besondere Umstände, die die Übernahme des Verwendungsrisikos für den Nutzer gleichwohl als unzumutbar erscheinen lassen. Das wiederum macht der BGH an der Dauer der Restlaufzeit (und der damit verbundenen Beitragsgröße) fest sowie an dem Umstand, für die Dauer der Restlaufzeit die Angebote des Fitnessstudios überhaupt nicht nutzen zu können (BGH NJW 2016, 3718, 3719 f.). Demnach kann man also sagen: Je länger die Restlaufzeit beträgt, desto eher kommt eine Sonderkündigungsmöglichkeit in Betracht, wenn aufgrund der Entfernung eine Nutzung des Studios vollständig ausgeschlossen ist. Hat der Nutzer aber noch einen (Zweit-)Wohnsitz am Ort der Sportstätte, gibt er damit zu erkennen, noch eine – wenn auch eingeschränkte – Nutzungsmöglichkeit zu haben (so im Fall BGH NJW 2016, 3718). Insbesondere dieser zuletzt genannte Punkt wurde vom BGH als geeignet angesehen, die Frage nach dem wichtigen Grund zu Lasten des Kündigungswilligen zu beurteilen (siehe BGH NJW 2016, 3718, 3720: „...schon nicht hinreichend dargelegt hat, dass er die Angebote der Kl. überhaupt nicht mehr nutzen könne, obgleich er noch einen Wohnsitz in Hannover hatte“). Keinesfalls ist eine Kündigung wirksam, wenn der Vertrag mit einer Fitnessstudio-Kette geschlossen wurde und die Möglichkeit besteht, am neuen Wohnort die Leistungen eines Studios der Kette in Anspruch zu nehmen. Bei beruflicher Versetzung in das Ausland (insbesondere bei Bundeswehrsoldaten) ist eine Kündigung aber unproblematisch.
2. Interessenabwägung („Risikozuordnung“)
Dem Kündigenden darf die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden können (§ 314 I S. 2 BGB).
Da die Parteien eigenverantwortlich einen Vertrag geschlossen haben und grundsätzlich daran gebunden bleiben sollen (pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten), fällt im Allgemeinen die Abwägung nur dann zugunsten des Kündigenden aus, wenn Gründe, auf die die Kündigung gestützt werden kann, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen. Anwendungsfälle sind bspw. vom Kündigungsgegner zu verantwortende Gefährdungen des Vertragszwecks (BGH NJW 1981, 1666, 1667). Denn dann ist dessen Vertrauen in den Fortbestand des Vertrags nicht schutzbedürftig. Gleiches gilt bei Verletzung von Vertragspflichten (s.o.). Wird der Kündigungsgrund hingegen aus Vorgängen hergeleitet, die dem Einfluss des Kündigungsgegners entzogen sind bzw. aus der eigenen Interessensphäre des Kündigenden herrühren, rechtfertigt dies grundsätzlich keine außerordentliche Kündigung (vgl. BGH NJW 2016, 3718, 3719; AG Bremen 16.10.2014 – 10 C 47/14; AG Freiburg 23.01.2013 – 1 C 2951/12; LG Gießen 15.02.2012 – 1 S 338/11). Anwendungsfälle sind bspw. private oder berufliche Veränderungen wie Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Unfall des Kündigenden. Aber auch hier kommt es letztlich auf die Zumutbarkeit an. Die Rechtsprechung fragt danach, welcher Partei das Festhalten am Vertrag eher zuzumuten ist (BGHZ 45, 104, 108; BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.), was durch tatrichterliche Würdigung festzustellen ist. Somit wird deutlich, dass eine gewisse Unsicherheit über den Ausgang des Abwägungsprozesses besteht.
So ist es BGH-Rechtsprechung, dass ein Nutzer eines Fitnessstudios, der das Trainingsangebot infolge eines Wohnsitzwechsels wegen der Entfernung nicht mehr in Anspruch nehmen kann, ein nachvollziehbares Interesse daran hat, dem Leistungsanbieter kein Entgelt mehr entrichten zu müssen. Der Umstand, dass der Nutzer aufgrund seines Umzugs die Leistungen des Fitnessstudios nicht mehr in Anspruch nehmen kann, ist nach der Rechtsprechung aber grundsätzlich allein seinem Risikobereich zuzuordnen. Das gilt auch dann, wenn der Wohnsitzwechsel beruflich veranlasst ist (z.B. wegen Versetzung eines Polizisten oder Soldaten). Denn auch in diesem Fall ist der Umstand, dass der Nutzer das Leistungsangebot des Anbieters nicht mehr in zumutbarer Weise nutzen kann, nicht vom Anbieter beeinflussbar. Eine analoge Anwendung von Vorschriften, die bei einem Wohnungswechsel ein Sonderkündigungsrecht vorsehen (wie etwa § 46 VIII S. 3 TKG), lehnt der BGH in Ermangelung einer planwidrigen Regelungslücke ab (BGH NJW 2016, 3718, 3719). Jedoch bleibt Betroffenen ein kleiner „Hoffnungsschimmer“, der darin begründet ist, dass der BGH (lediglich) von „grundsätzlich“ spricht und auch bei einem bloßen Wohnungswechsel eine außerordentliche Kündigung nicht gänzlich ausschließt. Er verweist hierbei auf besondere Umstände, die die Übernahme des Verwendungsrisikos für den Nutzer gleichwohl als unzumutbar erscheinen lassen. Das wiederum macht der BGH an der Dauer der Restlaufzeit (und der damit verbundenen Beitragsgröße) fest sowie an dem Umstand, für die Dauer der Restlaufzeit die Angebote des Fitnessstudios überhaupt nicht nutzen zu können (BGH NJW 2016, 3718, 3719 f.). Demnach kann man also sagen: Je länger die Restlaufzeit beträgt, desto eher kommt eine Sonderkündigungsmöglichkeit in Betracht, wenn aufgrund der Entfernung eine Nutzung des Studios vollständig ausgeschlossen ist. Hat der Nutzer aber noch einen (Zweit-)Wohnsitz am Ort der Sportstätte, gibt er damit zu erkennen, noch eine – wenn auch eingeschränkte – Nutzungsmöglichkeit zu haben (so im Fall BGH NJW 2016, 3718). Insbesondere dieser zuletzt genannte Punkt wurde vom BGH als geeignet angesehen, die Frage nach dem wichtigen Grund zu Lasten des Kündigungswilligen zu beurteilen (siehe BGH NJW 2016, 3718, 3720: „...schon nicht hinreichend dargelegt hat, dass er die Angebote der Kl. überhaupt nicht mehr nutzen könne, obgleich er noch einen Wohnsitz in Hannover hatte“). Keinesfalls ist eine Kündigung wirksam, wenn der Vertrag mit einer Fitnessstudio-Kette geschlossen wurde und die Möglichkeit besteht, am neuen Wohnort die Leistungen eines Studios der Kette in Anspruch zu nehmen. Bei beruflicher Versetzung in das Ausland (insbesondere bei Bundeswehrsoldaten) ist eine Kündigung aber unproblematisch.
Auch eine Schwangerschaft
stellt laut einigen Instanzgerichten grundsätzlich keinen Grund für eine außerordentlichen Kündigung dar (AG Hannover 28.05.2009 – 568 C 15608/08; AG München 09.06.2010 – 251 C 26718/09, NJW-RR 2011, 67 f.). So ist zunächst danach zu fragen, ob die Schwangere noch einen Teil der Angebote nutzen kann. Dabei kommt es aber in erheblichem Maße darauf an,
ob sich die Schwangere aufgrund der Häufung der
schwangerschaftsbedingten Beschwerden nicht mehr in der Lage sieht, die
Einrichtungen des Fitnessstudios zu benutzen (AG München 09.06.2010 – 251 C 26718/09, NJW-RR 2011, 67 f.). Vorrangig vor einer Kündigung (da Ultima Ratio) kommt aber ein Ruhen des Vertrags in Betracht (etwa, weil vertraglich vorgesehen oder vom Anbieter nachträglich angeboten wie im Fall AG Hannover 28.05.2009 – 568 C 15608/08). Keinesfalls aber trägt eine außerordentliche Kündigung, wenn der Schwangeren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Schwangerschaft bekannt war. Auch der BGH anerkennt ein grundsätzliches Recht zur außerordentlichen Kündigung im Falle einer Schwangerschaft. Wie der BGH in diesem Zusammenhang zutreffend formuliert, wirken sich der besondere Schutz des Art. 6 IV GG und dessen wertsetzende Bedeutung auch auf die Frage des Bestehens eines Rechts auf außerordentliche Kündigung aus (BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.). Orientiert man sich hieran, wird man im Zweifel ein Recht der Schwangeren zur außerordentlichen Kündigung bejahen müssen, wenn die Feststellung und Gewichtung der oben genannten Aspekte (Nutzungsmöglichkeit, Optionen der Anpassung oder des Ruhens des Vertrags) im konkreten Fall wenigstens nicht zulasten der Schwangeren ausfallen.
Ein finanzieller Engpass
stellt keinen Kündigungsgrund dar. Das gilt selbst bei Arbeitsplatzverlust. Freilich bietet es sich auch hier an, mit dem Betreiber des Fitnessstudios zu sprechen, kann doch die Vollstreckung bei fehlender Vermögensmasse nicht in seinem Interesse sein.
Jedoch kann sich die Risikozuordnung im Einzelfall – insbesondere bei Krankheit
oder Unfall
– als sehr schwierig erweisen und auch die Rechtsprechung entscheidet nicht stets überzeugend, wie sich das im hier zu besprechenden Ausgangsfall zeigt.
IV. Lösung des Ausgangsfalls
Die von B geltend gemachte Zahlung der Mitgliedsbeiträge wäre berechtigt, wenn der Vertrag nach wie vor Bestand hätte. Jedoch könnten die Vertragspflichten und somit auch die Zahlungspflicht des A aufgrund der von ihm ausgesprochenen Kündigung erloschen sein. Da eine spezielle gesetzliche Kündigungsmöglichkeit nicht besteht und auch eine an sich vorrangige Anpassung des Vertrags gem. § 313 I BGB (dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn. 860) nicht zielführend wäre, kommt eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 314 I S. 1 BGB in Betracht. Danach ist eine Kündigung auch ohne Einhaltung einer Frist zulässig, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden kann, § 314 I S. 2 BGB (siehe dazu auch BT-Drs. 14/6040, S. 178; BGH NJW 2012, 1431 f.; BGH NJW 2016, 3718, 3719).
Da aber die Parteien eigenverantwortlich einen Vertrag in Form eines Dauerschuldverhältnisses geschlossen haben und grundsätzlich daran gebunden bleiben sollen (pacta sunt servanda – dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn. 785), fällt im Allgemeinen die Abwägung nur dann zugunsten des Kündigenden aus, wenn Gründe, auf die die Kündigung gestützt werden kann, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen. Denn dann ist dessen Vertrauen in den Fortbestand des Vertrags nicht schutzbedürftig. Wird der Kündigungsgrund hingegen aus Vorgängen hergeleitet, die dem Einfluss des Kündigungsgegners entzogen sind bzw. aus der eigenen Interessensphäre des Kündigenden herrühren, rechtfertigt dies grds. keine außerordentliche Kündigung (vgl. BGH NJW 2016, 3718, 3719; AG Bremen 16.10.2014 – 10 C 47/14; AG Freiburg 23.01.2013 – 1 C 2951/12; LG Gießen 15.02.2012 – 1 S 338/11). Dies ist bspw. anzunehmen bei privaten oder beruflichen Veränderungen wie Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Unfall des Kündigenden. Aber auch hier kommt es letztlich auf die Zumutbarkeit an. Die Rechtsprechung fragt danach, welcher Partei das Festhalten am Vertrag eher zuzumuten ist (BGHZ 45, 104, 108; BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.), was durch tatrichterliche Würdigung festzustellen ist. So kann bei Fitnessstudio-Verträgen dem Nutzer eines Fitnessstudios auch bei Umständen, die in seinem Risiko- und Verantwortungsbereich liegen, die weitere Nutzung der Leistungen des Studiobetreibers bis zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit unzumutbar sein (BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.). Das ist etwa bei Eintritt einer Erkrankung der Fall, die ihm für die restliche Vertragslaufzeit die Nutzung der Einrichtungen des Fitnessstudios nicht ermöglicht (BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.).
IV. Lösung des Ausgangsfalls
Die von B geltend gemachte Zahlung der Mitgliedsbeiträge wäre berechtigt, wenn der Vertrag nach wie vor Bestand hätte. Jedoch könnten die Vertragspflichten und somit auch die Zahlungspflicht des A aufgrund der von ihm ausgesprochenen Kündigung erloschen sein. Da eine spezielle gesetzliche Kündigungsmöglichkeit nicht besteht und auch eine an sich vorrangige Anpassung des Vertrags gem. § 313 I BGB (dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn. 860) nicht zielführend wäre, kommt eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 314 I S. 1 BGB in Betracht. Danach ist eine Kündigung auch ohne Einhaltung einer Frist zulässig, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden kann, § 314 I S. 2 BGB (siehe dazu auch BT-Drs. 14/6040, S. 178; BGH NJW 2012, 1431 f.; BGH NJW 2016, 3718, 3719).
Da aber die Parteien eigenverantwortlich einen Vertrag in Form eines Dauerschuldverhältnisses geschlossen haben und grundsätzlich daran gebunden bleiben sollen (pacta sunt servanda – dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2019, Rn. 785), fällt im Allgemeinen die Abwägung nur dann zugunsten des Kündigenden aus, wenn Gründe, auf die die Kündigung gestützt werden kann, im Risikobereich des Kündigungsgegners liegen. Denn dann ist dessen Vertrauen in den Fortbestand des Vertrags nicht schutzbedürftig. Wird der Kündigungsgrund hingegen aus Vorgängen hergeleitet, die dem Einfluss des Kündigungsgegners entzogen sind bzw. aus der eigenen Interessensphäre des Kündigenden herrühren, rechtfertigt dies grds. keine außerordentliche Kündigung (vgl. BGH NJW 2016, 3718, 3719; AG Bremen 16.10.2014 – 10 C 47/14; AG Freiburg 23.01.2013 – 1 C 2951/12; LG Gießen 15.02.2012 – 1 S 338/11). Dies ist bspw. anzunehmen bei privaten oder beruflichen Veränderungen wie Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Unfall des Kündigenden. Aber auch hier kommt es letztlich auf die Zumutbarkeit an. Die Rechtsprechung fragt danach, welcher Partei das Festhalten am Vertrag eher zuzumuten ist (BGHZ 45, 104, 108; BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.), was durch tatrichterliche Würdigung festzustellen ist. So kann bei Fitnessstudio-Verträgen dem Nutzer eines Fitnessstudios auch bei Umständen, die in seinem Risiko- und Verantwortungsbereich liegen, die weitere Nutzung der Leistungen des Studiobetreibers bis zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit unzumutbar sein (BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.). Das ist etwa bei Eintritt einer Erkrankung der Fall, die ihm für die restliche Vertragslaufzeit die Nutzung der Einrichtungen des Fitnessstudios nicht ermöglicht (BGH NJW 2016, 3718, 3719; BGH NJW 2012, 1431 f.).
Nach diesen Maßstäben könnte A in der Tat wirksam gekündigt haben. So hat jedenfalls das Amtsgericht Frankenthal entschieden. Die Fortführung des Vertrags bis zum vertraglich vorgesehenen Kündigungszeitpunkt ohne Nutzungsmöglichkeit wesentlicher Elemente der vertraglichen Leistungen, nämlich des überwiegenden Teils der zur Verfügung gestellten Trainingsgeräte, sei für A nicht zumutbar, zumal es ihm nach seinen plausiblen Angaben ja gerade auf die Nutzung der Geräte zum Zwecke der Unterstützung der Oberkörpermuskulatur aufgrund der vorhandenen Vorerkrankungen angekommen sei.
Bewertung: Die Entscheidung überzeugt nicht. A hat eigenverantwortlich das Vertragsrisiko übernommen. Ihm waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seine Vorerkrankungen (insbesondere die Versteifung der Wirbelsäule und die degenerativen HWS-Veränderungen) bekannt. Auch der Möglichkeit, dass sich sein Gesundheitszustand nicht bessern, ja sogar verschlimmern könnte, konnte er sich nicht verschließen. Dass sich sein Gesundheitszustand nach Vertragsschluss sodann erheblich verschlechterte, lag daher ausschließlich in seiner Risikosphäre. Im Zweifel hätte er vor Vertragsschluss ärztlichen Rat einholen sollen, ob ein Zwei-Jahres-Vertrag in einem Fitnessstudio hilfreich wäre. Er hätte das Vertragsrisiko aber zumindest durch Abschluss eines Vertrags mit kürzerer Laufzeit verringern können (oder ganz auf den Abschluss verzichten müssen, sofern kein Vertrag mit kürzerer Laufzeit möglich gewesen wäre).
Im Ergebnis ist es für A sehr wohl zumutbar, sich an seinem Vertrag festhalten zu lassen. Da das Tatgericht den Rechtsbegriff des wichtigen Grundes unzutreffend erfasst, die Umstände des Falls fehlerhaft gewürdigt und damit auch die Risikozuordnung unrichtig vorgenommen hat, ist seine Entscheidung abzulehnen.
Rolf Schmidt (03.08.2020)
Bewertung: Die Entscheidung überzeugt nicht. A hat eigenverantwortlich das Vertragsrisiko übernommen. Ihm waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seine Vorerkrankungen (insbesondere die Versteifung der Wirbelsäule und die degenerativen HWS-Veränderungen) bekannt. Auch der Möglichkeit, dass sich sein Gesundheitszustand nicht bessern, ja sogar verschlimmern könnte, konnte er sich nicht verschließen. Dass sich sein Gesundheitszustand nach Vertragsschluss sodann erheblich verschlechterte, lag daher ausschließlich in seiner Risikosphäre. Im Zweifel hätte er vor Vertragsschluss ärztlichen Rat einholen sollen, ob ein Zwei-Jahres-Vertrag in einem Fitnessstudio hilfreich wäre. Er hätte das Vertragsrisiko aber zumindest durch Abschluss eines Vertrags mit kürzerer Laufzeit verringern können (oder ganz auf den Abschluss verzichten müssen, sofern kein Vertrag mit kürzerer Laufzeit möglich gewesen wäre).
Im Ergebnis ist es für A sehr wohl zumutbar, sich an seinem Vertrag festhalten zu lassen. Da das Tatgericht den Rechtsbegriff des wichtigen Grundes unzutreffend erfasst, die Umstände des Falls fehlerhaft gewürdigt und damit auch die Risikozuordnung unrichtig vorgenommen hat, ist seine Entscheidung abzulehnen.
Rolf Schmidt (03.08.2020)
01.08.2020: Zur Frage nach Schadensersatzansprüchen im Diesel-Abgasskandal
BGH, Urteile v. 30.07.2020 – VI ZR 354/19, VI ZR 367/19, VI ZR 397/19 und VI ZR 5/20
Nachdem der u.a. für unerlaubte Handlungen zuständige VI. Zivilsenat des BGH bereits am 25.5.2020 in einem Grundsatzurteil zum VW-Diesel-Abgasskandal die Haftung des Konzerns aus § 826 BGB dem Grunde nach bejaht hatte (BGH 25.05.2020 – VI ZR 252/19; NJW 2020, 1962), ging es mit den vier Urteilen v. 30.07.2020 (VI ZR 354/19, VI ZR 367/19, VI 397/19 und VI ZR 5/20) um einzelne Schadensersatzpositionen. Es ging um folgende Sachverhalte und Fragestellungen:
I. Sachverhalte und Fragestellungen
Den vier Urteilen lagen folgende Sachverhalte und Fragestellungen zugrunde (siehe Pressemitteilungen v. 30.07.2020):
Ansprüche auf Schadensersatz können sich auf vertraglicher oder deliktischer Basis ergeben. Stehen Schädiger und Geschädigter in einer vertraglichen (oder quasivertraglichen bzw. vorvertraglichen) Beziehung, greifen als Anspruchsgrundlagen die §§ 280 ff. BGB (die ggf. über verschiedene Normen des Vertragsrechts zur Anwendung gelangen, wie das z.B. für das Kaufvertragsrecht bei § 437 Nr. 3 Var. 1 BGB der Fall ist). Daneben kommen auch deliktische Schadensersatzansprüche (Ansprüche aus unerlaubter Handlung) in Betracht, wenn der Schädiger einen der Tatbestände der §§ 823 ff. BGB (oder einen der zahlreichen spezialgesetzlichen Tatbestände) verwirklicht. Deliktische Schadensersatzansprüche sind aber alleinige Grundlage, wenn es an einer vertraglichen oder quasivertraglichen (insb. vorvertraglichen) Rechtsbeziehung fehlt. Was heißt dies nun für die vorliegend zu besprechenden Fälle?
Aber auch die Ansprüche aus unerlaubter Handlung könnten mitunter verjährt sein. Denn Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren – von Sonderfällen (wie z.B. § 199 II BGB) abgesehen – gem. § 195 BGB nach 3 Jahren; Fristbeginn war bzw. ist gem. § 199 I BGB der Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
BGH, Urteile v. 30.07.2020 – VI ZR 354/19, VI ZR 367/19, VI ZR 397/19 und VI ZR 5/20
Nachdem der u.a. für unerlaubte Handlungen zuständige VI. Zivilsenat des BGH bereits am 25.5.2020 in einem Grundsatzurteil zum VW-Diesel-Abgasskandal die Haftung des Konzerns aus § 826 BGB dem Grunde nach bejaht hatte (BGH 25.05.2020 – VI ZR 252/19; NJW 2020, 1962), ging es mit den vier Urteilen v. 30.07.2020 (VI ZR 354/19, VI ZR 367/19, VI 397/19 und VI ZR 5/20) um einzelne Schadensersatzpositionen. Es ging um folgende Sachverhalte und Fragestellungen:
I. Sachverhalte und Fragestellungen
Den vier Urteilen lagen folgende Sachverhalte und Fragestellungen zugrunde (siehe Pressemitteilungen v. 30.07.2020):
- Verfahren VI ZR 367/19: „Der Kläger erwarb am 4. April 2013 von einem Autohaus einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten PKW VW Tiguan 2.0 TDI zu einem Preis von 21.500 €. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor des Typs EA 189, Schadstoffnorm Euro 5, ausgestattet. Die das Abgasrückführungsventil steuernde Software des Motorsteuerungsgeräts erkannte, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand im Testbetrieb befindet, und schaltete in diesem Falle in einen Stickoxid-optimierten Modus. Es ergaben sich dadurch auf dem Prüfstand geringere Stickoxid-Emissionswerte als im normalen Fahrbetrieb. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Norm wurden nur auf dem Prüfstand eingehalten. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erkannte in der genannten Software eine unzulässige Abschalteinrichtung und ordnete Mitte Oktober 2015 einen Rückruf an, der auch das Fahrzeug des Klägers betraf. Die Beklagte entwickelte daraufhin ein Software-Update, das das KBA als geeignet zur Herstellung der Vorschriftsmäßigkeit auch des hier streitgegenständlichen Fahrzeugtyps ansah. Der Kläger ließ das Software-Update im Februar 2017 durchführen. Mit seiner Klage begehrt der Kläger im Wesentlichen Ersatz des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises Zug um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs.“ Der BGH hatte damit folgende Frage zu klären: Stehen geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung (§ 826 BGB) Ansprüche auf Schadensersatz zu?
- Verfahren VI ZR 354/19: „Mit seiner Klage begehrt der Kläger im Wesentlichen Ersatz des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises Zug um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs.“ Die vom BGH zu klärende Frage lautete: Können Nutzungsvorteile einen Schadensersatzanspruch vollständig aufzehren?
- Verfahren VI ZR 397/19: „Die Klägerin erwarb im August 2014 von einem Autohändler einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten Pkw Golf VI 1,6 TDI mit einer Laufleistung von rund 23.000 km zu einem Preis von 15.888 €. Das Fahrzeug war mit einem Dieselmotor des Typs EA189 ausgestattet, der mit einer Steuerungssoftware versehen war, die erkennt, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand im Testbetrieb befindet, und in diesem Fall in einen Stickoxid (NOx) optimierten Modus schaltet. Nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt die Programmierung als unzulässige Abschalteinrichtung beanstandet und die Beklagte verpflichtet hatte, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, ließ die Klägerin das von der Beklagten entwickelte Software-Update im Jahr 2017 aufspielen. Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin im Wesentlichen Ersatz des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises nebst Zinsen ab Kaufpreiszahlung Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs.“ Hier hatte der BGH zu klären: Stehen geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt sog. Deliktszinsen (§ 849 BGB) Ansprüche auf Verzinsung des für das Fahrzeug bezahlten Kaufpreises (bereits ab Kaufpreiszahlung) zu?
- Verfahren VI ZR 5/20: „Der Kläger erwarb im August 2016 von einem Autohändler einen gebrauchten VW Touran Match zu einem Kaufpreis von 13.600 €, der mit einem 2,0-Liter-Dieselmotor des Typs EA189, Schadstoffnorm Euro 5, ausgestattet ist. Die Beklagte ist Herstellerin des Wagens. Der Motor war mit einer Software versehen, die erkennt, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand im Testbetrieb befindet, und in diesem Fall in einen Stickoxid-optimierten Modus schaltet. Es ergaben sich dadurch auf dem Prüfstand geringere Stickoxid-Emissionswerte als im normalen Fahrbetrieb. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Norm wurden nur auf dem Prüfstand eingehalten. Vor dem Erwerb des Fahrzeugs, am 22. September 2015, hatte die Beklagte in einer Pressemitteilung die Öffentlichkeit über Unregelmäßigkeiten der verwendeten Software bei Dieselmotoren vom Typ EA189 informiert und mitgeteilt, dass sie daran arbeite, die Abweichungen zwischen Prüfstandswerten und realem Fahrbetrieb mit technischen Maßnahmen zu beseitigen, und dass sie hierzu mit dem Kraftfahrt-Bundesamt in Kontakt stehe. Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte im Oktober 2015 nachträgliche Nebenbestimmungen zur Typgenehmigung erlassen und der Beklagten aufgegeben, die Vorschriftsmäßigkeit der bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeuge zu gewährleisten. In der Folge hat die Beklagte bei Fahrzeugen mit dem betroffenen Motortyp ein Software-Update bereitgestellt, das nach August 2016 auch bei dem Fahrzeug des Klägers aufgespielt wurde. Das Thema war Gegenstand einer umfangreichen und wiederholten Berichterstattung in Presse, Funk und Fernsehen. Mit seiner Klage verlangt der Kläger im Wesentlichen Ersatz des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs.“ Hierbei ging es also um die Frage: Stehen Käufern von mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Gebrauchtwagen auch dann Schadensersatzansprüche zu, wenn der Kauf erst nach Bekanntwerden des sog. Dieselskandals getätigt wurde?
Ansprüche auf Schadensersatz können sich auf vertraglicher oder deliktischer Basis ergeben. Stehen Schädiger und Geschädigter in einer vertraglichen (oder quasivertraglichen bzw. vorvertraglichen) Beziehung, greifen als Anspruchsgrundlagen die §§ 280 ff. BGB (die ggf. über verschiedene Normen des Vertragsrechts zur Anwendung gelangen, wie das z.B. für das Kaufvertragsrecht bei § 437 Nr. 3 Var. 1 BGB der Fall ist). Daneben kommen auch deliktische Schadensersatzansprüche (Ansprüche aus unerlaubter Handlung) in Betracht, wenn der Schädiger einen der Tatbestände der §§ 823 ff. BGB (oder einen der zahlreichen spezialgesetzlichen Tatbestände) verwirklicht. Deliktische Schadensersatzansprüche sind aber alleinige Grundlage, wenn es an einer vertraglichen oder quasivertraglichen (insb. vorvertraglichen) Rechtsbeziehung fehlt. Was heißt dies nun für die vorliegend zu besprechenden Fälle?
- Ist ein Fahrzeug mangelhaft i.S.d. § 434 BGB, stehen dem Käufer die in § 437 BGB genannten Rechte (und damit auch ein Schadensersatzanspruch gem. § 437 Nr. 3 Var. 1 BGB) zu – allerdings nur gegenüber dem Verkäufer und unter ganz bestimmten Voraussetzungen wie insb. dem Vertretenmüssen (siehe § 280 I S. 2 BGB), woran es im Dieselabgasskandal regelmäßig fehlte, da die Händler – jedenfalls vor Bekanntwerden des Skandals – weder Kenntnis von den Manipulationen hatten noch Kenntnis hätten haben können (siehe § 276 BGB). Auch die kurzen Verjährungsfristen (siehe § 438 I Nr. 3 BGB: zwei Jahre ab Ablieferung der Sache, § 438 II Halbs. 2 BGB; bei Gebrauchtwagen – von der möglichen Unionsrechtswidrigkeit des § 476 II BGB einmal abgesehen – regelmäßig auf ein Jahr verkürzt, § 476 II BGB) können mitunter einem vertraglichen Schadensersatzanspruch entgegenstehen (außer natürlich, es kommt zu einer freiwilligen Verlängerung der Verjährungsfristen). Schließlich ist die Gefahr einer Insolvenz des Verkäufers gegeben, wenn allzu viele geschädigte Kunden ihre Schadensersatzansprüche (bzw. Rücktrittsrechte) geltend machen.
- Daher erschien bzw. erscheint es sinnvoller, mitunter auch allein gangbar, im Hinblick auf Schadensersatzansprüche (auch) gegen den Hersteller, die Volkswagen AG, vorzugehen. In Ermangelung eines Vertragsverhältnisses bzw. einer vertragsähnlichen Beziehung greifen dann lediglich (aber immerhin) deliktische Ansprüche. Aber auch dieser Weg erweist sich mitunter als schwierig, wie die vielen (teilweise widersprüchlichen) Entscheidungen der Instanzgerichte zeigen. Systematisch aufgearbeitet, ergibt sich Folgendes:
- Ein Schadensersatzanspruch aus § 823 I BGB scheidet von vornherein aus, da es an einer Rechtsgutverletzung fehlt: Die geschädigten Käufer erwarben bereits mangelhaftes Eigentum; reine Vermögensschäden sind zudem nicht von § 823 I BGB erfasst.
- Der denkbare Schadensersatzanspruch aus § 823 II BGB
hat seine Ursache darin, dass Mitarbeiter des Herstellers eine illegale Abschaltvorrichtung installiert bzw. programmiert haben, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs führen kann. Es darf unterstellt werden, dass die Käufer bei Kenntnis dieses Umstands den Wagen nicht oder nicht zu dem Preis gekauft hätten (Kausalität). Auch ein von § 823 II BGB erfasster Vermögensschaden ist gegeben: Dadurch, dass die Käufer einen Vertrag über ein mangelfreies Fahrzeug abgeschlossen hatten, jedoch mangelhafte Fahrzeuge erhielten, die sowohl einen technischen (höherer Verbrauch, geringere Leistung, ggf. geringere Lebenserwartung) als auch wirtschaftlichen (Anhaftung des Makels des „Dieselskandals“) Minderwert haben, liegt ein Schaden vor. Es müsste aber auch ein Schutzgesetz verletzt worden sein (siehe Wortlaut des § 823 II BGB: „gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt“). Das Schutzgesetz kann in § 263 StGB
(Betrug) gesehen werden. Jedoch ist zu beachten, dass juristische Personen zwar rechtsfähig, nicht aber handlungsfähig (und nicht schuldfähig) sind. Ginge es um eine zivilrechtliche Haftung, würde die Haftungspflicht der juristischen Person über § 31 BGB
begründet. Denn dadurch, dass juristische Personen (siehe § 1 I S. 1 AktG für die AG und § 13 I GmbHG für die GmbH) zwar rechtsfähig sind, nicht aber handlungsfähig, bedarf es einer Zurechnung bzw. Zuweisung des Verhaltens natürlicher Personen. Bei juristischen Personen nimmt dies bei der Frage nach einer zivilrechtlichen Haftung § 31 BGB vor. Jedoch ist es trotz der Zuweisungsnorm des § 31 BGB nicht möglich, die strafrechtliche Betrugshandlung der X-AG zuzuweisen. Denn nach der geltenden Strafrechtsdogmatik können nur natürliche Personen Straftatbestände erfüllen, nicht auch juristische Personen; ein Unternehmensstrafrecht ist (noch) nicht Gesetz. Daher kann man auch nicht sagen, die X-AG habe § 263 StGB verwirklicht. Insbesondere aus diesem Grund ist daher eine Haftung aus § 823 II BGB i.V.m. § 263 StGB wohl nicht möglich. § 823 II BGB i.V.m. § 263 StGB wurde von den Zivilgerichten auch nicht angewendet, weil sich – soweit ersichtlich – die Klageschriften auch nicht darauf stützten. Nach § 308 I S. 1 ZPO wären die Gerichte ohnehin nicht befugt gewesen, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist (Bindung des Gerichts an Sachanträge). Dass die Kläger ihre Klagen nicht auf § 823 II BGB i.V.m. § 263 StGB gestützt haben, mag an dem fehlenden Unternehmensstrafrecht gelegen haben oder auch daran, dass sie wohl erst den Ausgang der strafrechtlichen Verfahren abwarten wollten, gerade auch mit Blick auf die dann vorliegenden staatsanwaltlichen Ermittlungsergebnisse zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 263 StGB.
- § 831 I S. 1 BGB
(der eine eigenständige Anspruchsgrundlage darstellt) ist ebenfalls nicht zielführend. Denn danach müsste es sich bei den die unerlaubte Handlung vornehmenden Personen um sog. Verrichtungsgehilfen gehandelt haben. Nach allgemeiner Auffassung ist Verrichtungsgehilfe, wer vom Geschäftsherrn in dessen Interesse eine Tätigkeit übertragen bekommen hat und von Weisungen des Geschäftsherrn abhängig ist (BGHZ 45, 311, 313; 103, 298, 303; BGH NJW 2013, 1002, 1003; Sprau, in: Palandt, § 831 Rn 6). Die in der Entwicklungsabteilung tätigen Mitarbeiter, die die Programmierung vorgenommen haben, kann man danach sicherlich als Verrichtungsgehilfen ansehen, da sie die Softwareprogrammierung auf Anweisung hin vorgenommen haben dürften. Ob aber die Volkswagen AG dieses Verhalten über § 831 I S. 1 BGB wie eigenes Verschulden zu verantworten hat, ist angesichts der Exkulpationsmöglichkeit nach § 831 I S. 2 BGB zweifelhaft; zwar erscheint es unangemessen, sich auf eine Exkulpationsregel zu stützen, wenn man gerade die Anweisung zur unerlaubten Handlung gegeben hat. Streng genommen aber liegt der Entlastungsbeweis vor: Dadurch, dass die Programmierer genau das taten, wozu sie angewiesen worden waren, liegt eine Pflichtverletzung des Vorstands oder der Abteilungsleitung bei der Aufsicht nicht vor. Hingegen sind Vorstände als Organe der juristischen Person schon keine Verrichtungsgehilfen, sodass eine Haftung der Volkswagen AG aus § 831 I S. 1 BGB insoweit ausscheidet. Es bliebe aber ein Abstellen auf die Zuweisungsnorm des § 31 BGB, da man davon ausgehen muss, dass ein Fehlverhalten dieses Ausmaßes sich nicht ohne Kenntnis und Billigung von Vorstandsmitgliedern zutragen konnte. Die Zuweisung des Fehlverhaltens des Vorstands über § 31 BGB betrifft aber nicht die Haftung aus § 831 I S. 1 BGB (da, wie gesagt, Vorstände keine Verrichtungsgehilfen sind), sondern diejenige aus §§ 823 I, 823 II und 826 BGB.
- Wohl aus den genannten Gründen sowie wegen der weiter reichenden und flexibleren Rechtsfolgen (dazu sogleich sowie Punkt IV.) leiten die Instanzgerichte (siehe etwa OLG Düsseldorf 30.1.2020 – I-13 U 81/19; OLG Karlsruhe 6.11.2019 – 13 U 37/19, 13 U 12/19; OLG Stuttgart 26.11.2019 – 10 U 154/19; OLG Celle 20.11.2019 – 7 U 244/18; OLG Koblenz 16.9.2019 – 12 U 61/19; OLG Oldenburg 21.10.2019 – 13 U 73/19; OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19; LG Kiel 18.5.2018 – 12 O 371/17; OLG Köln MDR 2019, 222 f.; LG Erfurt 18.1.2019 – 9 O 490/18) – und nunmehr auch der BGH (NJW 2020, 1962, 1966) – Schadensersatzansprüche über § 826 BGB her und stellen dabei auf das schädigende Verhalten des Vorstands ab (§ 31 BGB). Denn dadurch, dass juristische Personen (siehe § 1 I S. 1 AktG für die AG und § 13 I GmbHG für die GmbH) zwar rechtsfähig sind, nicht aber handlungsfähig, bedarf es einer Zurechnung bzw. Zuweisung des Verhaltens natürlicher Personen. Bei juristischen Personen nimmt dies § 31 BGB vor. Zwar ist danach lediglich der Verein für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausübung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt. § 31 BGB gilt aber für alle juristischen Personen (allg. Auffassung), und damit (unmittelbar) auch für die Volkswagen AG. Abzustellen ist also zunächst auf den Vorstand oder ein Vorstandsmitglied. Sofern dies nicht möglich ist (etwa, weil der Beweis einer entsprechenden Handlung nicht erbracht werden kann), ist zu prüfen, ob das Verhalten eines anderen verfassungsmäßig berufenen Vertreters zugewiesen werden kann. Die Mitarbeiter, die die Programmierung vorgenommen haben, kann man wohl nicht als „verfassungsmäßige Vertreter“ ansehen, möglicherweise aber die Leitung der Entwicklungsabteilung, in der die Softwaremanipulation vorgenommen wurde. Der BGH beanstandete es in seinem Urteil v. 25.5.2020 nicht, dass das Berufungsgericht es als erwiesen angesehen hatte, der Leiter der Entwicklungsabteilung habe Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung gehabt und diese gebilligt (BGH NJW 2020, 1962, 1966). Der Leiter der Entwicklungsabteilung eines großen, weltweit tätigen Automobilherstellers wie der Volkswagen AG habe eine für dessen Kerngeschäft verantwortliche, in besonderer Weise herausgehobene Position als Führungskraft inne. Daraus folge unmittelbar, dass ihm bedeutsame, wesensmäßige Funktionen des Unternehmens zur selbstständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen seien, er also das Unternehmen auf diese Weise repräsentiere (BGH NJW 2020, 1962, 1966).
- Der Vorteil, den Schadensersatzanspruch über § 826 BGB geltend zu machen, besteht darin, dass die Norm weder eine Rechtsgutverletzung noch den Verstoß gegen ein Schutzgesetz verlangt, sondern schlicht das Vermögen schützt (siehe BGHZ 160, 149, 153). Dabei beschränkt sich der Schutz nicht auf nachteilige Einwirkungen auf die Vermögenslage, sondern erstreckt sich auf „jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses und jede Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung“ (BGHZ 160, 149, 153 mit Verweis auf Wagner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 4. Auflage, § 826 Rn. 6 m.w.N.). Auch der BGH hat im Urteil zum Dieselabgasskandal entschieden: „... muss sich der Geschädigte auch von einer auf dem sittenwidrigen Verhalten beruhenden Belastung mit einer „ungewollten“ Verpflichtung wieder befreien können. Schon eine solche stellt unter den dargelegten Voraussetzungen einen gem. § 826 BGB zu ersetzenden Schaden dar“ (BGH NJW 2020, 1962, 1968). Diese Erkenntnis ist sehr bedeutsam, denn schützt § 826 BGB auch vor einer „ungewollten Verpflichtung“, kann das im Rahmen der nach § 249 I BGB vom Schädiger vorzunehmenden Naturalrestitution
zu einer (Rück-)Zahlung
des für das bemakelte Fahrzeug gezahlten Kaufpreises
(Zug um Zug gegen dessen Rückgabe) führen (BGH NJW 2020, 1962, 1969).
Aber auch die Ansprüche aus unerlaubter Handlung könnten mitunter verjährt sein. Denn Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren – von Sonderfällen (wie z.B. § 199 II BGB) abgesehen – gem. § 195 BGB nach 3 Jahren; Fristbeginn war bzw. ist gem. § 199 I BGB der Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
- Stellt man also darauf ab, dass die geschädigten Kunden bereits durch die Veröffentlichung des Dieselskandals 2015 informiert waren oder sich hätten informieren können, trat Verjährung zum 31.12.2018 ein. Später geltend gemachte Ansprüche sind nicht mehr durchsetzbar (das nahm z.B. das OLG München in seinem Hinweisbeschl. v. 03.12.2019 – 20 U 5741/19 an).
- Es ist aber auch denkbar, auf den Erhalt der VW-Betroffenheitsmitteilung bzw. des KBA-Rückrufschreibens abzustellen. Da diese in Bezug auf die EA189-Motoren im Jahre 2016 zugestellt wurden, hätte diese Auffassung eine Verjährung zum 31.12.2019 zur Folge (so z.B. vertreten von OLG Oldenburg 30.01.2020 – 1 U 131/19; MDR 2020, 671). Das gilt nach OLG Frankfurt 25.07.2019 – 1 U 169/18 (NJW-RR 2019, 1451-1453) auch dann, wenn die Rechtslage (noch) unklar ist, wenn also im VW-Abgasskandal noch keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt, d.h. die OLG-Urteile differieren. Allerdings hatte der BGH bereits im Jahr 2008 entschieden, dass der Beginn der Verjährungsfrist gem. § 199 I BGB in Fällen unsicherer und zweifelhafter Rechtslage ausnahmsweise wegen der Rechtsunkenntnis des Gläubigers hinausgeschoben sei. Danach beginne die Verjährung erst mit der objektiven Klärung der Rechtslage (BGH 23.09.2008 – XI ZR 262/07; NJW-RR 2009, 547). Da sich erst im Jahre 2017 hinsichtlich des EA189-Motors eine OLG-Linie durchsetzte, würde hiernach die Verjährungsfrist bis zum 31.12.2020 laufen. Geht man sogar davon aus, dass eine „gefestigte Rechtsprechung“ erst nach Klärung der Rechtslage durch eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt und eine solche mit BGH-Urteil v. 25.05.2020 (NJW 2020, 1962) getroffen wurde, hätte die Verjährungsfrist noch nicht einmal zu laufen begonnen (davon ging LG Trier mit Urteil vom 19.09.2019 – 5 O 417/18 aus). Die Verjährungsfrist begänne danach also erst am 01.01.2021 und endete am 31.12.2023.
- Auch wird die Ansicht vertreten, bei verjährtem Anspruch aufgrund § 199 BGB bestehe ein Restschadensersatzanspruch nach § 852 S. 1 BGB (Augenhofer, VuR 2019, 83, 86), was jedoch mit Blick auf den Wortlaut der Norm nicht gerade naheliegt. Denn bei dieser Vorschrift geht es nicht um Schadensersatz, sondern um die bereicherungsrechtliche Herausgabe eines vermögensrechtlich Erlangten. Zweck der Vorschrift ist der Ausgleich einer durch unerlaubte Handlung erzielten Vermögensmehrung, und zwar auch dann, wenn ein Schadensersatzanspruch verjährt ist; ungerechtfertigte Vermögenszuwächse sollen nicht beim Schädiger verbleiben dürfen. Da die h.M. den Anwendungsbereich des § 852 BGB jedoch sehr weit versteht, sind auch Fälle erfasst, bei denen es an sich um Schadensersatzansprüche geht, die als solche verjährt sind. Die Verjährung von Ansprüchen aus § 852 S. 1 BGB tritt gem. § 852 S. 2 BGB (ähnlich § 199 III S. 1 Nr. 1 und 2 BGB) demgegenüber erst in zehn Jahren von ihrer Entstehung an ein, ohne Rücksicht auf die Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. In der Folge besteht danach also ein Schadensersatzanspruch, der in seinem Umfang lediglich auf die ungerechtfertigte Bereicherung begrenzt ist, die der Schädiger durch seine unerlaubte Handlung erlangt hat (siehe Sprau, in: Palandt, § 852 BGB Rn. 2). Daraus wird klar, warum der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB als „Restschadensersatzanspruch“ bezeichnet wird. Da die ansonsten geltende Begrenzung des Herausgabeanspruchs auf das noch im Vermögen des Bereicherungsschuldners Befindliche (§ 818 III BGB) wegen §§ 818 IV, 819 I BGB jedoch bei einer unerlaubten Handlung nicht gilt, bedeutet die Anwendung des § 852 S. 1 BGB in den Dieselabgas-Fällen letztlich nichts anderes als ein voller Schadensersatzanspruch mit den großzügigen Verjährungsfristen des § 852 S. 2 BGB. Freilich ist damit in gewisser Weise eine Umgehung der Verjährungsfristen der unerlaubten Handlung verbunden.
- Auf all dies kommt es im Fall der möglicherweise noch offenen Verjährungsfrist jedoch nicht an, da der BGH in seinem Urteil VI ZR 5/20 v. 30.07.2020 bereits den Tatbestand des § 826 BGB verneint hat. Er hat entschieden, dass ein Käufer, der einen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Gebrauchtwagen erst nach Bekanntwerden des sog. Dieselskandals gekauft hat, sich nicht auf ein sittenwidriges Verhalten des Herstellers berufen kann (dazu später). Das heißt also: Liegt bereits der haftungsbegründende Tatbestand des § 826 BGB nicht vor, kommt es auf eine etwaige Verjährung des Anspruchs aus unerlaubter Handlung (und der möglicherweise zu weit ausgelegten Haftung nach § 852 S. 1 BGB) nicht an. Im Einzelnen gilt:
Nach § 826 BGB macht sich schadensersatzpflichtig, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen einen Schaden zufügt. Bei einer juristischen Person ist (wegen fehlender Handlungsfähigkeit) erforderlich, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter i.S.d. § 31 BGB den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht hat (BGH NJW 2017, 250, 251 m.w.N.). Damit ist das Prüfprogramm vorgegeben:
Nach allgemeiner Auffassung, die auch der BGH in seinem Grundsatzurteil zum sog. Dieselabgasskandal v. 25.5.2020 (VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962, 1963) noch einmal bestätigt hat, ist ein Verhalten objektiv sittenwidrig, „das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt“. Ausschlaggebend sei eine besondere Verwerflichkeit, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben könne (BGH NJW 2020, 1962, 1963 mit Verweis auf die st. Rspr.).
Wie der BGH in seinem Urteil v. 25.5.2020 entschieden hat, hat die Volkswagen AG auf der Grundlage einer für ihren Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung im eigenen Kosten- und damit auch Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täuschung des KBA systematisch, langjährig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA189 in siebenstelligen Stückzahlen in Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden (BGH NJW 2020, 1962, 1963). Damit sei einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einhergegangen, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung (siehe § 5 FZV) hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein solches Verhalten sei im Verhältnis zu einer Person, die eines der bemakelten Fahrzeuge in Unkenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwerbe, besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren. Das gelte auch, wenn es sich um den Erwerb eines Gebrauchtfahrzeugs handele. Die Sittenwidrigkeit ergebe sich aus einer Gesamtschau des festgestellten Verhaltens unter Berücksichtigung des verfolgten Ziels, der eingesetzten Mittel, der zutage getretenen Gesinnung und der eingetretenen Folgen (BGH NJW 2020, 1962, 1963).
Subjektive Sittenwidrigkeit liegt vor, wenn der Handelnde die Umstände kennt, die sein Verhalten als sittenwidrig erscheinen lassen (Sprau, in: Palandt, § 826 BGB, Rn. 8). Wie ausgeführt, ist bei juristischen Personen hinsichtlich der Sittenwidrigkeit auf das Verhalten des handelnden verfassungsmäßig berufenen Vertreters i.S.d. § 31 BGB abzustellen, wobei es sich – anders als der BGH meint (BGH NJW 2017, 250, 251) – bei § 31 BGB nicht um eine Zurechnungsnorm, sondern um eine Zuweisungsnorm handelt (siehe dazu die Instanzgerichte zum Dieselabgasskandal, etwa OLG Düsseldorf 30.1.2020 – I-13 U 81/19; OLG Karlsruhe 6.11.2019 – 13 U 37/19, 13 U 12/19; OLG Stuttgart 26.11.2019 – 10 U 154/19; OLG Celle 20.11.2019 – 7 U 244/18; OLG Koblenz 16.9.2019 – 12 U 61/19; OLG Oldenburg 21.10.2019 – 13 U 73/19; OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19; LG Kiel 18.5.2018 – 12 O 371/17; OLG Köln MDR 2019, 222 f.; LG Erfurt 18.1.2019 – 9 O 490/18; siehe auch Heese, NJW 2019, 257 ff.).
Der BGH sieht es als bewiesen an, dass die grundlegende strategische Entscheidung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software von den im Hause der Volkswagen AG für die Motorenentwicklung verantwortlichen Personen, namentlich dem vormaligen Leiter der Entwicklungsabteilung und den für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verantwortlichen vormaligen Vorständen, wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und Billigung getroffen bzw. jahrelang umgesetzt worden ist. Dieses Verhalten sei der Volkswagen AG gem. § 31 BGB zuzurechnen (BGH NJW 2020, 1962, 1963). Ob sich an dieser Beurteilung etwas ändert, wenn ein Käufer in Kenntnis (oder bei fahrlässiger Unkenntnis) der Manipulation einen betroffenen Wagen kauft, ist Gegenstand der Ausführungen bei Punkt V und VI.
- Sittenwidrigkeit (objektiv und subjektiv); bei juristischen Personen abzustellen auf das Verhalten des verfassungsmäßig berufenen Vertreters i.S.d. § 31 BGB
- Schadenszufügung (objektiv)
- Vorsatz in Bezug auf die Schadenszufügung (subjektiv); bei juristischen Personen abzustellen auf das Verhalten des verfassungsmäßig berufenen Vertreters i.S.d. § 31 BGB
- Rechtsfolge: Schadensersatz
Nach allgemeiner Auffassung, die auch der BGH in seinem Grundsatzurteil zum sog. Dieselabgasskandal v. 25.5.2020 (VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962, 1963) noch einmal bestätigt hat, ist ein Verhalten objektiv sittenwidrig, „das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt“. Ausschlaggebend sei eine besondere Verwerflichkeit, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben könne (BGH NJW 2020, 1962, 1963 mit Verweis auf die st. Rspr.).
Wie der BGH in seinem Urteil v. 25.5.2020 entschieden hat, hat die Volkswagen AG auf der Grundlage einer für ihren Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung im eigenen Kosten- und damit auch Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täuschung des KBA systematisch, langjährig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA189 in siebenstelligen Stückzahlen in Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden (BGH NJW 2020, 1962, 1963). Damit sei einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einhergegangen, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung (siehe § 5 FZV) hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein solches Verhalten sei im Verhältnis zu einer Person, die eines der bemakelten Fahrzeuge in Unkenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwerbe, besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren. Das gelte auch, wenn es sich um den Erwerb eines Gebrauchtfahrzeugs handele. Die Sittenwidrigkeit ergebe sich aus einer Gesamtschau des festgestellten Verhaltens unter Berücksichtigung des verfolgten Ziels, der eingesetzten Mittel, der zutage getretenen Gesinnung und der eingetretenen Folgen (BGH NJW 2020, 1962, 1963).
Subjektive Sittenwidrigkeit liegt vor, wenn der Handelnde die Umstände kennt, die sein Verhalten als sittenwidrig erscheinen lassen (Sprau, in: Palandt, § 826 BGB, Rn. 8). Wie ausgeführt, ist bei juristischen Personen hinsichtlich der Sittenwidrigkeit auf das Verhalten des handelnden verfassungsmäßig berufenen Vertreters i.S.d. § 31 BGB abzustellen, wobei es sich – anders als der BGH meint (BGH NJW 2017, 250, 251) – bei § 31 BGB nicht um eine Zurechnungsnorm, sondern um eine Zuweisungsnorm handelt (siehe dazu die Instanzgerichte zum Dieselabgasskandal, etwa OLG Düsseldorf 30.1.2020 – I-13 U 81/19; OLG Karlsruhe 6.11.2019 – 13 U 37/19, 13 U 12/19; OLG Stuttgart 26.11.2019 – 10 U 154/19; OLG Celle 20.11.2019 – 7 U 244/18; OLG Koblenz 16.9.2019 – 12 U 61/19; OLG Oldenburg 21.10.2019 – 13 U 73/19; OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19; LG Kiel 18.5.2018 – 12 O 371/17; OLG Köln MDR 2019, 222 f.; LG Erfurt 18.1.2019 – 9 O 490/18; siehe auch Heese, NJW 2019, 257 ff.).
Der BGH sieht es als bewiesen an, dass die grundlegende strategische Entscheidung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software von den im Hause der Volkswagen AG für die Motorenentwicklung verantwortlichen Personen, namentlich dem vormaligen Leiter der Entwicklungsabteilung und den für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verantwortlichen vormaligen Vorständen, wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und Billigung getroffen bzw. jahrelang umgesetzt worden ist. Dieses Verhalten sei der Volkswagen AG gem. § 31 BGB zuzurechnen (BGH NJW 2020, 1962, 1963). Ob sich an dieser Beurteilung etwas ändert, wenn ein Käufer in Kenntnis (oder bei fahrlässiger Unkenntnis) der Manipulation einen betroffenen Wagen kauft, ist Gegenstand der Ausführungen bei Punkt V und VI.
Anm.: Der Einbau eines „Thermofensters“ in ein Dieselfahrzeug, der dafür sorgt, dass die Abgasrückführung bei geringeren Außen-/Ladelufttemperaturen zurückgefahren wird (um Schäden an der Abgasreinigungsanlage zu vermeiden), ist nach OLG Koblenz (21.10.2019 – 12 U 246/19) nicht per se als sittenwidrige Handlung einzustufen, da es sich anders als beim Einbau einer „Schummelsoftware“ nicht um eine eindeutig unzulässige Abschalteinrichtung handele. In diese Richtung geht auch OLG Brandenburg 19.12.2019 – 5 U 103/18, das festgestellt hat, die Abschalteinrichtung funktioniere im normalen Fahrbetrieb in gleicher Weise wie auf dem Prüfstand. Um bei dieser Konstellation und dem Einwand der Beklagten, dass die Einrichtung dem Schutz des Motors diene, davon ausgehen zu können, die Einrichtung sei in dem Bewusstsein eingebaut worden, dass sie unzulässig und nicht genehmigungsfähig sei, müssten konkrete Umstände vorliegen, die auf einen solchen Vorsatz des Herstellers hinwiesen. Anders als bei einer Umschaltlogik, die nur auf dem Prüfstand aktiviert werde, lasse die Beschränkung der Funktion außerhalb eines Thermofensters nicht bereits den Schluss zu, dass der Hersteller Kunden bewusst geschädigt habe. Die Typengenehmigungsvorschriften ließen im Interesse des Motorschutzes Abschalteinrichtungen zu und seien nicht eindeutig. Dem Hersteller könne ein bewusster Verstoß gegen die Regelungen daher nicht ohne konkrete Anhaltspunkte unterstellt werden.
2. Schadenszufügung
Unabhängig davon, ob die Fahrzeuge durch die verwendete Software einen Wertverlust erlitten haben oder nicht, begründet nach Auffassung des BGH allein die fehlende Konformität mit den gesetzlichen Abgasbestimmungen den Schaden (BGH NJW 2020, 1962, 1963). Das ist nicht ganz unproblematisch. Denn kann z.B. kein abgasmanipulationsbedingter Wertverlust angenommen werden, ist die Annahme eines Schadens schwierig – so im Fall OLG Schleswig 22.11.2019 – 17 U 70/19, das einen Schadensersatzanspruch gegen den Hersteller verneinte, weil der Wagen ohne (abgasmanipulationsbedingten) Verlust weiterveräußert worden war. Dem ist zuzustimmen. Die Bejahung eines Schadensersatzanspruchs widerspräche dem Grundsatz des schadensersatzrechtlichen Bereicherungsverbots (Verbot einer Überkompensation). Daran ändert auch das sittenwidrige Verhalten des Herstellers nichts. Jedenfalls zeigt dies, dass eine pauschale Betrachtung nicht immer überzeugt.
3. Vorsatz in Bezug auf die Schädigung
Schließlich müsste Vorsatz in Bezug auf die Schädigung vorliegen. Nach ständiger Rechtsprechung ist kein direkter Vorsatz in Form eines Wollens erforderlich, sondern es genügt die billigende Inkaufnahme der Ziele (BGH NJW 2013, 250, 251; BGH NJW 2020, 1962, 1969). Aus der Art und Weise des sittenwidrigen Handelns könne sich die Schlussfolgerung ergeben, dass mit Schädigungsvorsatz gehandelt worden sei (BGH NJW 2020, 1962, 1969). Der BGH sieht es als bewiesen an, dass die damaligen Vorstände, deren Verhalten ja über § 31 BGB der Volkswagen AG zugewiesen wird, die grundlegende und mit der bewussten Täuschung des KBA verbundene strategische Entscheidung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software jedenfalls kannten und jahrelang umsetzten. Daher sei schon nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass ihnen als für die zentrale Aufgabe der Entwicklung und des Inverkehrbringens der Fahrzeuge zuständigem Organ oder verfassungsmäßigem Vertreter (§ 31 BGB) bewusst gewesen sei, in Kenntnis des Risikos einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung der betroffenen Fahrzeuge werde niemand – ohne einen erheblichen, dies berücksichtigenden Abschlag vom Kaufpreis – ein damit belastetes Fahrzeug erwerben (BGH NJW 2020, 1962, 1970).
4. Pflicht zum Schadensersatz
Liegen die haftungsbegründenden Voraussetzungen vor, greift in der Folge die Schadensersatzpflicht, und zwar dem Grunde nach. Welche konkreten Schadenspositionen zu ersetzen sind, regelt § 826 BGB nicht. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der §§ 249 ff. BGB („Art und Umfang des Schadensersatzes“), wobei der BGH den Schutzzweck des § 826 BGB aber weit auslegt und bei der Anwendung der §§ 249 ff. BGB berücksichtigt.
Verlangt also § 826 BGB weder eine Rechtsgutverletzung noch die Verwirklichung eines Schutzgesetzes, sondern schützt schlicht das Vermögen (siehe BGHZ 160, 149, 153) und beschränkt sich dabei nicht auf nachteilige Einwirkungen auf die Vermögenslage, sondern erstreckt sich auf „jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses und jede Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung“ (BGHZ 160, 149, 153 mit Verweis auf Wagner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 4. Auflage, § 826 Rn. 6 m.w.N.; ausdrücklich auch BGH NJW 2020, 1962, 1968:
„... muss sich der
Geschädigte auch von einer auf dem sittenwidrigen Verhalten beruhenden
Belastung mit einer „ungewollten“ Verpflichtung wieder befreien können.
Schon eine solche stellt unter den dargelegten Voraussetzungen einen
gem. § 826 BGB zu ersetzenden Schaden dar“), kann das – wie aufgezeigt – im Rahmen der nach § 249 I BGB
vom Schädiger vorzunehmenden Naturalrestitution
zu einer (Rück-)Zahlung des für das bemakelte Fahrzeug gezahlten Kaufpreises
(Zug um Zug gegen dessen Rückgabe) führen (BGH NJW 2020, 1962, 1969).
Die (Wieder-)Herstellung des ursprünglichen Zustands knüpft an die Überlegung an, dass ohne Vorhandensein der Manipulationssoftware der Käufer den Kaufvertrag nicht geschlossen hätte. Bestünde der (hypothetische) ursprüngliche Zustand also in einem Nichtvorhandensein des Kaufvertrags, bedeutete die (Wieder-)Herstellung des ursprünglichen Zustands die Rückgängigmachung der Vertragsfolgen, d.h. entweder die Rückabwicklung über den Vertragshändler oder die direkte (Rück-)Zahlung des für das bemakelte Fahrzeug gezahlten Kaufpreises (Zug um Zug gegen dessen Rückgabe).
Die vier vorliegend zu besprechenden Urteile des BGH v. 30.07.2020 befassen sich insbesondere mit diesen Folgen.
V. Die Urteile des BGH v. 30.07.2020
V. Die Urteile des BGH v. 30.07.2020
Vor dem Hintergrund der soeben gemachten Ausführungen zur Haftungsbegründung sollte der Beurteilungsmaßstab
des § 826 BGB
als Anspruchsgrundlage
und Grundlage der folgenden Ausführungen deutlich geworden sein. Der BGH hat die vier oben aufgeworfenen Fragen wie folgt entschieden:
VI. Ergebnis und Stellungnahme
- Zur Frage, ob geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung (§ 826 BGB) Ansprüche auf Schadensersatz zustehen (VI ZR 367/19), hat der BGH unter Anwendung der Grundsätze seines Urteils v. 25.5.2020 (VI ZR 252/19; BGH NJW 2020, 1962) das streitgegenständliche Berufungsurteil (OLG Braunschweig, Urt. v. 13.8.2019 – 7 U 352/18) aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft vom Kläger näheren Vortrag dazu verlangt, welche konkrete bei der Beklagten tätige Person für den Einsatz der illegalen Abschalteinrichtung verantwortlich sei. Die Entscheidung über den Einsatz der Abschalteinrichtung betreffe die grundlegende strategische Frage, mit Hilfe welcher technischen Lösung die Beklagte die Einhaltung der – im Verhältnis zu dem zuvor geltenden Recht strengeren – Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Norm habe gewährleisten wollen. Vor diesem Hintergrund habe die Behauptung des Klägers genügt, die Entscheidung sei auf Vorstandsebene oder jedenfalls durch einen verfassungsmäßig berufenen Vertreter getroffen oder zumindest gebilligt worden. Der für einen Anspruch aus § 826 BGB erforderliche Schaden des Klägers sei auch nicht dadurch entfallen, dass dieser das von der Beklagten entwickelte Software-Update habe durchführen lassen. Liege der Schaden – wie das Berufungsgericht unterstellt habe – in einem unter Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Klägers sittenwidrig herbeigeführten ungewollten Vertragsschluss, so entfalle dieser Schaden nicht dadurch, dass sich der Wert oder Zustand des Vertragsgegenstands nachträglich veränderten. Ein solcher Schaden falle auch unter den Schutzzweck des § 826 BGB.
- Die Frage, ob Nutzungsvorteile einen Schadensersatzanspruch vollständig aufzehren können (VI ZR 354/19), hat der BGH bejaht und damit das Berufungsurteil (OLG Braunschweig, Urt. v. 20.8.2019 – 7 U 5/18) bestätigt. Die zur Berechnung des Wertes der Nutzungsvorteile allgemein herangezogene Formel (Bruttokaufpreis mal gefahrene Strecke seit Erwerb geteilt durch erwartete Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt) könne dazu führen, dass die Nutzungsvorteile einen Schadensersatzanspruch vollständig aufzehrten.
- Hinsichtlich der Frage, ob geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt sog. Deliktszinsen
(§ 849 BGB) Ansprüche auf Verzinsung des für das Fahrzeug bezahlten Kaufpreises (bereits ab Kaufpreiszahlung) zustehen (VI ZR 397/19), hat der BGH zunächst einen Anspruch der Klägerin aus § 826 BGB auf Erstattung des von ihr aufgewendeten Kaufpreises abzüglich der ihr durch den Gebrauch des Fahrzeugs zugeflossenen Nutzungsvorteile Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs für gegeben erachtet. Einen Anspruch der Klägerin auf sog. Deliktszinsen nach § 849 BGB hat der BGH hingegen – anders als das Berufungsgericht (OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19) – verneint. Zwar erfasse diese Vorschrift grundsätzlich jeden Sachverlust durch Delikt, auch den Verlust von Geld in jeder Form, was auch dann gelte, wenn dieser Verlust – wie hier – mit Willen des Geschädigten durch Weggabe erfolge. Vorliegend habe einer Anwendung des § 849 BGB aber jedenfalls der Umstand entgegengestanden, dass die Klägerin als Gegenleistung für die Hingabe des Kaufpreises ein in tatsächlicher Hinsicht voll nutzbares Fahrzeug erhalten habe; die tatsächliche Möglichkeit, das Fahrzeug zu nutzen, kompensiere den Verlust der Nutzungsmöglichkeit des Geldes. Eine Verzinsung gemäß § 849 BGB entspreche in einem solchen Fall nicht dem Zweck der Vorschrift, mit einem pauschalierten Mindestbetrag den Verlust der Nutzbarkeit einer entzogenen oder beschädigten Sache auszugleichen.
- Schließlich hat der BGH die Frage, ob Käufern von mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Gebrauchtwagen auch dann Schadensersatzansprüche zustehen, wenn der Kauf erst nach Bekanntwerden
des sog. Dieselskandals getätigt
wurde (VI ZR 5/20), verneint. Der BGH begründet seine Entscheidung maßgeblich damit, dass in diesem Fall die von § 826 BGB geforderte Sittenwidrigkeit nicht vorliege. Sei das Verhalten der Volkswagen AG gegenüber Käufern, die ein mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehenes Fahrzeug vor dem 22.9.2015 erwarben, sittenwidrig (hier erfolgt der Verweis auf das Senatsurteil v. 25.5.2020 – VI ZR 252/19, Rn. 16 ff.) gewesen, so sei durch die Verhaltensänderung der Volkswagen AG wesentliche Elemente, die das Unwerturteil ihres bisherigen Verhaltens gegenüber bisherigen Käufern begründeten, derart relativiert, dass der Vorwurf der Sittenwidrigkeit bezogen auf ihr Gesamtverhalten gerade gegenüber dem Kläger nicht mehr gerechtfertigt sei. So sei bereits die Mitteilung der Volkswagen AG v. 22.9.2015 objektiv geeignet gewesen, das Vertrauen potenzieller Käufer von Gebrauchtwagen mit VW-Dieselmotoren in eine vorschriftsgemäße Abgastechnik zu zerstören, diesbezügliche Arglosigkeit also zu beseitigen. Aufgrund der Verlautbarung und ihrer als sicher vorherzusehenden medialen Verbreitung sei typischerweise nicht mehr damit zu rechnen gewesen, dass Käufer von gebrauchten VW-Fahrzeugen mit Dieselmotoren die Erfüllung der hier maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben noch als selbstverständlich voraussetzen würden. Für die Ausnutzung einer diesbezüglichen Arglosigkeit sei damit kein Raum mehr gewesen. Käufern, die sich, wie der Kläger, erst für einen Kauf entschieden hätten, nachdem die Volkswagen AG ihr Verhalten bereits geändert hatte, seien deshalb – unabhängig von ihren Kenntnissen vom „Dieselskandal“ im Allgemeinen und ihren Vorstellungen von der Betroffenheit des Fahrzeugs im Besonderen – nicht sittenwidrig ein Schaden zugefügt worden.
VI. Ergebnis und Stellungnahme
Alle vier Urteile des BGH v. 30.07.2020 knüpfen an das Grundsatzurteil des BGH v. 25.05.2020 (VI ZR 252/19; BGH NJW 2020, 1962) zur Frage an, ob geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung
(§ 826 BGB) gegen den Hersteller Ansprüche auf Schadensersatz
zustehen. War danach die Haftung dem Grunde nach geklärt, ging es bei den vier Urteilen v. 30.07.2020 um Beweisfragen, konkrete Schadenspositionen und um die Frage nach einem Abzug wegen Nutzungsvorteilen. Es ist daher zu differenzieren:
Gefahrene km seit Übergabe: 3.000. Das ergibt eine Nutzungsentschädigung i.H.v. 545,45 €, die der Käufer erstatten
muss. Sofern der Käufer einen Erstattungsanspruch wegen des Kaufpreises hat, führt die Nutzungsentschädigung zum
Abzugsposten, d.h. im Ergebnis ist dem Käufer 19.454,55 € zu erstatten, wenn dieser den Anspruch auf den großen
- Im Urteil VI ZR 367/19 hat der BGH völlig zu Recht unter Anwendung der Grundsätze seines Urteils v. 25.05.2020 das Berufungsurteil des OLG Braunschweig (Urt. v. 13.8.2019 – 7 U 352/18) aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Indem das OLG Braunschweig einen näheren Vortrag des Klägers verlangte
zur Feststellung der konkreten, bei VW tätigen Person, die für den Einsatz der illegalen Abschalteinrichtung verantwortlich sein soll, hat es die Grundsätze der primären
und sekundären Beweislast
verkannt. Zwar besteht im Zivilprozess der Beibringungsgrundsatz, der zur Folge hat, dass jede Partei die Voraussetzungen der anspruchsbegründenden Rechtsnorm, auf die sie sich stützt, beweisen muss und somit das Risiko der Nichterweislichkeit einer Beweisbehauptung trägt (Beweislast, die im Rahmen des § 286 ZPO zu berücksichtigen ist). Trifft danach den Anspruchsteller die volle Darlegungs- und Beweislast, hat er grundsätzlich auch keinen Auskunftsanspruch gegen den Anspruchsgegner in Bezug auf Nennung der ihn begünstigenden Umstände (vorliegend also die Nennung der Namen der verantwortlichen Person). Der Anspruchsteller muss sich die für den Prozesssieg erforderlichen Informationen grds. schon selbst beschaffen (R. Schmidt, BGB AT, 18. Aufl. 2019, Rn. 65). Freilich kann dies dazu führen, dass ein Kläger, der regelmäßig die internen Strukturen des Gegners nicht kennt, niemals den erforderlichen Beweis führen und daher niemals den Prozess gewinnen kann. Daher kennt die Zivilprozessordnung Beweiserleichterungen, also Beweisregelungen, bei denen es zwar bei der Grundregel, wonach der Anspruchsteller das Vorhandensein der ihn begünstigenden Umstände beweisen muss, bleibt, jedoch das Beweismaß herabgesetzt ist, etwa in § 287 I S. 1 ZPO. Ebenfalls eine Beweiserleichterung enthält § 294 ZPO (Glaubhaftmachung). Weiterhin ergeben sich Beweislasterleichterungen aus der prozessualen Wahrheitspflicht (§ 138 I ZPO) und der Erklärungslast (§ 138 II ZPO). Im Rahmen dieser Erklärungslast nach § 138 II ZPO kann der Beklagte sogar verpflichtet sein, dem beweisbelasteten Kläger Informationen zu geben. Das ist der Fall, wenn eine Nichtpreisgabe entscheidungserheblicher Umstände eine Vereitelung grundrechtlich geschützter Rechtspositionen bedeutete („Beweisnotstand“). Allerdings muss der Beweispflichtige, den die primäre Darlegungslast trifft, zumindest greifbare Anhaltspunkte dafür liefern, dass allein die andere Partei über prozessentscheidende Informationen verfüge und die Nichtverpflichtung zur Offenlegung für ihn (den Beweispflichtigen) eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellte (siehe BGH NJW 2012, 3774, 3775; BVerfG NJW 2000, 1483, 1484). Ist das der Fall, kann den Beklagten eine sekundäre Darlegungslast treffen (vgl. auch BGH NJW 2018, 2412, 2413). Für den vorliegenden Fall hat der BGH entschieden, dass die Entscheidung über den Einsatz der Abschalteinrichtung die grundlegende strategische Frage betreffe, mit Hilfe welcher technischen Lösung die Volkswagen AG die Einhaltung der – im Verhältnis zu dem zuvor geltenden Recht strengeren – Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Norm habe gewährleisten wollen. Zu Recht hat daher der BGH entschieden, dass vor diesem Hintergrund die Behauptung des Klägers, die Entscheidung sei auf Vorstandsebene oder jedenfalls durch einen verfassungsmäßig berufenen Vertreter getroffen oder zumindest gebilligt worden, genügt. Ist damit also der Darlegungs- und Beweislast Genüge getan, könnte der geltend gemachte Schadensersatzanspruch gleichwohl in Frage gestellt werden, da die Volkswagen AG ein vom KBA genehmigtes Software-Update durchgeführt
und damit den Mangel (d.h. den Schaden) beseitigt hat. Der BGH hat gleichwohl entschieden, dass der für einen Anspruch aus § 826 BGB erforderliche Schaden des Klägers dadurch nicht entfallen sei. Liege der Schaden in einem unter Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Klägers sittenwidrig herbeigeführten ungewollten Vertragsschluss, entfalle dieser Schaden nicht dadurch, dass sich der Wert oder Zustand des Vertragsgegenstands nachträglich veränderten. Ein solcher Schaden falle auch unter den Schutzzweck des § 826 BGB. Diese Begründung überzeugt nicht. Zwar mag eine Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts vorgelegen haben, aber es geht nun einmal um einen wirtschaftlich messbaren Schaden. Richtigerweise hätte der BGH vielmehr darauf abstellen müssen, ob trotz Software-Updates
ein Mangel bzw. Schaden am Fahrzeug verbleibt. Zu denken ist bspw. an einen Mehrverbrauch, an einen Leistungsverlust, an eine verkürzte Lebensdauer des Motors und nicht zuletzt an einen merkantilen Minderwert, der durch den Makel, das Fahrzeug sei vom Abgasskandal betroffen, begründet ist. Im Ergebnis gilt aber jedenfalls: Der Anspruch auf Schadensersatz in Bezug auf ein mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenes Fahrzeug gegen den Fahrzeughersteller entfällt nicht dadurch, dass das zur Behebung des Problems entwickelte Software-Update
durchgeführt wurde. Freilich müssen für einen Schadensersatzanspruch alle sonstigen Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein.
- Auch die Entscheidung des BGH zu der Frage, ob Nutzungsvorteile
einen Schadensersatzanspruch vollständig aufzehren
können (VI ZR 354/19 und VI ZR 397/19), überzeugt (diesmal auch in der Begründung). Wer ein Fahrzeug ohne jegliche Einbußen fährt, d.h. während der Haltedauer keine abgasmanipulationsbedingten Nachteile erfährt, muss sich Gebrauchsvorteile anrechnen lassen (d.h. eine Nutzungsentschädigung leisten). Das ist beim Rücktritt (§ 346 BGB) und beim sog. großen Schadensersatz (Schadensersatz statt der ganzen Leistung gem. § 281 I S. 3 BGB, wo es ebenfalls um die Rückgabe der Sache geht) allgemein anerkannt. Diese Grundsätze greifen auch bei § 826 BGB im Rahmen der nach § 249 I BGB vom Schädiger vorzunehmenden Naturalrestitution, die zu einer (Rück-)Zahlung des für das bemakelte Fahrzeug gezahlten Kaufpreises (Zug um Zug gegen dessen Rückgabe) führt (BGH NJW 2020, 1962, 1969) (siehe oben IV. 4.). Daran ändert auch die Sittenwidrigkeit des Herstellerverhaltens nichts (wie hier OLG Düsseldorf 30.1.2020 – I-13 U 81/19; OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19; OLG Oldenburg 21.10.2019 – 13 U 73/19; OLG Schleswig 22.11.2019 – 17 U 44/19; OLG Celle 20.11.2019 – 7 U 244/18; OLG Karlsruhe 6.11.2019 – 13 U 37/19, 13 U 12/19; a.A. LG Potsdam 12.04.2019 – 6 O 38/18 und die Nachfolgeinstanz OLG Brandenburg 28.01.2020 – 3 U 61/19). Denn trotz sittenwidriger Schädigung kam es während der Nutzung der Fahrzeuge zu keinen Beeinträchtigungen (vom Aufwand der Teilnahme an der Rückrufaktion einmal abgesehen), die einen Ausschluss der Nutzungsentschädigung rechtfertigen würden. Man muss sogar noch weiter gehen und konstatieren: Die Verneinung einer Nutzungsentschädigung führte zu einer Überkompensation und verstieße gegen das allgemein anerkannte schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot. Der Geschädigte darf keine Vorteile ziehen, sondern nur so gestellt werden, wie er ohne das schädigende Ereignis stehen würde bzw. gestanden hätte. Hätten die Käufer also keine abgasmanipulierten Autos gekauft, hätten sie ebenfalls für die Nutzung zahlen müssen (in Form eines Wertverlustes). Daran ändert auch die Sittenwidrigkeit des Herstellerverhaltens nichts. Im Ergebnis ist daher Schadensersatz in Form der Erstattung des Kaufpreises zu leisten und dabei sind die von den Käufern gefahrenen Kilometer in Abzug zu bringen (Nutzungsentschädigung), Zug um Zug gegen Herausgabe des Fahrzeugs. Daran wird deutlich, wie weit die Rechtsprechung jedenfalls bei § 826 BGB den Begriff des Schadens auslegt und welch flexible Rechtsfolgen sie anordnet (also Erstattung des Kaufpreises gegen Herausgabe des Wagens als Form des Schadensersatzes). Der Abzug für die Nutzungsvorteile wird dabei zu Recht vorgenommen. Denn das Auto wurde ja tatsächlich genutzt und der Käufer hat daher davon profitiert. Bei Kfz hängt die Nutzungsentschädigung nach der vom BGH (BGHZ 115, 47, 51 f.; bestätigt in NJW 2014, 2435, 2436; siehe auch LG Oldenburg 29.05.2018 – 1 O 427/17 und LG Erfurt 18.01.2019 – 9 O 490/18) zugrunde gelegten Methode der linearen Teilwertabschreibung (Wackerbarth, NJW 2018, 1713 mit Verweis auf Kaiser, in: Staudinger, BGB, § 346 Rn. 255) vom Bruttokaufpreis, der zu erwartenden Restlaufleistung (das ist die zu erwartende Gesamtlaufleistung abzgl. der bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegebenen Laufleistung) und den seit Übernahme des Fahrzeugs gefahrenen Kilometern ab. Es ergibt sich die folgende Berechnungsformel, die auch der BGH in seinem Urteil VI ZR 354/19 anwendet: Bruttokaufpreis mal gefahrene Strecke seit Erwerb geteilt durch erwartete Restlaufleistung. Das kann im Extremfall (also bei sehr intensiver Nutzung) nach zutreffender Auffassung des BGH (VI ZR 354/19; VI ZR 397/19) sogar dazu führen, dass die Nutzungsvorteile einen Schadensersatzanspruch vollständig aufzehren. Das ist richtig, da – wie ausgeführt – die Käufer trotz Dieselabgasmanipulation ohne Einbußen die Fahrzeuge genutzt haben und auch ohne Dieselabgasmanipulation für die Nutzungen hätten aufkommen müssen.
Gefahrene km seit Übergabe: 3.000. Das ergibt eine Nutzungsentschädigung i.H.v. 545,45 €, die der Käufer erstatten
muss. Sofern der Käufer einen Erstattungsanspruch wegen des Kaufpreises hat, führt die Nutzungsentschädigung zum
Abzugsposten, d.h. im Ergebnis ist dem Käufer 19.454,55 € zu erstatten, wenn dieser den Anspruch auf den großen
Schadensersatz durchsetzt. Der Käufer hat also letztlich nur rund 0,18 € pro gefahrenen Kilometer an
Wertverlust hinzunehmen, was überaus gering ist und daher als Schadenskompensation genügen sollte.
Beispiel 2: Wurden seit Übergabe des Fahrzeugs 110.000 km gefahren, ergibt sich nach der o.g. Formel eine
Nutzungsentschädigung von 20.000,- €. Im Ergebnis wurde also der Schadensersatzanspruch vollständig von den
Nutzungsvorteilen aufgezehrt. Aber auch dies ist angemessen. Es wäre nicht einzusehen, warum ein Käufer diese
Beispiel 2: Wurden seit Übergabe des Fahrzeugs 110.000 km gefahren, ergibt sich nach der o.g. Formel eine
Nutzungsentschädigung von 20.000,- €. Im Ergebnis wurde also der Schadensersatzanspruch vollständig von den
Nutzungsvorteilen aufgezehrt. Aber auch dies ist angemessen. Es wäre nicht einzusehen, warum ein Käufer diese
Laufleistung ohne Nutzungsvorteilsanrechnung beschreiten sollte.
- Die Frage, ob geschädigten Käufern von vom sog. Dieselskandal betroffenen Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt sog. Deliktszinsen (§ 849 BGB: Verzinsung der Ersatzsumme) Ansprüche auf Verzinsung des für das Fahrzeug bezahlten Kaufpreises (bereits ab Kaufpreiszahlung) zustehen (VI ZR 397/19), hat der BGH – anders als das Berufungsgericht (OLG Oldenburg 2.10.2019 – 5 U 47/19) – mit Blick auf den Schutzzweck der Norm verneint. Der Schutzzweck besteht – zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten – darin, mit einem pauschalierten Mindestbetrag den Verlust der Nutzbarkeit einer entzogenen oder beschädigten Sache auszugleichen (allg. Auffassung und auch von BGH VI ZR 397/19 ausdrücklich bestätigt). Ist also die volle Nutzbarkeit gegeben, greift die Ratio des § 849 BGB nicht.
- Schließlich überzeugt (jedenfalls im Ergebnis) die Entscheidung des BGH, Käufern von mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Gebrauchtwagen stünden keine Schadensersatzansprüche zu, wenn der Kauf erst nach Bekanntwerden
des sog. Dieselskandals getätigt
wurde (VI ZR 5/20). Allerdings sind die vom BGH vorgebrachten Argumente zur Verneinung der Sittenwidrigkeit in Frage zu stellen. Vorzugswürdig wäre der Weg über eine Rechtsschutzversagung
gewesen, die ihre Grundlage in § 242 BGB findet: Wer ein Fahrzeug kauft, obwohl der Hersteller zuvor öffentlich die Nichteinhaltung der Dieselabgaswerte erklärt hat und das Thema im Anschluss daran über Monate hinweg Gegenstand umfangreicher Medienberichterstattung war, kann sich nicht auf sittenwidrige Schädigung berufen. Kein Käufer eines Volkswagens mit Dieselmotor der betroffenen Abgasnorm konnte sich daher darauf berufen, er habe vom Dieselabgasskandal nichts mitbekommen und sei daher arglos gewesen.
Rolf Schmidt
(01.08.2020)
10.07.2020: Kaufrechtliche Bestimmungen über Neu- und Gebrauchtsachen beim Tierkauf
Zugleich zur Frage nach der Unionsrechtskonformität des § 476 II BGB (vertragliche Verkürzung der Verjährungsfristen bei gebrauchten Gütern auf bis zu ein Jahr)
BGH, Urteil v. 09.10.2019 – VIII ZR 240/18 (NJW 2020, 759)
Mit Urteil v. 09.10.2019 hat der VIII. Zivilsenat des BGH (VIII ZR 240/18) über die Gewährleistungsverjährung beim Tierkauf (hier: Pferdekauf bei einer Pferdeauktion) zu entscheiden gehabt. Dabei kam es maßgeblich auf folgende Fragen an:
I. Sachverhalt: K ersteigerte auf einer von V veranstalteten öffentlichen Versteigerung den seinerzeit knapp zweieinhalb Jahre alten ungekörten Hengst „A“ zum Preis von rund 25.000 €. V veräußerte als öffentlich bestellter Versteigerer das Pferd im eigenen Namen als Kommissionär (i.S.d. § 383 HGB). Der Hengst war zum Zeitpunkt der Auktion weder geritten noch angeritten worden. Vor der Versteigerung wurde das Pferd klinisch untersucht, wobei sich laut tierärztlichem Untersuchungsprotokoll keine besonderen Befunde ergaben. Der Rücken des Hengstes wurde allerdings nur äußerlich, nicht auch röntgenologisch untersucht. Die in dem von der K zur Kenntnis genommenen Auktionskatalog abgedruckten Auktionsbedingungen des V enthalten unter anderem folgende Regelung:
„D. (…) V. Der Gewährleistungsanspruch des Käufers verjährt bei Schadensersatz und bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln gem. I 1 [= Angaben im Auktionskatalog] und 2 [= in Röntgenaufnahmen und im Untersuchungsprotokoll dokumentierte körperliche Verfassung] drei Monate nach dem Gefahrübergang, bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln gem. I 3 a bis 3 c (Samenqualität, Deck- und Befruchtungsfähigkeit gekörter Hengste) am 31.5. des auf den Gefahrübergang folgenden Jahres. Diese Befristung gilt nicht, soweit Ansprüche betroffen sind, die auf Ersatz eines Körper- und Gesundheitsschadens wegen eines vom Verkäufer zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind. In solchen Fällen gilt die gesetzliche Frist.“
Der Hengst wurde nach Übergabe an K kastriert. Nach einer von K später veranlassten tierärztlichen Untersuchung forderte K den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Sie stützte ihr Begehren darauf, dass sie nach der Übergabe zunächst nur versucht habe, das in ihrem Stall untergebrachte Pferd zu longieren und an Sattel und Reitergewicht zu gewöhnen. Bereits dabei habe sich das Pferd auffällig widersetzlich, schwierig und empfindlich gezeigt. Nach einer mehrmonatigen Zeit auf der Koppelweide habe sie mehrere Monate lang versucht, das Pferd anzureiten. Dabei habe sich herausgestellt, dass es für sie nicht reitbar sei. Es habe schon mindestens im Zeitpunkt der Auktion sog. Kissing Spines im Bereich der Brust- und der Lendenwirbelsäule sowie eine Verkalkung im Nackenband im Bereich des Hinterhaupts aufgewiesen. V wies das Begehren der K mit der Einrede der Verjährung zurück, da die Übergabe des Hengstes an K bereits länger als ein Jahr zurücklag.
Anm. 1: Bei Kissing Spines handelt es sich um eine bei Pferden nicht selten vorkommende Rückenfehlbildung, bei der einige Dornfortsätze der Wirbelsäule so nahe aneinander stehen, dass sie sich bei Bewegung des Pferdes berühren und starke Schmerzen verursachen. Dadurch kann es passieren, dass das Pferd schmerzbedingt unkontrollierbar wird und schon gar nicht geritten werden kann.
Anm. 2: Bei einer Kommission (auch i.S.d. § 383 HGB) handelt es sich um einen Fall der sog. mittelbaren Stellvertretung: Der Kommissionär handelt im eigenen Namen, aber im wirtschaftlichen Interesse der dahinterstehenden Person (des Kommittenten). Dadurch, dass der Kommissionär im eigenen Namen handelt, liegt kein Fall der Stellvertretung i.S.d. § 164 I BGB vor. Vertragspartner des Käufers ist also der Kommissionär, nicht der Kommittent. Aus diesem Grund wird auch nicht die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Kommissionärs dem Kommittenten unmittelbar zugerechnet (was bei einer unmittelbaren Stellvertretung nach § 166 I BGB der Fall wäre). Auch bei einer Versteigerung (Auktion) ist Kommission denkbar, wenn das Auktionshaus Sachen des Einlieferers versteigert. Ob in einem solchen Fall Kommission oder eine unmittelbare Stellvertretung vorliegt, hängt in erster Linie davon ab, ob der Einlieferer anonym bleiben möchte (dann Kommission, da Stellvertretung nach § 164 BGB Offenkundigkeit voraussetzt). Liegt Kommission vor, ist der Kommissionär Vertragspartner des Käufers; Mängelansprüche sind in diesem Vertragsverhältnis geltend zu machen. Bei unmittelbarer Stellvertretung ist der Vertretene Vertragspartner des Käufers und dieser kann und muss sich hinsichtlich Mängelrechte direkt an den Vertretenen halten.
II. Lösung: Ziel des Rückabwicklungsbegehrens ist die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Pferdes (siehe § 346 BGB). Rechtsgrundlage des Rückzahlungsbegehrens könnte damit § 346 BGB sein. Die Voraussetzungen für einen kaufrechtlichen Rücktritt ergeben sich aus §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 323, 326 V BGB. Diese sind:
1. Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
V und K haben einen Kaufvertrag über einen Hengst zum Preis von rund 25.000 € geschlossen. Dass das Geschäft in Form einer Versteigerung (siehe § 156 BGB: Gebot und Zuschlag) erfolgte, ändert am Rechtscharakter des Vertrags nichts. Einwendungen wie Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB), Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB) oder Anfechtung (§ 142 I BGB, §§ 119 ff. BGB) sind nicht erkennbar. Auch die Eigenschaft des Kaufgegenstands als Tier ist unschädlich. Zwar sind gem. § 90a S. 1 BGB Tiere keine Sachen, jedoch gelten gem. § 90a S. 3 BGB die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auch für Tiere. Tiere können daher ohne weiteres Gegenstand von Kaufverträgen sein (siehe etwa BGH 09.10.2019 – VIII ZR 240/18). Ein wirksamer Kaufvertrag liegt vor.
2. Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
An der Fälligkeit bestehen keine Zweifel.
3. Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
Kaufgegenstand ist der knapp zweieinhalb Jahre alte ungekörte Hengst „A“. Am Kaufgegenstand müsste zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Sach- oder Rechtsmangel vorgelegen haben. Vorliegend kommt allein ein Sachmangel in Betracht. Das richtet sich nach § 434 BGB. Nach § 434 I S. 1 BGB ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Nach allgemeiner Auffassung ist Beschaffenheitsvereinbarung die auf Vorstellungen der Parteien beruhende Vereinbarung über die Beschaffenheit oder den Verwendungszweck der gekauften Sache. Weicht die objektive Beschaffenheit von der vereinbarten ab, liegt ein Sachmangel vor (= subjektiver Fehlerbegriff). Das heißt: Ein Mangel liegt demnach vor, wenn die Ist-Beschaffenheit zum Nachteil des Käufers von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht. Auf die Kriterien des § 434 I S. 2 BGB ist nur dann einzugehen, wenn nach § 434 I S. 1 BGB kein Mangel festgestellt werden kann. Die (prüfungstechnische) Nachrangigkeit der Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB ergibt sich aus der Formulierung: „Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn...“.
Von einer Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Denn die Parteien haben nicht über Kissing Spines im Bereich der Brust- und der Lendenwirbelsäule sowie eine Verkalkung im Nackenband im Bereich des Hinterhaupts gesprochen. Ein Sachmangel kann sich daher lediglich aus § 434 I S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB ergeben. Sofern man davon ausgeht, dass die Parteien auch keinen Verwendungszweck vereinbart haben (Nr. 1), darf der Käufer eines Pferdes jedenfalls erwarten, dass das Pferd gesund und reitfähig ist (Nr. 2). Ein Sachmangel liegt gem. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB vor.
Da Kissing Spines eine (genetisch bedingte) Rückenfehlbildung darstellt, lag diese bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Pferdes vor. Mithin lag der Sachmangel auch zum maßgeblichen Zeitpunkt gem. § 446 BGB vor.
4. Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
a. Grundsatz des Fristsetzungserfordernisses
Weiterhin müsste gem. § 323 I BGB K grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. K forderte den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Eine Frist zur Nacherfüllung setzte sie aber nicht. Ob eine Frist zur Rückabwicklung (auch) als Fristsetzung zur Nacherfüllung verstanden werden kann, ist zweifelhaft; vielmehr dürfte allein die Rückabwicklung in Rede stehen und die Frist solle den Weg für eine Klage freimachen. Dennoch kann die Frage dahinstehen, wenn eine Fristsetzung entbehrlich war.
b. Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. Art. 3 V Verbrauchsgüterkaufrichtlinie
Geht es um einen Verbrauchsgüterkauf, also um einen Kauf, bei dem der Käufer einer beweglichen Sache Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist und der Verkäufer ein Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB, sind die Vorgaben des Art. 3 V der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EG) zu beachten, wonach bei einem Verbrauchsgüterkauf der Rücktritt des Verbrauchers (bereits dann) zulässig ist, wenn er innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgt (vgl. Art. 3 V RL 1999/44/EG, wo es in der englischen Fassung heißt: „within a reasonable time“, also „innerhalb einer angemessenen Zeit“, und wo von einer „Fristsetzung“ nichts zu lesen ist). Das Erfordernis einer Fristsetzung in § 323 I BGB widerspricht also dieser Regelung. Ob es sich vorliegend um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, erscheint auf den ersten Blick unklar, da über die Person des V nichts weiter bekannt ist. Da V aber als öffentlich bestellter Versteigerer auftrat, muss von einem Versteigerergewerbe i.S.d. § 34b GewO und damit vom Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs ausgegangen werden, da es sich bei K um eine Verbraucherin handelte. Danach war also schon deshalb (aufgrund des Erfordernisses der europarechtskonformen Auslegung der einschlägigen BGB-Vorschriften bzw. dort, wo eine Auslegung aufgrund des eindeutigen Wortlauts nicht möglich ist, aufgrund europarechtskonformer Rechtsfortbildung oder Nichtbeachtung des Begriffs „Fristsetzung“ in § 323 I BGB bei Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs) keine Fristsetzung erforderlich, sondern K musste nur zur Mängelbeseitigung auffordern und eine angemessene Zeit abwarten. Ob eine Zeit von 14 Tagen ausreicht, darf bezweifelt werden, kann aber dahinstehen, wenn ein sofortiger Rücktritt zulässig war:
c. Sofortiger Rücktritt nach § 326 V BGB
So könnte sich die Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 326 V BGB (sofortiger Rücktritt) unter dem Aspekt „Ausschluss der Leistungspflicht gem. § 275 I BGB“ ergeben. Wird dem Verkäufer die Nacherfüllung (in beiden Varianten des § 439 I BGB!) unmöglich, greift § 275 I BGB mit der Folge der Befreiung von der Leistungspflicht. Muss der Verkäufer demnach also nicht mehr nacherfüllen, würde eine Fristsetzung keinen Sinn machen. Der Käufer kann sofort zurücktreten, § 326 V BGB. Zu prüfen ist daher, ob eine Nacherfüllung in beiden Varianten, also in der Variante der Nachbesserung und in der Variante der Nachlieferung, unmöglich war.
Im vorliegenden Fall ist eine Nacherfüllung in Form der Ersatzlieferung daher ebenso ausgeschlossen wie eine Mangelbeseitigung. Eine Fristsetzung war daher entbehrlich gem. § 326 V BGB.
5. Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
K forderte den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Eine Rücktrittserklärung liegt vor.
6. Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB, wirksamer Ausschluss der Mängelrechte oder Verjährung)
An der Erheblichkeit des Mangels bestehen keine Bedenken. Das Pferd ist praktisch nicht reitbar. Ein Ausschluss der Mängelrechte wurde ersichtlich nicht vereinbart, sodass die Frage, ob wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs ein Ausschluss überhaupt wirksam wäre, dahinstehen kann. Jedoch könnte dem Rücktrittsrecht der K die von V erhobene Einrede der Verjährung entgegenstehen.
a. Verjährung nach verbrauchsgüterkaufrechtlichen Maßstäben
Mängelansprüche nach § 437 Nr. 1 BGB (Nacherfüllung) und nach § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz, Aufwendungsersatz) unterliegen der Verjährung des § 438 BGB. In § 438 BGB ist aber nicht die Rede von einer Verjährung der in § 437 Nr. 2 BGB genannten Rechte der Minderung und des Rücktritts, was die Frage nach deren Fristen aufwirft. Beim Rücktritt und bei der Minderung (§ 437 Nr. 2 BGB) handelt es sich nicht um Ansprüche, sondern um Gestaltungsrechte: Mit ihrer Hilfe „gestaltet“ der Käufer das Schuldverhältnis neu. Da aber nur Ansprüche der Verjährung unterliegen (vgl. § 194 BGB), können Rücktritt und Minderung an sich nicht verjähren (klarstellend BGH NJW 2015, 2106, 2108). Das heißt aber nicht, dass diese Rechte unbefristet ausgeübt werden könnten. Denn der Gesetzgeber hat die Frist zur Ausübung dieser Rechte an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs gekoppelt. Rücktritt und Minderung sind also nicht mehr möglich, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist und der Verkäufer sich hierauf beruft (§ 438 Abs. 4 i.V.m. § 218 BGB). Im Einzelnen gilt:
Zugleich zur Frage nach der Unionsrechtskonformität des § 476 II BGB (vertragliche Verkürzung der Verjährungsfristen bei gebrauchten Gütern auf bis zu ein Jahr)
BGH, Urteil v. 09.10.2019 – VIII ZR 240/18 (NJW 2020, 759)
Mit Urteil v. 09.10.2019 hat der VIII. Zivilsenat des BGH (VIII ZR 240/18) über die Gewährleistungsverjährung beim Tierkauf (hier: Pferdekauf bei einer Pferdeauktion) zu entscheiden gehabt. Dabei kam es maßgeblich auf folgende Fragen an:
- Lag mit dem Kauf ein Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 I S. 1 BGB vor?
- Handelte es sich bei dem gekauften Tier um eine „neue Sache“ oder eine „gebrauchte Sache“?
- Wurde der Kauf im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung getätigt?
I. Sachverhalt: K ersteigerte auf einer von V veranstalteten öffentlichen Versteigerung den seinerzeit knapp zweieinhalb Jahre alten ungekörten Hengst „A“ zum Preis von rund 25.000 €. V veräußerte als öffentlich bestellter Versteigerer das Pferd im eigenen Namen als Kommissionär (i.S.d. § 383 HGB). Der Hengst war zum Zeitpunkt der Auktion weder geritten noch angeritten worden. Vor der Versteigerung wurde das Pferd klinisch untersucht, wobei sich laut tierärztlichem Untersuchungsprotokoll keine besonderen Befunde ergaben. Der Rücken des Hengstes wurde allerdings nur äußerlich, nicht auch röntgenologisch untersucht. Die in dem von der K zur Kenntnis genommenen Auktionskatalog abgedruckten Auktionsbedingungen des V enthalten unter anderem folgende Regelung:
„D. (…) V. Der Gewährleistungsanspruch des Käufers verjährt bei Schadensersatz und bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln gem. I 1 [= Angaben im Auktionskatalog] und 2 [= in Röntgenaufnahmen und im Untersuchungsprotokoll dokumentierte körperliche Verfassung] drei Monate nach dem Gefahrübergang, bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln gem. I 3 a bis 3 c (Samenqualität, Deck- und Befruchtungsfähigkeit gekörter Hengste) am 31.5. des auf den Gefahrübergang folgenden Jahres. Diese Befristung gilt nicht, soweit Ansprüche betroffen sind, die auf Ersatz eines Körper- und Gesundheitsschadens wegen eines vom Verkäufer zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind. In solchen Fällen gilt die gesetzliche Frist.“
Der Hengst wurde nach Übergabe an K kastriert. Nach einer von K später veranlassten tierärztlichen Untersuchung forderte K den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Sie stützte ihr Begehren darauf, dass sie nach der Übergabe zunächst nur versucht habe, das in ihrem Stall untergebrachte Pferd zu longieren und an Sattel und Reitergewicht zu gewöhnen. Bereits dabei habe sich das Pferd auffällig widersetzlich, schwierig und empfindlich gezeigt. Nach einer mehrmonatigen Zeit auf der Koppelweide habe sie mehrere Monate lang versucht, das Pferd anzureiten. Dabei habe sich herausgestellt, dass es für sie nicht reitbar sei. Es habe schon mindestens im Zeitpunkt der Auktion sog. Kissing Spines im Bereich der Brust- und der Lendenwirbelsäule sowie eine Verkalkung im Nackenband im Bereich des Hinterhaupts aufgewiesen. V wies das Begehren der K mit der Einrede der Verjährung zurück, da die Übergabe des Hengstes an K bereits länger als ein Jahr zurücklag.
Anm. 1: Bei Kissing Spines handelt es sich um eine bei Pferden nicht selten vorkommende Rückenfehlbildung, bei der einige Dornfortsätze der Wirbelsäule so nahe aneinander stehen, dass sie sich bei Bewegung des Pferdes berühren und starke Schmerzen verursachen. Dadurch kann es passieren, dass das Pferd schmerzbedingt unkontrollierbar wird und schon gar nicht geritten werden kann.
Anm. 2: Bei einer Kommission (auch i.S.d. § 383 HGB) handelt es sich um einen Fall der sog. mittelbaren Stellvertretung: Der Kommissionär handelt im eigenen Namen, aber im wirtschaftlichen Interesse der dahinterstehenden Person (des Kommittenten). Dadurch, dass der Kommissionär im eigenen Namen handelt, liegt kein Fall der Stellvertretung i.S.d. § 164 I BGB vor. Vertragspartner des Käufers ist also der Kommissionär, nicht der Kommittent. Aus diesem Grund wird auch nicht die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Kommissionärs dem Kommittenten unmittelbar zugerechnet (was bei einer unmittelbaren Stellvertretung nach § 166 I BGB der Fall wäre). Auch bei einer Versteigerung (Auktion) ist Kommission denkbar, wenn das Auktionshaus Sachen des Einlieferers versteigert. Ob in einem solchen Fall Kommission oder eine unmittelbare Stellvertretung vorliegt, hängt in erster Linie davon ab, ob der Einlieferer anonym bleiben möchte (dann Kommission, da Stellvertretung nach § 164 BGB Offenkundigkeit voraussetzt). Liegt Kommission vor, ist der Kommissionär Vertragspartner des Käufers; Mängelansprüche sind in diesem Vertragsverhältnis geltend zu machen. Bei unmittelbarer Stellvertretung ist der Vertretene Vertragspartner des Käufers und dieser kann und muss sich hinsichtlich Mängelrechte direkt an den Vertretenen halten.
II. Lösung: Ziel des Rückabwicklungsbegehrens ist die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Pferdes (siehe § 346 BGB). Rechtsgrundlage des Rückzahlungsbegehrens könnte damit § 346 BGB sein. Die Voraussetzungen für einen kaufrechtlichen Rücktritt ergeben sich aus §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 323, 326 V BGB. Diese sind:
- Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
- Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
- Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
- Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
- Verkäufer hat seine in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung nicht geleistet
- Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
- Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. bei wirksamem Ausschluss der Mängelrechte, Verjährung oder bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB)
1. Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
V und K haben einen Kaufvertrag über einen Hengst zum Preis von rund 25.000 € geschlossen. Dass das Geschäft in Form einer Versteigerung (siehe § 156 BGB: Gebot und Zuschlag) erfolgte, ändert am Rechtscharakter des Vertrags nichts. Einwendungen wie Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB), Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB) oder Anfechtung (§ 142 I BGB, §§ 119 ff. BGB) sind nicht erkennbar. Auch die Eigenschaft des Kaufgegenstands als Tier ist unschädlich. Zwar sind gem. § 90a S. 1 BGB Tiere keine Sachen, jedoch gelten gem. § 90a S. 3 BGB die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auch für Tiere. Tiere können daher ohne weiteres Gegenstand von Kaufverträgen sein (siehe etwa BGH 09.10.2019 – VIII ZR 240/18). Ein wirksamer Kaufvertrag liegt vor.
2. Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
An der Fälligkeit bestehen keine Zweifel.
3. Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
Kaufgegenstand ist der knapp zweieinhalb Jahre alte ungekörte Hengst „A“. Am Kaufgegenstand müsste zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Sach- oder Rechtsmangel vorgelegen haben. Vorliegend kommt allein ein Sachmangel in Betracht. Das richtet sich nach § 434 BGB. Nach § 434 I S. 1 BGB ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Nach allgemeiner Auffassung ist Beschaffenheitsvereinbarung die auf Vorstellungen der Parteien beruhende Vereinbarung über die Beschaffenheit oder den Verwendungszweck der gekauften Sache. Weicht die objektive Beschaffenheit von der vereinbarten ab, liegt ein Sachmangel vor (= subjektiver Fehlerbegriff). Das heißt: Ein Mangel liegt demnach vor, wenn die Ist-Beschaffenheit zum Nachteil des Käufers von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht. Auf die Kriterien des § 434 I S. 2 BGB ist nur dann einzugehen, wenn nach § 434 I S. 1 BGB kein Mangel festgestellt werden kann. Die (prüfungstechnische) Nachrangigkeit der Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB ergibt sich aus der Formulierung: „Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn...“.
Von einer Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Denn die Parteien haben nicht über Kissing Spines im Bereich der Brust- und der Lendenwirbelsäule sowie eine Verkalkung im Nackenband im Bereich des Hinterhaupts gesprochen. Ein Sachmangel kann sich daher lediglich aus § 434 I S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB ergeben. Sofern man davon ausgeht, dass die Parteien auch keinen Verwendungszweck vereinbart haben (Nr. 1), darf der Käufer eines Pferdes jedenfalls erwarten, dass das Pferd gesund und reitfähig ist (Nr. 2). Ein Sachmangel liegt gem. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB vor.
Da Kissing Spines eine (genetisch bedingte) Rückenfehlbildung darstellt, lag diese bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Pferdes vor. Mithin lag der Sachmangel auch zum maßgeblichen Zeitpunkt gem. § 446 BGB vor.
4. Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
a. Grundsatz des Fristsetzungserfordernisses
Weiterhin müsste gem. § 323 I BGB K grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. K forderte den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Eine Frist zur Nacherfüllung setzte sie aber nicht. Ob eine Frist zur Rückabwicklung (auch) als Fristsetzung zur Nacherfüllung verstanden werden kann, ist zweifelhaft; vielmehr dürfte allein die Rückabwicklung in Rede stehen und die Frist solle den Weg für eine Klage freimachen. Dennoch kann die Frage dahinstehen, wenn eine Fristsetzung entbehrlich war.
b. Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. Art. 3 V Verbrauchsgüterkaufrichtlinie
Geht es um einen Verbrauchsgüterkauf, also um einen Kauf, bei dem der Käufer einer beweglichen Sache Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist und der Verkäufer ein Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB, sind die Vorgaben des Art. 3 V der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EG) zu beachten, wonach bei einem Verbrauchsgüterkauf der Rücktritt des Verbrauchers (bereits dann) zulässig ist, wenn er innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgt (vgl. Art. 3 V RL 1999/44/EG, wo es in der englischen Fassung heißt: „within a reasonable time“, also „innerhalb einer angemessenen Zeit“, und wo von einer „Fristsetzung“ nichts zu lesen ist). Das Erfordernis einer Fristsetzung in § 323 I BGB widerspricht also dieser Regelung. Ob es sich vorliegend um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, erscheint auf den ersten Blick unklar, da über die Person des V nichts weiter bekannt ist. Da V aber als öffentlich bestellter Versteigerer auftrat, muss von einem Versteigerergewerbe i.S.d. § 34b GewO und damit vom Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs ausgegangen werden, da es sich bei K um eine Verbraucherin handelte. Danach war also schon deshalb (aufgrund des Erfordernisses der europarechtskonformen Auslegung der einschlägigen BGB-Vorschriften bzw. dort, wo eine Auslegung aufgrund des eindeutigen Wortlauts nicht möglich ist, aufgrund europarechtskonformer Rechtsfortbildung oder Nichtbeachtung des Begriffs „Fristsetzung“ in § 323 I BGB bei Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs) keine Fristsetzung erforderlich, sondern K musste nur zur Mängelbeseitigung auffordern und eine angemessene Zeit abwarten. Ob eine Zeit von 14 Tagen ausreicht, darf bezweifelt werden, kann aber dahinstehen, wenn ein sofortiger Rücktritt zulässig war:
c. Sofortiger Rücktritt nach § 326 V BGB
So könnte sich die Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 326 V BGB (sofortiger Rücktritt) unter dem Aspekt „Ausschluss der Leistungspflicht gem. § 275 I BGB“ ergeben. Wird dem Verkäufer die Nacherfüllung (in beiden Varianten des § 439 I BGB!) unmöglich, greift § 275 I BGB mit der Folge der Befreiung von der Leistungspflicht. Muss der Verkäufer demnach also nicht mehr nacherfüllen, würde eine Fristsetzung keinen Sinn machen. Der Käufer kann sofort zurücktreten, § 326 V BGB. Zu prüfen ist daher, ob eine Nacherfüllung in beiden Varianten, also in der Variante der Nachbesserung und in der Variante der Nachlieferung, unmöglich war.
- Nachbesserung: Mit dieser Variante ist Mangelbehebung gemeint, bei Sachen Reparatur und bei Tieren Heilbehandlung. Das ist sowohl bei einer Gattungsschuld als auch bei einer Stückschuld denkbar. Geht man davon aus, dass eine Rückenfehlbildung nicht oder nur mit sehr aufwändigen und tierquälerischen Operationen behoben werden könnte, kann V nicht nachbessern (gem. § 275 I, II oder III BGB).
- Nachlieferung: Diese Variante beschreibt die Lieferung einer anderen, mangelfreien Sache. Möglicherweise ist die Nachlieferung aber von vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen. Denn bei einer sog. Stückschuld (Speziesschuld), d.h. bei einem Schuldverhältnis, bei dem die geschuldete Sache nach individuellen Merkmalen konkret bestimmt (und daher nicht austauschbar) ist, ist der Erfüllungsanspruch im Ausgangspunkt der Systematik auf die konkrete Sache begrenzt. Typische Fälle einer Stückschuld sind der Kauf von neuen Einzelstücken und von allen gebrauchten Sachen, da hier die Individualität im Vordergrund steht. Ein Anspruch auf Lieferung einer Ersatzsache kommt grds. nicht in Betracht, weil sich die Verbindlichkeit des Schuldners i.d.R. gerade auf diesen individualisierten Gegenstand beschränkt. Kann die Primärpflicht nicht erfüllt werden, tritt nach den Regeln des allgemeinen Schuldrechts grds. Unmöglichkeit (§ 275 I BGB) ein mit der Folge, dass der Schuldner frei wird von seiner Leistungsverpflichtung. Eine Ersatzlieferung scheidet damit grds. aus.
Im vorliegenden Fall ist eine Nacherfüllung in Form der Ersatzlieferung daher ebenso ausgeschlossen wie eine Mangelbeseitigung. Eine Fristsetzung war daher entbehrlich gem. § 326 V BGB.
5. Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
K forderte den V mit Anwaltsschreiben unter Fristsetzung von 14 Tagen vergeblich zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Eine Rücktrittserklärung liegt vor.
6. Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB, wirksamer Ausschluss der Mängelrechte oder Verjährung)
An der Erheblichkeit des Mangels bestehen keine Bedenken. Das Pferd ist praktisch nicht reitbar. Ein Ausschluss der Mängelrechte wurde ersichtlich nicht vereinbart, sodass die Frage, ob wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs ein Ausschluss überhaupt wirksam wäre, dahinstehen kann. Jedoch könnte dem Rücktrittsrecht der K die von V erhobene Einrede der Verjährung entgegenstehen.
a. Verjährung nach verbrauchsgüterkaufrechtlichen Maßstäben
Mängelansprüche nach § 437 Nr. 1 BGB (Nacherfüllung) und nach § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz, Aufwendungsersatz) unterliegen der Verjährung des § 438 BGB. In § 438 BGB ist aber nicht die Rede von einer Verjährung der in § 437 Nr. 2 BGB genannten Rechte der Minderung und des Rücktritts, was die Frage nach deren Fristen aufwirft. Beim Rücktritt und bei der Minderung (§ 437 Nr. 2 BGB) handelt es sich nicht um Ansprüche, sondern um Gestaltungsrechte: Mit ihrer Hilfe „gestaltet“ der Käufer das Schuldverhältnis neu. Da aber nur Ansprüche der Verjährung unterliegen (vgl. § 194 BGB), können Rücktritt und Minderung an sich nicht verjähren (klarstellend BGH NJW 2015, 2106, 2108). Das heißt aber nicht, dass diese Rechte unbefristet ausgeübt werden könnten. Denn der Gesetzgeber hat die Frist zur Ausübung dieser Rechte an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs gekoppelt. Rücktritt und Minderung sind also nicht mehr möglich, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist und der Verkäufer sich hierauf beruft (§ 438 Abs. 4 i.V.m. § 218 BGB). Im Einzelnen gilt:
- Ihrer Rechtsnatur als Gestaltungsrecht folgend, unterliegt die Minderung
an sich nicht der Verjährung (siehe § 194 BGB, wonach nur Ansprüche der Verjährung unterliegen). Da aber die Minderung auch nicht in der Sondervorschrift des § 438 BGB genannt ist, könnte man meinen, sie sei unbefristet möglich. Dieser Gedanke trägt aber nicht. Denn durch die in § 437 Nr. 2 BGB angeordnete Alternativität von Minderung und Rücktritt, die grundsätzlich an dieselben Voraussetzungen anknüpfen, stellt der Gesetzgeber auch an die Verjährung bzw. den Ausschluss wegen Fristverstreichung dieselben Voraussetzungen. Es gilt daher (wie beim Rücktritt) über § 438 IV S. 1 BGB auch bei der Minderung die Regelung des § 218 BGB, der den Ausschluss des Rücktritts (und damit auch der Minderung) betrifft. Nach § 218 I S. 1 BGB ist der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Abzustellen ist also auf die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs: Ist der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt (bzw. wäre er verjährt), sind auch der Rücktritt und die Minderung ausgeschlossen.
- Auch beim Rücktritt handelt es sich um ein Gestaltungsrecht: Mit seiner Hilfe „gestaltet“ der Käufer das Schuldverhältnis neu. Da – wie aufgezeigt – aber nur Ansprüche der Verjährung unterliegen (vgl. § 194 BGB), kann ein Rücktrittsrecht schon kategorisch nicht verjähren (klarstellend BGH NJW 2015, 2106, 2108). Das heißt aber nicht, dass dieses Recht unbefristet ausgeübt werden könnte. Denn der Gesetzgeber hat die Frist zur Ausübung dieses Rechts (wie desjenigen der Minderung) an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs gekoppelt. Ein Rücktritt ist also nicht mehr möglich (siehe § 218 I S. 1 BGB: „unwirksam“), wenn der (hypothetische) Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist und der Verkäufer sich hierauf beruft (§ 438 IV S. 1 i.V.m. § 218 BGB).
- Die Verjährungs- bzw. Ausschlussfrist beträgt allgemein bei beweglichen Sachen (z.B. Autos, Smartphones, Computer etc., aber auch Tiere fallen darunter, vgl. § 90a BGB) 2 Jahre nach Ablieferung der Sache (§ 438 I Nr. 3, II BGB).
- Da bei allen Kaufverträgen, die nicht Verbrauchsgüterkaufverträge sind (also Kauf „Privat von Privat“, „Unternehmer von Unternehmer“, „Unternehmer von Privat“), grundsätzlich bereits der vollständige Ausschluss der Gewährleistung zulässig wäre (zu den Einschränkungen siehe R. Schmidt, Kaufrecht, 3. Aufl. 2019, S. 137 ff.), ist erst recht eine Verkürzung der Verjährungs- bzw. Ausschlussfristen individualvertraglich grundsätzlich zulässig. Das ergibt sich aus § 444 BGB, der von Ausschluss und Beschränkung spricht.
- Bei Verbrauchsgüterkaufverträgen, also in erster Linie bei Kaufverträgen über bewegliche Sachen, bei denen auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher steht (vgl. § 474 I S. 1 BGB), ist ein Ausschluss der Gewährleistung niemals zulässig (siehe §§ 474 II S. 1, 476 I S. 1 BGB). Allein hinsichtlich der Frage, ob wenigstens eine Fristverkürzung möglich ist, bleibt Raum für eine Unterscheidung:
- Beim Verbrauchsgüterkauf einer neuen Sache ist jegliche vertragliche Verkürzung der Verjährungs- bzw. Ausschlussfrist bzgl. der in § 437 BGB bezeichneten Rechte auf weniger als zwei Jahre stets unzulässig (vgl. § 476 II BGB).
- Beim Verbrauchsgüterkauf einer gebrauchten
Sache ist eine Verkürzung bis auf ein Jahr zulässig
(§ 476 II BGB).
Die Frage, wann ein Tier ein „Neutier“ oder ein „Gebrauchttier“ (juristisch eine „gebrauchte Sache“) ist, ist nicht so einfach zu beantworten wie bei Sachen, da Tiere nicht „neu hergestellt“, sondern geboren werden oder schlüpfen. Vorliegend handelt es sich um einen zum Zeitpunkt des Kaufs knapp zweieinhalb Jahre alten Hengst, was die Annahme rechtfertigen könnte, er sei eine Gebrauchtsache gewesen. Andererseits war der Hengst zu diesem Zeitpunkt (altersbedingt) weder als Reit- noch als Zuchttier verwendet worden und war auch nicht angeritten, was wiederum die Eigenschaft als „Neusache“ möglich erscheinen lässt.
- Nach einer Auffassung im Schrifttum ist jedes Tier mit der Geburt oder spätestens mit der ersten Nahrungsaufnahme als Gebrauchtsache anzusehen, da ab der Geburt ein gewisses, nur schwer beherrschbares Sachmängelrisiko bestehe und daher mit dem Tier nicht die Erwartungen an eine Neusache verbunden werden könnten (siehe etwa Lorenz, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 474 Rn. 20).
- Andere wiederum sehen stets eine Neueigenschaft, solange das Tier noch nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung zugeführt wurde (siehe etwa Wertenbruch, NJW 2012, 2065, 2069).
- Der BGH lehnt jedenfalls die erste Sichtweise prinzipiell ab. Sie sei unvereinbar mit § 90a S. 3 und §§ 474 ff. BGB, wonach mangels Sonderbestimmungen für Tiere die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind. Der Gesetzgeber habe sich bei der Verabschiedung dieser Bestimmungen von der Erwägung leiten lassen, dass es beim Kauf von Tieren keiner speziellen Regelung zur Sachmängelhaftung und zur Verjährung bedürfe, weil die neu eingeführten kaufrechtlichen Vorschriften auch diesen Bereich angemessen regelten und auch hier zwischen „neu“ und „gebraucht“ zu unterscheiden sei und daher etwa junge Haustiere oder lebende Fische als „neu“ auch i.S.d. § 475 II BGB (nunmehr: § 476 II BGB) zu behandeln seien (Rn. 26 des Urteils mit Verweis auf BGHZ 170, 31). Daher verbiete es sich, ein Tier unmittelbar nach seiner Geburt oder kurze Zeit danach – jedenfalls nicht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände – bereits als „gebraucht“ anzusehen.
Das heißt also: Da es sich bei dem vorliegenden Kauf um einen Verbrauchsgüterkauf und beim Kaufgegenstand um eine „Gebrauchtsache“ handelt und gem. § 476 II BGB V die Frist für die Ausübung der Gewährleistungsrechte damit auf ein Jahr verkürzen durfte, wäre wegen § 476 II BGB die Ausübung des Rücktrittsrechts gem. § 438 IV i.V.m. § 218 BGB in der Tat verjährt.
b. Europarechtswidrigkeit des § 476 II BGB?
§ 476 II BGB könnte jedoch mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG unvereinbar und damit in seiner Anwendung gesperrt sein. Die Richtlinie gewährt einen Mindestschutz für Verbraucher. Sie wurde mit Wirkung zum 01.01.2002 in Form des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes (SMG) in nationales Recht umgesetzt. Die Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs und andere verbraucherschützende Vorschriften sind im Rahmen dieser Schuldrechtsmodernisierung in das BGB eingefügt worden. Zweck der Richtlinie ist gem. Art. 1 I der RL die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter zur Gewährleistung eines einheitlichen Verbraucherschutz-Mindestniveaus im Rahmen des Binnenmarkts. Art. 2 der RL statuiert die Anforderungen an eine vertragsgemäße Leistung und Art. 3 der RL nennt die Rechte des Verbrauchers bei Vorliegen einer Vertragswidrigkeit. Im Fall gebrauchter Güter können gem. Art. 7 I UA 2 S. 1 der RL die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Verkäufer und der Verbraucher sich auf Vertragsklauseln oder Vereinbarungen einigen können, denen zufolge der Verkäufer weniger lange haftet als in Art. 5 I der RL vorgesehen. Diese kürzere Haftungsdauer darf gem. Art. 7 I UA 2 S. 2 der RL ein Jahr aber nicht unterschreiten.
Damit spricht Art. 7 I der RL also von einer Haftungsdauer, die gem. Art. 5 I S. 1 der RL zwei Jahre ab Lieferung beträgt. Bei Gebrauchtgütern dürfen die Mitgliedstaaten diese Frist auf bis zu ein Jahr verkürzen. Nach der Lesart des EuGH bedeutet „Verkürzung der Haftungsdauer“ aber nicht, dass den Parteien die Möglichkeit eingeräumt ist, die Dauer der in Art. 5 I S. 2 der RL genannten Verjährungsfrist zu begrenzen (EuGH 13.7.2017 – C-133/16 (DAR 2018, 254 ff.): „Begrenzungsmöglichkeit hinsichtlich der Haftungsdauer des Verkäufers bei gebrauchten Gütern verleiht keine Befugnis zur Begrenzung der Verjährungsfrist.“). Auf den ersten Blick erscheint es nicht nachvollziehbar, warum mit Verjährungsfrist etwas anderes gemeint sein könnte als mit Haftungsdauer. Der EuGH differenziert aber mit Blick auf den Wortlaut des Art. 5 I S. 1 der RL (Haftung) und des Art. 5 I S. 2 (Verjährung). Mit diesen Bestimmungen habe die RL zwei verschiedene Fristen eingeführt, nämlich eine Haftungsdauer des Verkäufers und eine Verjährungsfrist. Die Dauer der Verjährungsfrist hänge nicht von der Haftungsdauer des Verkäufers ab.
- Die Haftungsdauer beziehe sich auf den Zeitraum, in dem das Auftreten einer Vertragswidrigkeit des in Rede stehenden Gutes die in Art. 3 der RL vorgesehene Haftung des Verkäufers auslöse und somit zur Entstehung der Rechte führe, die Art. 3 der RL zugunsten des Verbrauchers vorsehe. Diese Haftungsdauer des Verkäufers betrage grundsätzlich zwei Jahre ab Lieferung des Gutes (Rn. 34 des Urteils, wobei sich dies bereits aus dem Wortlaut des Art. 5 I S. 1 der RL ergibt). Diese Frist (d.h. die Haftungsdauer) könne gem. Art. 7 I UA 2 der RL durch nationales Recht auf ein Jahr verkürzt werden (Rn. 42 des Urteils).
- Demgegenüber handele es sich bei der Frist, auf die sich Art. 5 I S. 2 der RL beziehe, um eine Verjährungsfrist, die dem Zeitraum entspreche, in dem der Verbraucher seine Rechte, die während der Haftungsdauer des Verkäufers entstanden sind, tatsächlich gegenüber diesem ausüben könne. Da die RL von einer Verkürzung der Verjährungsfrist (anders als bei der Haftungsdauer) nichts sagt, geht der EuGH davon aus, dass diese Frist nicht zur Disposition der Mitgliedstaaten steht.
Anm.: Zu beachten ist, dass die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie demnächst von der Richtlinie (EU) 2019/771 v. 20.05.2019 (Warenkauf-Richtlinie; WKRL) abgelöst wird. Gemäß ihren Erwägungsgründen 1-8 soll die WKRL einen harmonisierten Binnenmarkt zugunsten der Verbraucher und der Unternehmer unterstützen und die Beseitigung der größten Hindernisse für die Entwicklung des grenzüberschreitenden Handels in der Union erreichen. Da der grenzüberschreitende Binnenmarkt ein großes Anwendungsfeld im Online-Handel hat, dürfte die Relevanz der WKRL überaus deutlich werden. Der Anwendungsbereich wird (wie die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU) ausschließlich Verbrauchergeschäfte betreffen (Art. 3 I WKRL). Eine der wohl gravierendsten Änderungen wird die Verlängerung der Beweislastumkehr sein. Diese wird gem. Art. 11 I WKRL ein Jahr ab Zeitpunkt der Lieferung betragen (bislang: 6 Monate) und kann sogar durch nationales Recht auf zwei Jahre ausgeweitet werden (Art. 11 II WKRL). Die WKRL ist gem. Art. 24 I bis zum 1.7.2021 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen; diese wenden die WKRL ab dem 1.1.2022 an. Die WKRL gilt gem. Art. 24 II keinesfalls für vor dem 1.1.2022 geschlossene Verträge. Im Zuge der damit verbundenen Umsetzung sind umfangreiche Änderungen im BGB zu erwarten und damit auch hinsichtlich der Verjährungsfristen.
c. Kauf im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung
Jedoch könnten die Beschränkungen des Verbrauchsgüterkaufs schon gar nicht anwendbar sein, da K das Pferd bei einer öffentlichen Versteigerung erworben hat mit der Konsequenz, dass es auch auf die Europarechtskonformität des § 476 II BGB nicht ankommt. Denn gem. § 474 II S. 2 BGB gelten die Schutzvorschriften des Verbrauchsgüterkaufrechts nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann. Das war vorliegend der Fall.
d. Verjährung aufgrund vertraglicher Klausel
Sind die §§ 475-477 BGB also nicht anwendbar, könnte sich die Begründetheit der Verjährungseinrede des V damit letztlich nur noch aus der Vertragsklausel („Verjährungsfrist 3 Monate“) ergeben. Dazu müsste diese aber wirksam sein. In Betracht kommt ein Verstoß gegen das AGB-Recht der §§ 305 ff. BGB.
- Ein möglicher Verstoß gegen § 309 Nr. 8b BGB scheidet von vornherein aus, da es sich bei dem in Rede stehenden Hengst – wie geprüft – um eine „Gebrauchtsache“ handelt, § 309 Nr. 8b BGB aber an Verträge über Lieferungen neu hergestellter Sachen anknüpft.
- Auch ein Verstoß gegen § 309 Nr. 7 BGB kommt nicht in Betracht, da der formularmäßige Haftungsausschluss die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie wegen grober Fahrlässigkeit unberührt lässt.
- § 308 BGB ist thematisch nicht einschlägig, sodass ein diesbezüglicher Verstoß ebenfalls nicht angenommen werden kann.
- Ein Verstoß gegen § 307 II BGB (hier: Nr. 2) kann ebenfalls nicht angenommen werden, da die Klausel die Haftung nicht gänzlich ausschließt und damit nicht „wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist“.
- Eine Unwirksamkeit könnte sich daher lediglich aus der Generalklausel des § 307 I S. 1 BGB
ergeben. Danach ist eine Formularklausel unwirksam, wenn sie den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Gemäß § 307 I S. 2 BGB kann sich die Unangemessenheit der Benachteiligung auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Der BGH erweitert den „Unangemessenheitsbegriff“ und nimmt eine unangemessene Benachteiligung an, „wenn der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen“ (Rn. 57 des Urteils mit Verweis auf die st. Rspr., etwa BGHZ 217, 1). V habe das Pferd nicht als Eigentümer, sondern als Kommissionär versteigert, sodass ihm der Hengst und dessen „Vorleben“ nicht aus eigener Anschauung bekannt gewesen seien und für ihn aus diesem Grunde bezüglich eventuell vorhandener verdeckter Mängel typischerweise ein nicht unerhebliches Haftungsrisiko bestanden habe. Nicht für unerkannte bzw. verborgene Schäden haften zu müssen, sei daher ein berechtigtes Anliegen des V, das K nicht unangemessen benachteilige. Die Verkürzung der Verjährungsfrist auf drei Monate ab Gefahrübergang benachteilige daher die K nicht unangemessen.
Rolf Schmidt (10.07.2020)
27.06.2020: Sachmangel bei Kfz, wenn bei Zubehör(felgen) Betriebserlaubnis fehlt
BGH, Urteil v. 11.12.2019 – VIII ZR 361/18 (NJW 2020, 1287)
Mit Urteil v. 11.12.2019 hat der BGH entschieden, dass die Angabe „Allgemeine Betriebserlaubnis“ (im Folgenden: ABE) hinsichtlich mitverkaufter Zubehörteile (hier: Zubehörfelgen) eine Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d. § 434 I S. 1 BGB in Bezug auf das Kfz darstellt. Fehle es daran, sei das Kfz mangelbehaftet und Gegenstand von Mängelrechten (hier: Rücktritt vom Vertrag). Ob das Urteil angesichts der Tatsache überzeugt, dass der Mangel eigentlich nur ein Zubehörteil betrifft und der Wagen als solcher ja mangelfrei ist, soll – gerade mit Blick auf die gravierenden Folgen eines Rücktritts – im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt: K schloss als Verbraucher mit dem Autohändler V einen Kaufvertrag über einen fünf Jahre alten Pkw der Marke BMW zum Preis von 31.750 €. Im schriftlichen Kaufvertrag findet sich u.a. der folgende Zusatz: „Inkl. 1 x Satz gebrauchte Winterräder auf Alufelgen (ABE [= Allgemeine Betriebserlaubnis] für Winterräder wird nachgereicht).“ Das Fahrzeug wurde K nach Zahlung des Kaufpreises noch am selben Tag mit achtfacher Bereifung übergeben, wobei (wegen der winterlichen Jahreszeit) die Winterräder montiert waren. Die Felgen der Winterräder stammten nicht vom Hersteller des Fahrzeugs; vielmehr waren sie lediglich mit einem BMW-Emblem versehen und für das verkaufte Pkw-Modell nicht zugelassen. Im Frühling stellte K fest, dass bei seinem Fahrzeug die hintere Federung nicht funktionierte. Er unterrichtete V hierüber, übertrug diesem aber nicht die Behebung des gerügten Mangels, sondern ließ die Luftfederung zwei Tage später bei einem Kfz-Meisterbetrieb seiner Wahl austauschen. Hierfür fielen Kosten i.H.v. 981,45 € an, deren Erstattung V ablehnte. Wieder einige Monate später trat am Pkw ein Defekt am Turbolader auf. Dieser wurde von V ersetzt. K macht geltend, V habe einen leistungsstärkeren und älteren Turbolader eines anderen Herstellers eingebaut, weswegen eine ordnungsgemäße Nachbesserung nicht erfolgt sei. Nachdem eine Einigung zwischen den Parteien nicht zustande gekommen war, erklärte K unter Bezugnahme auf den bisherigen Schriftverkehr den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte V auf, ihm Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis i.H.v. 31.750 € abzüglich einer Nutzungsentschädigung von 793,75 €, mithin 30.956,25 €, zurückzuzahlen sowie ihm die An- und Abmeldekosten von insgesamt 120 € und die angefallenen Kosten für die Erneuerung der Luftfederung i.H.v. 981,45 € zu erstatten.
Später – nach Klageerhebung bzgl. des Streits um die defekte Luftfederung und den Turbolader – setzte K dem V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder und verlangte Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs.
II. Vorüberlegung: Zunächst erscheint das Vorgehen des K wenig konsistent und nachvollziehbar, wenn er nach einem erklärten Rücktritt einen weiteren „hinterherschiebt“. Das mag einem „Absicherungsbestreben“ geschuldet sein, weil K später der Auffassung gewesen sein könnte, die zunächst vorgebrachten Gründe würden für einen erfolgreichen Rücktritt nicht genügen. Damit kommen für einen Rücktritt insgesamt folgende Gründe in Betracht:
III. Prüfung: Die Voraussetzungen für einen kaufrechtlichen Rücktritt ergeben sich aus §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 323, 326 V BGB. Diese sind:
1. Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
V und K haben einen Kaufvertrag über einen fünf Jahre alten Pkw der Marke BMW zum Preis von 31.750 € geschlossen. Einwendungen wie Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB), Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB) oder Anfechtung (§ 142 I BGB, §§ 119 ff. BGB) sind nicht erkennbar. Ein wirksamer Kaufvertrag liegt vor.
2. Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
Um einen Rücktritt auszuüben, muss die Leistung fällig sein. § 323 I BGB stellt dies klar. Die Fälligkeit ergibt sich aus § 271 BGB. Gemeint ist der Zeitpunkt, an dem der Schuldner spätestens leisten muss. Vor Fälligkeit ist ein Rücktritt grundsätzlich nicht möglich, außer, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden. Dann kann gem. § 323 IV BGB der Gläubiger bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung zurücktreten. Vorliegend steht die Fälligkeit außer Zweifel.
3. Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
Kaufgegenstand ist der fünf Jahre alte BMW nebst Zubehörfelgen. Am Kaufgegenstand müsste zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Sach- oder Rechtsmangel vorgelegen haben. Vorliegend kommt allein ein Sachmangel in Betracht. Das richtet sich nach § 434 BGB. Nach § 434 I S. 1 BGB ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Das heißt: Ein Mangel liegt demnach vor, wenn die Ist-Beschaffenheit zum Nachteil des Käufers von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht. Auf die Kriterien des § 434 I S. 2 BGB ist nur dann einzugehen, wenn nach § 434 I S. 1 BGB kein Mangel festgestellt werden kann. Die (prüfungstechnische) Nachrangigkeit der Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB ergibt sich aus der Formulierung: „Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn...“.
a. Defekte Luftfederung und defekter Turbolader
Hinsichtlich der Luftfederung und des Turboladers ist keine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB ersichtlich. Ein Sachmangel kann sich daher lediglich aus § 434 I S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB ergeben. Jedenfalls darf ein Käufer eine funktionierende Luftfederung und einen funktionierenden Turbolader bei Autos, die mit diesen Teilen ausgestattet sind, erwarten. Ein Sachmangel liegt gem. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB vor.
b. Zubehörfelgen ohne ABE
Hinsichtlich der Zubehörfelgen könnte indes eine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB vorliegen. Dagegen spricht aber, dass die Zubehörfelgen nicht Gegenstand eines separaten Kaufgegenstands waren. Kaufgegenstand war vielmehr der BMW, der neben den Werksfelgen lediglich über einen zweiten Satz Felgen (die Zubehörfelgen) verfügte. Der BMW selbst (i.V.m. den Werksfelgen) ist ja nicht von der fehlenden ABE der Zubehörfelgen betroffen. Daher meinte die Revision (OLG Stuttgart 13.11.2018 – 10 U 46/18, folgend auf LG Heilbronn, 16.02.2018 – 11 O 144/17), die vertragliche Abrede betreffe nur die Beschaffenheit des Wagens als „eigentlichen“ Kaufgegenstand und erstrecke sich nicht auf die mitgelieferten Zubehörfelgen. Der BGH ist dem entgegengetreten. Die Parteien hätten im Kaufvertrag vereinbart, dass auch ein Satz gebrauchter Winterräder auf Alufelgen Kaufgegenstand sei und dass V die ABE für die Winterräder nachreiche. Diese Abrede habe bei der gebotenen interessengerechten Auslegung zum Inhalt, dass V für das Vorhandensein einer ABE der Felgen für das verkaufte Fahrzeug in vertragsgemäß bindender Weise die Gewähr übernehme und damit seine Bereitschaft zu erkennen gebe, für alle gewährleistungsrechtlichen Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen (Rn. 35 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2017, 2817 Rn. 13; BGH NJW 2019, 1937 Rn. 22). Zudem werde ein Käufer, der – wie hier – Wert auf die Nutzung zugelassener Räder legt, bei objektiver Betrachtung im Fall der Kenntniserlangung von dem Nichtvorliegen einer Betriebserlaubnis für die Felgen das Fahrzeug nicht in einer den getroffenen Vereinbarungen entsprechenden Form (also unter Verwendung der mitgelieferten Zubehörfelgen) nutzen wollen und dürfen (Rn. 36 des Urteils). Außerdem liege der Regelung des § 434 I BGB nach der Rechtsprechung des BGH ein weiter Beschaffenheitsbegriff zugrunde. Danach seien als Beschaffenheit einer Sache i.S.v. § 434 I BGB sowohl alle Faktoren anzusehen, die der Sache selbst anhafteten, als auch alle Beziehungen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache hätten (Rn. 37 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2016, 2874 Rn. 10; BGH NJW 2013, 1948 Rn. 15; BGH NJW 2013, 1671 Rn. 10)).
Danach umfasse die Beschaffenheitsvereinbarung auch die – bei Gefahrübergang montierten – Zubehörfelgen. Seien diese (wegen Fehlens einer ABE) mangelbehaftet, sei auch der Wagen mangelbehaftet. Diesem fehle damit die vereinbarte Beschaffenheit nach § 434 I S. 1 BGB.
Ist damit ein Sachmangel unter dem Aspekt der für K negativen Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der vertraglichen vereinbarten Soll-Beschaffenheit (§ 434 I S. 1 BGB) gegeben, erübrigt sich ein Eingehen auf die Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB (Subsidiarität der Hilfskriterien, s.o.). Gleichwohl prüft der BGH relativ ausführlich, ob das Fehlen einer ABE bezüglich der Felgen (vgl. § 22 StVZO) zu einem Sachmangel des Wagens unter dem Aspekt des § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB führt, wonach eine Sache (nur dann) frei von Sachmängeln ist, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Dieser Prüfung liegt der Gedanke zugrunde, dass das Fehlen einer ABE der Zubehörfelgen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis (BE) des Fahrzeugs führen könnte. Wäre dies der Fall, bestünde durchaus ein Mangel (auch) i.S.d. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB.
Anm.: Die Prüfung des BGH ist dem Umstand geschuldet, dass das Berufungsgericht den Sachmangel unter diesem Aspekt geprüft (und bejaht) hat. Daher war eine Auseinandersetzung in der Revision wegen des geltend gemachten Rechtsfehlers angezeigt.
Im Einzelnen führt der BGH hierzu aus, dass das Fehlen einer ABE bezüglich der Felgen, für die auch keine Einzelbetriebserlaubnis nach §§ 21, 22 II S. 4 StVZO oder ein Nachtrag zur BE des Fahrzeugs nach §§ 22 III, 19 III Nr. 1 Buchst. b StVZO vorlegen hätten, nicht ohne Weiteres dazu führe, dass gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO (Erlöschen der BE des Fahrzeugs, wenn durch vorgenommene Änderungen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist) die BE für das Fahrzeug erlösche. Vielmehr setze dies voraus, dass die – mit der Nutzung nicht zugelassener Felgen verbundene – nachträgliche Veränderung mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer verursache (Rn. 30 des Urteils mit Verweis u.a. auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 27 u. 29). Damit nimmt der BGH also eine teleologische Interpretation des Merkmals „Erlöschen der BE des Fahrzeugs, wenn durch vorgenommene Änderungen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist“ vor. Die „Erwartung der Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer“ muss also auf konkreten Anhaltspunkten basieren und darf nicht generalisierend angenommen werden. So lässt sich nach Auffassung des BGH das Maß der für ein Erlöschen der BE erforderlichen Gefahr nicht abstrakt und absolut bestimmen. Denn der zu fordernde Wahrscheinlichkeitsgrad hänge von der Bedeutung der gefährdeten Rechtsgüter und dem Ausmaß des möglichen Schadens ab (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 32). Behörden und Gerichte hätten daher für jeden konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Veränderung – sei es durch unsachgemäßen Anbau eines an sich ungefährlichen Fahrzeugteils, sei es durch den Betrieb eines sachgerecht angebauten, aber gefährlichen Teils – eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lasse (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 31 f.; OLG Köln NZV 1997, 283, 284).
Die vereinzelt von Zivilgerichten vertretene Auffassung, die Voraussetzungen des § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO seien regelmäßig erfüllt, wenn Änderungen vorgenommen würden, die das Fahrverhalten beeinflussten, was bei Änderungen an Reifen, Felgen und Fahrwerk ohne Weiteres der Fall sei (OLG Bamberg DAR 2005, 619), treffe daher nicht zu (Rn. 32 des Urteils). Es möge zwar sein, dass bei Veränderungen an den Rädern eines Fahrzeugs ein Indiz für eine zu erwartende Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bestehe, weil sie für die Verkehrssicherheit von besonderer Bedeutung seien (hier erfolgt der Verweis auf KG, Urt. v. 27.3.1998 – 2 Ss 341/97, 3 Ws [B] 76/98 Rn. 9). Gleichwohl setze die erforderliche Prognose der Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer Feststellungen zu Art und Typ der geänderten Bereifung, zu Art und Umfang der Abweichung vom Originalzustand und zu dem Einfluss der Abweichung auf die Verkehrssicherheit voraus (hier erfolgt der erneute Verweis auf KG, Urt. v. 27.3.1998 – 2 Ss 341/97, 3 Ws [B] 76/98 Rn. 9).
Sein Ergebnis untermauert der BGH mit den Gesetzesmaterialien zur StVZO. Danach sei weder die Veränderung von Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit vorgeschrieben sei, noch die bloße Möglichkeit einer Gefährdung ausreichend, um die BE gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO erlöschen zu lassen (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf BR-Drs. 629/93, 17 und u.a. auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 31). Dem Genügenlassen der bloßen Möglichkeit einer Gefährdung stehe auch schon der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entgegen (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf BR-Drs. 629/93, S. 17). Erforderlich sei daher, dass durch die nachträgliche Veränderung mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer geschaffen werde.
Fazit: Mithin fasst der BGH sein Ergebnis mit folgendem Leitsatz zusammen: „Die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erlischt im Falle nachträglicher Veränderungen (hier: Montage nicht zugelassener Felgen) nur dann, wenn diese mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer verursachen. Dabei haben Behörden und Gerichte für jeden konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lässt.“
Stellungnahme: Den Ausführungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO ist beizupflichten. Die Gefährdung für andere Straßenverkehrsteilnehmer muss konkret sein und ggf. mittels Sachverständigengutachten festgestellt werden. Die Montage von Zubehörfelgen, die an sich genehmigungsfähig sind (weil sie die materiellen Prüfkriterien erfüllen), bei denen aber die (formale) Zulassung fehlt, führt daher nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Nicht genehmigungsfähige Felgen begründen demgegenüber stets eine konkrete Gefährdung und führen zum Erlöschen der BE des Fahrzeugs. Da dies im vorliegenden Fall vom Berufungsgericht nicht festgestellt wurde, kam der BGH zu dem zutreffenden Ergebnis, dass sich ein Sachmangel (am Fahrzeug) nicht mit der fehlenden ABE der Zubehörfelgen herleiten ließ.
Im Ergebnis ist damit mit dem BGH ein Sachmangel gegeben. Der Sachmangel lässt sich zwar nicht auf eine etwaig erloschene BE des Fahrzeugs stützen, weil die für ein Erlöschen der BE nach § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO erforderliche konkrete Gefährdung für andere Straßenverkehrsteilnehmer nicht festgestellt wurde (es blieb unklar, ob die Zubehörfelgen genehmigungsfähig waren), sondern darauf, dass die mitverkauften, zum Zeitpunkt der Übergabe am Fahrzeug montierten Zubehörfelgen nicht über eine ABE verfügten, das Vorliegen einer ABE aber Bestandteil der Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB war. Da die ABE bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Fahrzeugs fehlte, liegt der Sachmangel auch zum maßgeblichen Zeitpunkt gem. § 446 BGB vor.
4. Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
Weiterhin müsste gem. § 323 I BGB K grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. K setzte dem V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder und verlangte Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Dadurch, dass K gleichzeitig das Rückzahlungsbegehren geltend machte, hat er keine – und damit auch keine angemessene – Frist zur Nacherfüllung gesetzt.
Möglicherweise war eine Fristsetzung aber entbehrlich. Geht es um einen Verbrauchsgüterkauf, also um einen Kauf, bei dem – wie vorliegend – der Käufer einer beweglichen Sache Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist und der Verkäufer ein Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB, sind die Vorgaben des Art. 3 V der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EG) zu beachten, wonach bei einem Verbrauchsgüterkauf der Rücktritt des Verbrauchers (bereits dann) zulässig ist, wenn er innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgt (vgl. Art. 3 V RL 1999/44/EG, wo es in der englischen Fassung heißt: „within a reasonable time“, also „innerhalb einer angemessenen Zeit“, und wo von einer „Fristsetzung“ nichts zu lesen ist). Das Erfordernis einer Fristsetzung in § 323 I BGB widerspricht also dieser Regelung. Jedoch hätte K auch danach eine angemessene Zeit abwarten müssen und hätte nicht gleichzeitig mit der Mangelbeseitigungsaufforderung den Rücktritt erklären dürfen.
Die Entbehrlichkeit der Fristsetzung könnte sich aber gem. § 326 V BGB unter dem Aspekt „Ausschluss der Leistungspflicht gem. § 275 I BGB“ ergeben. Wird dem Verkäufer die Nacherfüllung (in beiden Varianten des § 439 I BGB!) unmöglich, greift § 275 I BGB mit der Folge der Befreiung von der Leistungspflicht. Muss der Verkäufer demnach also nicht mehr nacherfüllen, würde eine Fristsetzung keinen Sinn machen. Der Käufer kann sofort zurücktreten, § 326 V BGB. Zu prüfen ist daher, ob eine Nacherfüllung in beiden Varianten, also in der Variante der Nachbesserung und in der Variante der Nachlieferung, unmöglich war.
5. Verkäufer hat seine in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung nicht geleistet
V hat trotz Aufforderungen keine ABE für die Felgen nachgeliefert und damit nicht die in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung geleistet.
6. Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
Die Rücktrittserklärung könnte darin gesehen werden, dass K infolge nicht erzielter Einigung über die Übernahme der Reparaturkosten des Luftfahrwerks (Luftfederung) und des verbauten Austauschturboladers unter Bezugnahme auf den bisherigen Schriftverkehr den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärte und V aufforderte, ihm Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zu erstatten. Weiterhin könnte die Rücktrittserklärung darin gesehen werden, dass K später V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder setzte und Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs verlangte.
Die jeweilige Rücktrittserklärung betrifft also den in Bezug genommenen Mangel.
7. Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. bei wirksamem Ausschluss der Mängelrechte, Verjährung oder bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB)
Ein Ausschluss der Mängelrechte wurde ersichtlich nicht vereinbart. Einem Ausschluss stünde aber auch § 476 I S. 1 BGB entgegen, wonach eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Verbrauchers u.a. von den §§ 433-435, 437, 439-443 BGB abweicht, unwirksam ist. Bei einem Verbrauchsgüterkauf, also in erster Linie bei einem Kaufvertrag über eine neue oder gebrauchte bewegliche Sache, bei dem auf Verkäuferseite ein Unternehmer (§ 14 I BGB) und auf Käuferseite ein Verbraucher (§ 13 BGB) steht (vgl. § 474 I S. 1 BGB), ist ein Ausschluss der Gewährleistung schlicht unwirksam. Da es sich vorliegend um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, wäre also eine etwaige Vereinbarung über einen Gewährleistungsausschluss unwirksam.
Eine Verjährung liegt ebenfalls nicht vor. Mängelansprüche nach § 437 Nr. 1 BGB (Nacherfüllung) und § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz, Aufwendungsersatz) unterliegen der Verjährung des § 438 BGB, die bei beweglichen Sachen (z.B. Autos, Smartphones, Computer etc.) 2 Jahre nach Ablieferung der Sache (§ 438 I Nr. 3, II BGB) beträgt und beim Kauf einer gebrauchten Sache auf ein Jahr verkürzt werden darf (§ 476 II BGB).
Da sich – wie aufgezeigt – die Verjährungsfristen gem. § 438 I BGB nur auf die Ansprüche aus § 437 Nr. 1 und 3 BGB beziehen (also auf Nacherfüllung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz) und es sich beim Rücktritt nicht um einen Anspruch, sondern um ein Gestaltungsrecht handelt (mit seiner Hilfe „gestaltet“ der Käufer das Schuldverhältnis neu), kann ein Rücktritt auch nicht der Verjährung unterliegen. Das heißt aber nicht, dass ein Rücktritt unbefristet ausgeübt werden könnte. Denn der Gesetzgeber hat die Frist zur Ausübung dieses Rechts an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs gekoppelt. Ein Rücktritt ist also nicht mehr möglich, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist und der Verkäufer sich hierauf beruft (§ 438 IV i.V.m. § 218 BGB). Nach den Sachverhaltsangaben ist nicht davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärungen der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt war.
Möglicherweise ist aber der von K erklärte Rücktritt wegen § 323 V S. 2 BGB unwirksam. Denn dadurch, dass die Rücktrittsfolgen für den Verpflichteten mitunter sehr weit reichend sind, hat der Gesetzgeber angeordnet, dass der Rücktritt ausgeschlossen ist, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist (§ 323 V S. 2 BGB), wobei es im Kaufrecht auf die Erheblichkeit des Sachmangels ankommt. Bei behebbaren Mängeln bei Neuwagen hat der BGH die Erheblichkeitsschwelle bei 5% angesiedelt (Rn. 47 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.; BGH NJW 2017, 153 Rn. 27; BGH DAR 2018, 78), aber gleichzeitig betont, dass diese Grenze nicht absolut gelte, sondern (wie) stets eine umfassende Interessenabwägung auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen sei (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.; BGH DAR 2018, 78). Jedoch werde es dem Käufer bei Sachmängeln unterhalb dieser Schwelle i.d.R. zuzumuten sein, am Vertrag festzuhalten und sich – nach erfolglosem Nachbesserungsverlangen – mit einer Minderung des Kaufpreises oder mit der Geltendmachung des kleinen Schadensersatzes zu begnügen, weil anderenfalls der Verkäufer nicht hinreichend vor den für ihn wirtschaftlich meist nachteiligen Folgen eines Rücktritts wegen geringfügiger Mängel geschützt wäre (BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.). Aber auch unterhalb der genannten Geringfügigkeitsschwelle kann durchaus eine Erheblichkeit der Pflichtverletzung angenommen werden. So indiziert ein Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung i.d.R. die Erheblichkeit einer Pflichtverletzung (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW-RR 2010, 1289 Rn. 23; BGH NJW 2013, 1365 Rn. 16). Auch im Fall eines arglistigen Verhaltens des Verkäufers ist nach dem BGH in aller Regel eine Unerheblichkeit der Pflichtverletzung zu verneinen (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGHZ 167, 19).
Da vorliegend – auch und gerade nach dem BGH – ein Verstoß gegen die Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt, greift an sich die genannte Indizwirkung. Gleichwohl betont der BGH das Erfordernis einer umfassenden Interessenabwägung (Rn. 51 f. des Urteils) und nimmt Bezug auf die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung. Dieses hatte festgestellt, dass lediglich ein geringfügiger Mangel vorliege, und dabei – so der BGH – entscheidend darauf abgestellt, dass die Möglichkeit bestanden habe, das Fahrzeug „problemlos mit zugelassenen, im optischen Erscheinungsbild ähnlichen Felgen zu versehen“. Daher könne nicht von einer erheblichen Funktionsstörung ausgegangen werden. Die Kosten des Erwerbs neuer, vergleichbarer Felgen und des Aufziehens der Reifen hierauf beliefen sich inklusive des Montageaufwands auf weniger als fünf Prozent des Kaufpreises.
Damit greift der BGH die bereits erläuterte Rechtsprechung auf, wonach auch bei einem Stückkauf eine Nacherfüllung durch Lieferung einer anderen, mangelfreien Sache nicht von vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen, sondern nach der Vorstellung der Parteien möglich sei, wenn die Kaufsache im Fall ihrer Mangelhaftigkeit durch eine gleichartige und gleichwertige ersetzt werden könne (BGHZ 168, 64 ff.). Zur Begründung verweist der BGH auf den Wortlaut des § 439 I BGB, der einen Anspruch auf Nachlieferung nicht ausdrücklich auf eine Gattungsschuld beschränkt. Zudem ergebe sich dies aus den Gesetzesmaterialien zur Schuldrechtsreform 2002 (vgl. die Regierungsbegründung: „Nacherfüllung ist nicht bei jedem (!) Stückkauf möglich“ und „bei dem Kauf einer bestimmten gebrauchten Sache … eine Nachlieferung zumeist (!) von vornherein ausscheiden wird“ (BT-Drs. 14/6040, S. 209 und 232). Damit gehe auch der Gesetzgeber davon aus, dass eine Nachlieferung bei einem Stückkauf nicht von vornherein ausgeschlossen sei. Schließlich sei die Ersetzbarkeit auch Art. 3 III i.V.m. dem Umkehrschluss aus Erwägungsgrund Nr. 16 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.5.1999 – dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019 Rn. 464b ff. und 969 ff.) zu entnehmen (BGHZ 168, 64, 71 ff. – und in der Folge BGH WM 2019, 424, 425 ff.; OLG Karlsruhe 6.12.2018 – 17 U 4/18; OLG Köln 6.3.2018 – 16 U 110/17; OLG Bamberg DAR 2018, 143; LG Heidelberg 30.6.2017 – 3 O 6/17; OLG Naumburg 22.11.2018 – 1 U 57/18; zuvor schon LG Ellwangen NJW 2003, 517; OLG Braunschweig NJW 2003, 1053, 1054; OLG Hamm NJW-RR 2005, 1220; OLG Schleswig NJW-RR 2005, 1579; Gsell, JuS 2007, 97 ff.; Roth, NJW 2006, 2953 ff.; Kitz, ZGS 2006, 419 ff.; Ball, NVZ 2004, 217, 220; Canaris, JZ 2003, 831, 835; Bitter/Meidt, ZIP 2001, 2114, 2119; Ellenberger, in: Palandt, § 91 Rn 4; Weidenkaff, in: Palandt, § 439 Rn 15; siehe auch Lorenz, in: MüKo, Vor § 474 Rn 17 – in Abkehr von JZ 2001, 742, 743; Lorenz/Arnold, JuS 2014, 7, 8)).
Ergebnis: Mithin scheitert die Nachlieferung anderer, mangelfreier Felgen nicht an der Einordnung des Kaufs als Stückkauf. Folge wäre demnach die Unwirksamkeit des Rücktritts wegen § 323 V S. 2 BGB, zumal der BGH formuliert, dass die vom Berufungsgericht vorgenommene Abwägung wohl nicht zu beanstanden gewesen wäre, wenn sich hierin (womit insbesondere das Nichterreichen der Erheblichkeitsschwelle von 5% gemeint ist, s.o.) die Folgen der Verwendung von für das Fahrzeugmodell nicht zugelassenen Felgen erschöpften. Davon sei im Revisionsverfahren jedoch mangels hinreichender Feststellungen des Berufungsgerichts nicht auszugehen. Das Berufungsgericht habe nicht in den Blick genommen, dass die Montage nicht zugelassener Felgen unter den Voraussetzungen des § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO – sofern kein Ausnahmefall nach § 19 III StVZO gegeben sei – zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führt, und habe es infolgedessen versäumt, Feststellungen dazu zu treffen, ob hierdurch eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten stehe.
Bewertung: Das verwundert, da der BGH bei der Feststellung des Sachmangels das Erlöschen der BE (zu Recht) nicht annehmen mochte. Ist also eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht hinreichend dargelegt und war damit insoweit ein Sachmangel zu verneinen, kann nunmehr nicht unter demselben Aspekt die Erheblichkeit der Pflichtverletzung bejaht werden. Vielmehr war der Mangel durch Lieferung anderer, mangelfreier Zubehörfelgen zu beheben. Die Weigerung des V, nachzuliefern, hätte ausschließlich zur Gewährung des Minderungsrechts (bzw. des Anspruchs auf Schadensersatz) führen dürfen. Die Auffassung des BGH überzeugt daher nicht. Ihr ist nicht zu folgen.
Rolf Schmidt (27.06.2020)
BGH, Urteil v. 11.12.2019 – VIII ZR 361/18 (NJW 2020, 1287)
Mit Urteil v. 11.12.2019 hat der BGH entschieden, dass die Angabe „Allgemeine Betriebserlaubnis“ (im Folgenden: ABE) hinsichtlich mitverkaufter Zubehörteile (hier: Zubehörfelgen) eine Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d. § 434 I S. 1 BGB in Bezug auf das Kfz darstellt. Fehle es daran, sei das Kfz mangelbehaftet und Gegenstand von Mängelrechten (hier: Rücktritt vom Vertrag). Ob das Urteil angesichts der Tatsache überzeugt, dass der Mangel eigentlich nur ein Zubehörteil betrifft und der Wagen als solcher ja mangelfrei ist, soll – gerade mit Blick auf die gravierenden Folgen eines Rücktritts – im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt: K schloss als Verbraucher mit dem Autohändler V einen Kaufvertrag über einen fünf Jahre alten Pkw der Marke BMW zum Preis von 31.750 €. Im schriftlichen Kaufvertrag findet sich u.a. der folgende Zusatz: „Inkl. 1 x Satz gebrauchte Winterräder auf Alufelgen (ABE [= Allgemeine Betriebserlaubnis] für Winterräder wird nachgereicht).“ Das Fahrzeug wurde K nach Zahlung des Kaufpreises noch am selben Tag mit achtfacher Bereifung übergeben, wobei (wegen der winterlichen Jahreszeit) die Winterräder montiert waren. Die Felgen der Winterräder stammten nicht vom Hersteller des Fahrzeugs; vielmehr waren sie lediglich mit einem BMW-Emblem versehen und für das verkaufte Pkw-Modell nicht zugelassen. Im Frühling stellte K fest, dass bei seinem Fahrzeug die hintere Federung nicht funktionierte. Er unterrichtete V hierüber, übertrug diesem aber nicht die Behebung des gerügten Mangels, sondern ließ die Luftfederung zwei Tage später bei einem Kfz-Meisterbetrieb seiner Wahl austauschen. Hierfür fielen Kosten i.H.v. 981,45 € an, deren Erstattung V ablehnte. Wieder einige Monate später trat am Pkw ein Defekt am Turbolader auf. Dieser wurde von V ersetzt. K macht geltend, V habe einen leistungsstärkeren und älteren Turbolader eines anderen Herstellers eingebaut, weswegen eine ordnungsgemäße Nachbesserung nicht erfolgt sei. Nachdem eine Einigung zwischen den Parteien nicht zustande gekommen war, erklärte K unter Bezugnahme auf den bisherigen Schriftverkehr den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte V auf, ihm Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis i.H.v. 31.750 € abzüglich einer Nutzungsentschädigung von 793,75 €, mithin 30.956,25 €, zurückzuzahlen sowie ihm die An- und Abmeldekosten von insgesamt 120 € und die angefallenen Kosten für die Erneuerung der Luftfederung i.H.v. 981,45 € zu erstatten.
Später – nach Klageerhebung bzgl. des Streits um die defekte Luftfederung und den Turbolader – setzte K dem V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder und verlangte Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs.
II. Vorüberlegung: Zunächst erscheint das Vorgehen des K wenig konsistent und nachvollziehbar, wenn er nach einem erklärten Rücktritt einen weiteren „hinterherschiebt“. Das mag einem „Absicherungsbestreben“ geschuldet sein, weil K später der Auffassung gewesen sein könnte, die zunächst vorgebrachten Gründe würden für einen erfolgreichen Rücktritt nicht genügen. Damit kommen für einen Rücktritt insgesamt folgende Gründe in Betracht:
- defekte Luftfederung
- defekter Turbolader
- fehlende ABE der Zubehörfelgen
III. Prüfung: Die Voraussetzungen für einen kaufrechtlichen Rücktritt ergeben sich aus §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 323, 326 V BGB. Diese sind:
- Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
- Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
- Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
- Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
- Verkäufer hat seine in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung nicht geleistet
- Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
- Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. bei wirksamem Ausschluss der Mängelrechte, Verjährung oder bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB)
1. Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB)
V und K haben einen Kaufvertrag über einen fünf Jahre alten Pkw der Marke BMW zum Preis von 31.750 € geschlossen. Einwendungen wie Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB), Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB) oder Anfechtung (§ 142 I BGB, §§ 119 ff. BGB) sind nicht erkennbar. Ein wirksamer Kaufvertrag liegt vor.
2. Leistung ist fällig (§ 323 I BGB)
Um einen Rücktritt auszuüben, muss die Leistung fällig sein. § 323 I BGB stellt dies klar. Die Fälligkeit ergibt sich aus § 271 BGB. Gemeint ist der Zeitpunkt, an dem der Schuldner spätestens leisten muss. Vor Fälligkeit ist ein Rücktritt grundsätzlich nicht möglich, außer, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden. Dann kann gem. § 323 IV BGB der Gläubiger bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung zurücktreten. Vorliegend steht die Fälligkeit außer Zweifel.
3. Kaufgegenstand weist einen Sach- oder Rechtsmangel (§§ 434, 435 BGB) bei Gefahrübergang (§§ 446, 447 BGB) auf
Kaufgegenstand ist der fünf Jahre alte BMW nebst Zubehörfelgen. Am Kaufgegenstand müsste zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Sach- oder Rechtsmangel vorgelegen haben. Vorliegend kommt allein ein Sachmangel in Betracht. Das richtet sich nach § 434 BGB. Nach § 434 I S. 1 BGB ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Das heißt: Ein Mangel liegt demnach vor, wenn die Ist-Beschaffenheit zum Nachteil des Käufers von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht. Auf die Kriterien des § 434 I S. 2 BGB ist nur dann einzugehen, wenn nach § 434 I S. 1 BGB kein Mangel festgestellt werden kann. Die (prüfungstechnische) Nachrangigkeit der Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB ergibt sich aus der Formulierung: „Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn...“.
a. Defekte Luftfederung und defekter Turbolader
Hinsichtlich der Luftfederung und des Turboladers ist keine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB ersichtlich. Ein Sachmangel kann sich daher lediglich aus § 434 I S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB ergeben. Jedenfalls darf ein Käufer eine funktionierende Luftfederung und einen funktionierenden Turbolader bei Autos, die mit diesen Teilen ausgestattet sind, erwarten. Ein Sachmangel liegt gem. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB vor.
b. Zubehörfelgen ohne ABE
Hinsichtlich der Zubehörfelgen könnte indes eine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB vorliegen. Dagegen spricht aber, dass die Zubehörfelgen nicht Gegenstand eines separaten Kaufgegenstands waren. Kaufgegenstand war vielmehr der BMW, der neben den Werksfelgen lediglich über einen zweiten Satz Felgen (die Zubehörfelgen) verfügte. Der BMW selbst (i.V.m. den Werksfelgen) ist ja nicht von der fehlenden ABE der Zubehörfelgen betroffen. Daher meinte die Revision (OLG Stuttgart 13.11.2018 – 10 U 46/18, folgend auf LG Heilbronn, 16.02.2018 – 11 O 144/17), die vertragliche Abrede betreffe nur die Beschaffenheit des Wagens als „eigentlichen“ Kaufgegenstand und erstrecke sich nicht auf die mitgelieferten Zubehörfelgen. Der BGH ist dem entgegengetreten. Die Parteien hätten im Kaufvertrag vereinbart, dass auch ein Satz gebrauchter Winterräder auf Alufelgen Kaufgegenstand sei und dass V die ABE für die Winterräder nachreiche. Diese Abrede habe bei der gebotenen interessengerechten Auslegung zum Inhalt, dass V für das Vorhandensein einer ABE der Felgen für das verkaufte Fahrzeug in vertragsgemäß bindender Weise die Gewähr übernehme und damit seine Bereitschaft zu erkennen gebe, für alle gewährleistungsrechtlichen Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen (Rn. 35 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2017, 2817 Rn. 13; BGH NJW 2019, 1937 Rn. 22). Zudem werde ein Käufer, der – wie hier – Wert auf die Nutzung zugelassener Räder legt, bei objektiver Betrachtung im Fall der Kenntniserlangung von dem Nichtvorliegen einer Betriebserlaubnis für die Felgen das Fahrzeug nicht in einer den getroffenen Vereinbarungen entsprechenden Form (also unter Verwendung der mitgelieferten Zubehörfelgen) nutzen wollen und dürfen (Rn. 36 des Urteils). Außerdem liege der Regelung des § 434 I BGB nach der Rechtsprechung des BGH ein weiter Beschaffenheitsbegriff zugrunde. Danach seien als Beschaffenheit einer Sache i.S.v. § 434 I BGB sowohl alle Faktoren anzusehen, die der Sache selbst anhafteten, als auch alle Beziehungen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache hätten (Rn. 37 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2016, 2874 Rn. 10; BGH NJW 2013, 1948 Rn. 15; BGH NJW 2013, 1671 Rn. 10)).
Danach umfasse die Beschaffenheitsvereinbarung auch die – bei Gefahrübergang montierten – Zubehörfelgen. Seien diese (wegen Fehlens einer ABE) mangelbehaftet, sei auch der Wagen mangelbehaftet. Diesem fehle damit die vereinbarte Beschaffenheit nach § 434 I S. 1 BGB.
Ist damit ein Sachmangel unter dem Aspekt der für K negativen Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der vertraglichen vereinbarten Soll-Beschaffenheit (§ 434 I S. 1 BGB) gegeben, erübrigt sich ein Eingehen auf die Kriterien des § 434 I S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB (Subsidiarität der Hilfskriterien, s.o.). Gleichwohl prüft der BGH relativ ausführlich, ob das Fehlen einer ABE bezüglich der Felgen (vgl. § 22 StVZO) zu einem Sachmangel des Wagens unter dem Aspekt des § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB führt, wonach eine Sache (nur dann) frei von Sachmängeln ist, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Dieser Prüfung liegt der Gedanke zugrunde, dass das Fehlen einer ABE der Zubehörfelgen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis (BE) des Fahrzeugs führen könnte. Wäre dies der Fall, bestünde durchaus ein Mangel (auch) i.S.d. § 434 I S. 2 Nr. 2 BGB.
Anm.: Die Prüfung des BGH ist dem Umstand geschuldet, dass das Berufungsgericht den Sachmangel unter diesem Aspekt geprüft (und bejaht) hat. Daher war eine Auseinandersetzung in der Revision wegen des geltend gemachten Rechtsfehlers angezeigt.
Im Einzelnen führt der BGH hierzu aus, dass das Fehlen einer ABE bezüglich der Felgen, für die auch keine Einzelbetriebserlaubnis nach §§ 21, 22 II S. 4 StVZO oder ein Nachtrag zur BE des Fahrzeugs nach §§ 22 III, 19 III Nr. 1 Buchst. b StVZO vorlegen hätten, nicht ohne Weiteres dazu führe, dass gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO (Erlöschen der BE des Fahrzeugs, wenn durch vorgenommene Änderungen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist) die BE für das Fahrzeug erlösche. Vielmehr setze dies voraus, dass die – mit der Nutzung nicht zugelassener Felgen verbundene – nachträgliche Veränderung mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer verursache (Rn. 30 des Urteils mit Verweis u.a. auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 27 u. 29). Damit nimmt der BGH also eine teleologische Interpretation des Merkmals „Erlöschen der BE des Fahrzeugs, wenn durch vorgenommene Änderungen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist“ vor. Die „Erwartung der Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer“ muss also auf konkreten Anhaltspunkten basieren und darf nicht generalisierend angenommen werden. So lässt sich nach Auffassung des BGH das Maß der für ein Erlöschen der BE erforderlichen Gefahr nicht abstrakt und absolut bestimmen. Denn der zu fordernde Wahrscheinlichkeitsgrad hänge von der Bedeutung der gefährdeten Rechtsgüter und dem Ausmaß des möglichen Schadens ab (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 32). Behörden und Gerichte hätten daher für jeden konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Veränderung – sei es durch unsachgemäßen Anbau eines an sich ungefährlichen Fahrzeugteils, sei es durch den Betrieb eines sachgerecht angebauten, aber gefährlichen Teils – eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lasse (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 31 f.; OLG Köln NZV 1997, 283, 284).
Die vereinzelt von Zivilgerichten vertretene Auffassung, die Voraussetzungen des § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO seien regelmäßig erfüllt, wenn Änderungen vorgenommen würden, die das Fahrverhalten beeinflussten, was bei Änderungen an Reifen, Felgen und Fahrwerk ohne Weiteres der Fall sei (OLG Bamberg DAR 2005, 619), treffe daher nicht zu (Rn. 32 des Urteils). Es möge zwar sein, dass bei Veränderungen an den Rädern eines Fahrzeugs ein Indiz für eine zu erwartende Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bestehe, weil sie für die Verkehrssicherheit von besonderer Bedeutung seien (hier erfolgt der Verweis auf KG, Urt. v. 27.3.1998 – 2 Ss 341/97, 3 Ws [B] 76/98 Rn. 9). Gleichwohl setze die erforderliche Prognose der Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer Feststellungen zu Art und Typ der geänderten Bereifung, zu Art und Umfang der Abweichung vom Originalzustand und zu dem Einfluss der Abweichung auf die Verkehrssicherheit voraus (hier erfolgt der erneute Verweis auf KG, Urt. v. 27.3.1998 – 2 Ss 341/97, 3 Ws [B] 76/98 Rn. 9).
Sein Ergebnis untermauert der BGH mit den Gesetzesmaterialien zur StVZO. Danach sei weder die Veränderung von Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit vorgeschrieben sei, noch die bloße Möglichkeit einer Gefährdung ausreichend, um die BE gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO erlöschen zu lassen (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf BR-Drs. 629/93, 17 und u.a. auf VGH Mannheim NJOZ 2012, 904 Rn. 31). Dem Genügenlassen der bloßen Möglichkeit einer Gefährdung stehe auch schon der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entgegen (Rn. 31 des Urteils mit Verweis auf BR-Drs. 629/93, S. 17). Erforderlich sei daher, dass durch die nachträgliche Veränderung mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer geschaffen werde.
Fazit: Mithin fasst der BGH sein Ergebnis mit folgendem Leitsatz zusammen: „Die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erlischt im Falle nachträglicher Veränderungen (hier: Montage nicht zugelassener Felgen) nur dann, wenn diese mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer verursachen. Dabei haben Behörden und Gerichte für jeden konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lässt.“
Stellungnahme: Den Ausführungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gem. § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO ist beizupflichten. Die Gefährdung für andere Straßenverkehrsteilnehmer muss konkret sein und ggf. mittels Sachverständigengutachten festgestellt werden. Die Montage von Zubehörfelgen, die an sich genehmigungsfähig sind (weil sie die materiellen Prüfkriterien erfüllen), bei denen aber die (formale) Zulassung fehlt, führt daher nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Nicht genehmigungsfähige Felgen begründen demgegenüber stets eine konkrete Gefährdung und führen zum Erlöschen der BE des Fahrzeugs. Da dies im vorliegenden Fall vom Berufungsgericht nicht festgestellt wurde, kam der BGH zu dem zutreffenden Ergebnis, dass sich ein Sachmangel (am Fahrzeug) nicht mit der fehlenden ABE der Zubehörfelgen herleiten ließ.
Im Ergebnis ist damit mit dem BGH ein Sachmangel gegeben. Der Sachmangel lässt sich zwar nicht auf eine etwaig erloschene BE des Fahrzeugs stützen, weil die für ein Erlöschen der BE nach § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO erforderliche konkrete Gefährdung für andere Straßenverkehrsteilnehmer nicht festgestellt wurde (es blieb unklar, ob die Zubehörfelgen genehmigungsfähig waren), sondern darauf, dass die mitverkauften, zum Zeitpunkt der Übergabe am Fahrzeug montierten Zubehörfelgen nicht über eine ABE verfügten, das Vorliegen einer ABE aber Bestandteil der Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I S. 1 BGB war. Da die ABE bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Fahrzeugs fehlte, liegt der Sachmangel auch zum maßgeblichen Zeitpunkt gem. § 446 BGB vor.
4. Fristsetzung durch Käufer (ggf. Entbehrlichkeit einer Fristsetzung beachten – etwa nach § 323 II BGB, nach § 326 V BGB oder wegen Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs)
Weiterhin müsste gem. § 323 I BGB K grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. K setzte dem V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder und verlangte Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Dadurch, dass K gleichzeitig das Rückzahlungsbegehren geltend machte, hat er keine – und damit auch keine angemessene – Frist zur Nacherfüllung gesetzt.
Möglicherweise war eine Fristsetzung aber entbehrlich. Geht es um einen Verbrauchsgüterkauf, also um einen Kauf, bei dem – wie vorliegend – der Käufer einer beweglichen Sache Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist und der Verkäufer ein Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB, sind die Vorgaben des Art. 3 V der europäischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EG) zu beachten, wonach bei einem Verbrauchsgüterkauf der Rücktritt des Verbrauchers (bereits dann) zulässig ist, wenn er innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgt (vgl. Art. 3 V RL 1999/44/EG, wo es in der englischen Fassung heißt: „within a reasonable time“, also „innerhalb einer angemessenen Zeit“, und wo von einer „Fristsetzung“ nichts zu lesen ist). Das Erfordernis einer Fristsetzung in § 323 I BGB widerspricht also dieser Regelung. Jedoch hätte K auch danach eine angemessene Zeit abwarten müssen und hätte nicht gleichzeitig mit der Mangelbeseitigungsaufforderung den Rücktritt erklären dürfen.
Die Entbehrlichkeit der Fristsetzung könnte sich aber gem. § 326 V BGB unter dem Aspekt „Ausschluss der Leistungspflicht gem. § 275 I BGB“ ergeben. Wird dem Verkäufer die Nacherfüllung (in beiden Varianten des § 439 I BGB!) unmöglich, greift § 275 I BGB mit der Folge der Befreiung von der Leistungspflicht. Muss der Verkäufer demnach also nicht mehr nacherfüllen, würde eine Fristsetzung keinen Sinn machen. Der Käufer kann sofort zurücktreten, § 326 V BGB. Zu prüfen ist daher, ob eine Nacherfüllung in beiden Varianten, also in der Variante der Nachbesserung und in der Variante der Nachlieferung, unmöglich war.
- Nachbesserung:
Mit dieser Variante ist Reparatur bzw. Ausbesserung gemeint, die sowohl bei einer Gattungsschuld als auch bei einer Stückschuld denkbar ist. Geht man davon aus, dass eine ABE für die mitverkauften Zubehörfelgen nicht beschaffbar ist (weil es sie nicht gibt), kann V nicht nachbessern. Die Möglichkeit der Legalisierung der Felgen durch Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO wurde – soweit ersichtlich – von V nicht angeboten.
- Nachlieferung: Diese Variante beschreibt die Lieferung einer anderen, mangelfreien Sache, wobei der BGH nicht deutlich genug herausarbeitet, ob die Nachlieferung in der Aushändigung der ABE für die mitverkauften Zubehörfelgen oder in der Lieferung anderer, gleichartiger Felgen mit ABE besteht. Allerdings ist von Letzterem auszugehen.
Möglicherweise ist die Nachlieferung aber von vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen. Denn bei einer sog. Stückschuld (Speziesschuld), d.h. bei einem Schuldverhältnis, bei dem die geschuldete Sache nach individuellen Merkmalen konkret bestimmt (und daher nicht austauschbar) ist, ist der Erfüllungsanspruch im Ausgangspunkt der Systematik auf die konkrete Sache begrenzt. Typische Fälle einer Stückschuld sind der Kauf von neuen Einzelstücken und von allen gebrauchten Sachen, da hier die Individualität im Vordergrund steht. Ein Anspruch auf Lieferung einer Ersatzsache kommt grds. nicht in Betracht, weil sich die Verbindlichkeit des Schuldners i.d.R. gerade auf diesen individualisierten Gegenstand beschränkt. Kann die Primärpflicht nicht erfüllt werden, tritt nach den Regeln des allgemeinen Schuldrechts grds. Unmöglichkeit (§ 275 I BGB) ein mit der Folge, dass der Schuldner frei wird von seiner Leistungsverpflichtung. Eine Ersatzlieferung scheidet damit grds. aus.
Jedoch ist im Kaufrecht auch bei einer Stückschuld Nachlieferung nicht von vornherein ausgeschlossen. Kann der Verkäufer eine vergleichbare (d.h. gleichartige und gleichwertige) Sache beschaffen bzw. liefern, ist nach Auffassung des BGH von Erfüllungstauglichkeit der Ersatzsache auszugehen, wenn dies dem durch Auslegung zu ermittelnden (objektivierten) Willen (§§ 133, 157 BGB) der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses entspricht (BGHZ 168, 64, 71 ff. unter Berufung auf die Gesetzesmaterialien zur Schuldrechtsreform 2002 BT-Drs. 14/ 6040, S. 232). Bei Gebrauchtwagen z.B. dürften maßgebliche Kriterien Alter, Farbe, Ausstattung, Zustand, Laufleistung, Anzahl der Vorhalter, bisherige Einsatzbedingungen etc. sein. Ist danach von einer Nacherfüllungstauglichkeit auszugehen und kann der Verkäufer nachliefern, tritt keine Unmöglichkeit ein.
Auch im vorliegenden Fall ist nach Auffassung des BGH eine Nacherfüllung in Form der Ersatzlieferung nicht von vornherein ausgeschlossen. Ob eine Ersatzbeschaffung vorliegend möglich und geschuldet war/ist, hänge davon ab, ob nach dem durch interessengerechte Auslegung zu ermittelnden Willen der Parteien (§§ 133, 157 BGB) bei Vertragsschluss eine Nachlieferung von gleichartigen und gleichwertigen Felgen, die für das Fahrzeug zugelassen sind, in Betracht kommen sollte. Eine solche Ersatzbeschaffung scheide nicht schon deshalb aus, weil es sich bei dem Erwerb des gebrauchten Fahrzeugs inklusive Zubehörfelgen um einen Stückkauf handele (Rn. 41 des Urteils mit Verweis auf BGHZ 168, 64; BGHZ 170, 86; BGH NJW 2019, 1133 Rn. 31). Vielmehr sei der Gesetzgeber bei der Schuldrechtsmodernisierung davon ausgegangen, dass das Interesse des Käufers, eine mangelfreie Sache zu erhalten, „in den meisten Fällen“ – auch beim Stückkauf – durch Nachbesserung oder Lieferung einer anderen, gleichartigen Sache befriedigt werden könne (hier erfolgt der Verweis auf BT-Drs. 14/6040, S. 89, 220, 230). Entscheidend sei letztlich, ob und in welchem Umfang der Verkäufer eine Beschaffungspflicht übernommen habe (Rn. 41 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2019, 1133 Rn. 31 ff.). Maßgeblich sei, ob nach den Vorstellungen der Parteien die Kaufsache im Fall ihrer Mangelhaftigkeit nach dem Vertragszweck und ihrem erkennbaren Willen durch eine gleichartige und gleichwertige Sache ersetzt werden könne, also austauschbar sei (Rn. 42 des Urteils mit Verweis auf BGHZ 168, 64; BGH NJW 2019, 1133 Rn. 34; BGH NJW 2018, 789). Dies könne insbesondere im Hinblick darauf, dass im Streitfall nicht das Fahrzeug selbst, sondern nur ein zusätzlich veräußerter Satz gebrauchter Zubehörfelgen mit Winterreifen von der Nacherfüllung betroffen sei, nicht schon im Ansatz verneint werden.
Allerdings macht der BGH auch deutlich, dass trotz abstrakter Nachlieferungsmöglichkeit die Nachlieferung durchaus ausgeschlossen sein kann, wenn der Käufer das Fahrzeug zuvor persönlich besichtigt habe und es ihm ausschließlich um dieses konkrete, mit der konkreten Ausstattung und mit individuellen Merkmalen versehene Auto gegangen sei und daher davon ausgegangen werden könne, das Fahrzeug solle in seiner Gesamtheit nicht gegen ein anderes austauschbar sein (BGHZ 168, 64, 71 ff.).
Da das Berufungsgericht zu alledem keine Feststellung getroffen hatte, konnte der BGH diese nicht auf Rechtsfehler hin überprüfen, sodass der BGH seine Rechtsprüfung auf das Fehlen der erforderlichen Feststellungen beschränken musste. Im Ergebnis bleibt daher offen, wie das Berufungsgericht, an das der BGH den Streit zurückverwiesen hat (Rn. 58 des Urteils), nach erneuter Beweisaufnahme entscheiden wird. Es wird u.a. zu ermitteln haben, ob es K insbesondere um die mitverkauften Felgen gegangen war. Sodann wird es festzustellen haben, ob nach dem durch interessengerechte Auslegung zu ermittelnden Willen der Parteien (§§ 133, 157 BGB) bei Vertragsschluss eine Nachlieferung von gleichartigen und gleichwertigen Felgen, die für das Fahrzeug zugelassen sind, in Betracht kommen sollte. Nach Auffassung des Bearbeiters ist das anzunehmen. Es ist kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich, dass K den Wagen allein oder überwiegend deswegen kaufte, weil diese konkreten Zubehörfelgen mitumfasst waren. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er die fehlende ABE vorschob, um sich des Wagens durch Rücktritt einigermaßen schadlos zu entledigen.
Im Ergebnis
ist daher von der Nacherfüllungstauglichkeit auszugehen: V kann durch Lieferung von anderen, gleichartigen und gleichwertigen (und zugelassenen bzw. zulassungsfähigen) Felgen nacherfüllen. Sollte V sich weigern, bleibt K der Weg über Kaufpreisminderung, nicht aber der Rücktritt.
5. Verkäufer hat seine in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung nicht geleistet
V hat trotz Aufforderungen keine ABE für die Felgen nachgeliefert und damit nicht die in angemessener Frist (oder Zeit) vorzunehmende Nacherfüllung geleistet.
6. Käufer hat Rücktritt erklärt (§ 349 BGB)
Die Rücktrittserklärung könnte darin gesehen werden, dass K infolge nicht erzielter Einigung über die Übernahme der Reparaturkosten des Luftfahrwerks (Luftfederung) und des verbauten Austauschturboladers unter Bezugnahme auf den bisherigen Schriftverkehr den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärte und V aufforderte, ihm Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zu erstatten. Weiterhin könnte die Rücktrittserklärung darin gesehen werden, dass K später V per E-Mail eine Frist zur Aushändigung der ABE für die Felgen der Winterräder setzte und Zahlung von 32.057,70 € nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs verlangte.
Die jeweilige Rücktrittserklärung betrifft also den in Bezug genommenen Mangel.
7. Nichteingreifen von Ausschlussgründen (wie z.B. bei wirksamem Ausschluss der Mängelrechte, Verjährung oder bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung nach § 323 V S. 2 BGB)
Ein Ausschluss der Mängelrechte wurde ersichtlich nicht vereinbart. Einem Ausschluss stünde aber auch § 476 I S. 1 BGB entgegen, wonach eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Verbrauchers u.a. von den §§ 433-435, 437, 439-443 BGB abweicht, unwirksam ist. Bei einem Verbrauchsgüterkauf, also in erster Linie bei einem Kaufvertrag über eine neue oder gebrauchte bewegliche Sache, bei dem auf Verkäuferseite ein Unternehmer (§ 14 I BGB) und auf Käuferseite ein Verbraucher (§ 13 BGB) steht (vgl. § 474 I S. 1 BGB), ist ein Ausschluss der Gewährleistung schlicht unwirksam. Da es sich vorliegend um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, wäre also eine etwaige Vereinbarung über einen Gewährleistungsausschluss unwirksam.
Eine Verjährung liegt ebenfalls nicht vor. Mängelansprüche nach § 437 Nr. 1 BGB (Nacherfüllung) und § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz, Aufwendungsersatz) unterliegen der Verjährung des § 438 BGB, die bei beweglichen Sachen (z.B. Autos, Smartphones, Computer etc.) 2 Jahre nach Ablieferung der Sache (§ 438 I Nr. 3, II BGB) beträgt und beim Kauf einer gebrauchten Sache auf ein Jahr verkürzt werden darf (§ 476 II BGB).
Da sich – wie aufgezeigt – die Verjährungsfristen gem. § 438 I BGB nur auf die Ansprüche aus § 437 Nr. 1 und 3 BGB beziehen (also auf Nacherfüllung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz) und es sich beim Rücktritt nicht um einen Anspruch, sondern um ein Gestaltungsrecht handelt (mit seiner Hilfe „gestaltet“ der Käufer das Schuldverhältnis neu), kann ein Rücktritt auch nicht der Verjährung unterliegen. Das heißt aber nicht, dass ein Rücktritt unbefristet ausgeübt werden könnte. Denn der Gesetzgeber hat die Frist zur Ausübung dieses Rechts an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs gekoppelt. Ein Rücktritt ist also nicht mehr möglich, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist und der Verkäufer sich hierauf beruft (§ 438 IV i.V.m. § 218 BGB). Nach den Sachverhaltsangaben ist nicht davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärungen der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt war.
Möglicherweise ist aber der von K erklärte Rücktritt wegen § 323 V S. 2 BGB unwirksam. Denn dadurch, dass die Rücktrittsfolgen für den Verpflichteten mitunter sehr weit reichend sind, hat der Gesetzgeber angeordnet, dass der Rücktritt ausgeschlossen ist, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist (§ 323 V S. 2 BGB), wobei es im Kaufrecht auf die Erheblichkeit des Sachmangels ankommt. Bei behebbaren Mängeln bei Neuwagen hat der BGH die Erheblichkeitsschwelle bei 5% angesiedelt (Rn. 47 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.; BGH NJW 2017, 153 Rn. 27; BGH DAR 2018, 78), aber gleichzeitig betont, dass diese Grenze nicht absolut gelte, sondern (wie) stets eine umfassende Interessenabwägung auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen sei (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.; BGH DAR 2018, 78). Jedoch werde es dem Käufer bei Sachmängeln unterhalb dieser Schwelle i.d.R. zuzumuten sein, am Vertrag festzuhalten und sich – nach erfolglosem Nachbesserungsverlangen – mit einer Minderung des Kaufpreises oder mit der Geltendmachung des kleinen Schadensersatzes zu begnügen, weil anderenfalls der Verkäufer nicht hinreichend vor den für ihn wirtschaftlich meist nachteiligen Folgen eines Rücktritts wegen geringfügiger Mängel geschützt wäre (BGH NJW 2014, 3229, 3230 f.). Aber auch unterhalb der genannten Geringfügigkeitsschwelle kann durchaus eine Erheblichkeit der Pflichtverletzung angenommen werden. So indiziert ein Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung i.d.R. die Erheblichkeit einer Pflichtverletzung (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGH NJW-RR 2010, 1289 Rn. 23; BGH NJW 2013, 1365 Rn. 16). Auch im Fall eines arglistigen Verhaltens des Verkäufers ist nach dem BGH in aller Regel eine Unerheblichkeit der Pflichtverletzung zu verneinen (Rn. 46 des Urteils mit Verweis auf BGHZ 167, 19).
Da vorliegend – auch und gerade nach dem BGH – ein Verstoß gegen die Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt, greift an sich die genannte Indizwirkung. Gleichwohl betont der BGH das Erfordernis einer umfassenden Interessenabwägung (Rn. 51 f. des Urteils) und nimmt Bezug auf die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung. Dieses hatte festgestellt, dass lediglich ein geringfügiger Mangel vorliege, und dabei – so der BGH – entscheidend darauf abgestellt, dass die Möglichkeit bestanden habe, das Fahrzeug „problemlos mit zugelassenen, im optischen Erscheinungsbild ähnlichen Felgen zu versehen“. Daher könne nicht von einer erheblichen Funktionsstörung ausgegangen werden. Die Kosten des Erwerbs neuer, vergleichbarer Felgen und des Aufziehens der Reifen hierauf beliefen sich inklusive des Montageaufwands auf weniger als fünf Prozent des Kaufpreises.
Damit greift der BGH die bereits erläuterte Rechtsprechung auf, wonach auch bei einem Stückkauf eine Nacherfüllung durch Lieferung einer anderen, mangelfreien Sache nicht von vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen, sondern nach der Vorstellung der Parteien möglich sei, wenn die Kaufsache im Fall ihrer Mangelhaftigkeit durch eine gleichartige und gleichwertige ersetzt werden könne (BGHZ 168, 64 ff.). Zur Begründung verweist der BGH auf den Wortlaut des § 439 I BGB, der einen Anspruch auf Nachlieferung nicht ausdrücklich auf eine Gattungsschuld beschränkt. Zudem ergebe sich dies aus den Gesetzesmaterialien zur Schuldrechtsreform 2002 (vgl. die Regierungsbegründung: „Nacherfüllung ist nicht bei jedem (!) Stückkauf möglich“ und „bei dem Kauf einer bestimmten gebrauchten Sache … eine Nachlieferung zumeist (!) von vornherein ausscheiden wird“ (BT-Drs. 14/6040, S. 209 und 232). Damit gehe auch der Gesetzgeber davon aus, dass eine Nachlieferung bei einem Stückkauf nicht von vornherein ausgeschlossen sei. Schließlich sei die Ersetzbarkeit auch Art. 3 III i.V.m. dem Umkehrschluss aus Erwägungsgrund Nr. 16 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.5.1999 – dazu R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019 Rn. 464b ff. und 969 ff.) zu entnehmen (BGHZ 168, 64, 71 ff. – und in der Folge BGH WM 2019, 424, 425 ff.; OLG Karlsruhe 6.12.2018 – 17 U 4/18; OLG Köln 6.3.2018 – 16 U 110/17; OLG Bamberg DAR 2018, 143; LG Heidelberg 30.6.2017 – 3 O 6/17; OLG Naumburg 22.11.2018 – 1 U 57/18; zuvor schon LG Ellwangen NJW 2003, 517; OLG Braunschweig NJW 2003, 1053, 1054; OLG Hamm NJW-RR 2005, 1220; OLG Schleswig NJW-RR 2005, 1579; Gsell, JuS 2007, 97 ff.; Roth, NJW 2006, 2953 ff.; Kitz, ZGS 2006, 419 ff.; Ball, NVZ 2004, 217, 220; Canaris, JZ 2003, 831, 835; Bitter/Meidt, ZIP 2001, 2114, 2119; Ellenberger, in: Palandt, § 91 Rn 4; Weidenkaff, in: Palandt, § 439 Rn 15; siehe auch Lorenz, in: MüKo, Vor § 474 Rn 17 – in Abkehr von JZ 2001, 742, 743; Lorenz/Arnold, JuS 2014, 7, 8)).
Ergebnis: Mithin scheitert die Nachlieferung anderer, mangelfreier Felgen nicht an der Einordnung des Kaufs als Stückkauf. Folge wäre demnach die Unwirksamkeit des Rücktritts wegen § 323 V S. 2 BGB, zumal der BGH formuliert, dass die vom Berufungsgericht vorgenommene Abwägung wohl nicht zu beanstanden gewesen wäre, wenn sich hierin (womit insbesondere das Nichterreichen der Erheblichkeitsschwelle von 5% gemeint ist, s.o.) die Folgen der Verwendung von für das Fahrzeugmodell nicht zugelassenen Felgen erschöpften. Davon sei im Revisionsverfahren jedoch mangels hinreichender Feststellungen des Berufungsgerichts nicht auszugehen. Das Berufungsgericht habe nicht in den Blick genommen, dass die Montage nicht zugelassener Felgen unter den Voraussetzungen des § 19 II S. 2 Nr. 2 StVZO – sofern kein Ausnahmefall nach § 19 III StVZO gegeben sei – zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führt, und habe es infolgedessen versäumt, Feststellungen dazu zu treffen, ob hierdurch eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten stehe.
Bewertung: Das verwundert, da der BGH bei der Feststellung des Sachmangels das Erlöschen der BE (zu Recht) nicht annehmen mochte. Ist also eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht hinreichend dargelegt und war damit insoweit ein Sachmangel zu verneinen, kann nunmehr nicht unter demselben Aspekt die Erheblichkeit der Pflichtverletzung bejaht werden. Vielmehr war der Mangel durch Lieferung anderer, mangelfreier Zubehörfelgen zu beheben. Die Weigerung des V, nachzuliefern, hätte ausschließlich zur Gewährung des Minderungsrechts (bzw. des Anspruchs auf Schadensersatz) führen dürfen. Die Auffassung des BGH überzeugt daher nicht. Ihr ist nicht zu folgen.
Rolf Schmidt (27.06.2020)
24.05.2020: BND auch bei Auslandsaufklärung an Grundrechte des Grundgesetzes gebunden
BVerfG, Urteil v. 19.05.2020 – 1 BvR 2835/17
Mit Urteil v. 19.05.2020 hat der 1. Senat des BVerfG entschieden, dass die Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den Bundesnachrichtendienst (BND) an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden ist und nach der derzeitigen Ausgestaltung der Ermächtigungsgrundlagen gegen das grundrechtliche Telekommunikationsgeheimnis (Art. 10 I GG) und die Pressefreiheit (Art. 5 I S. 2 GG) verstößt. Ob das Urteil angesichts der Notwendigkeit der strategischen Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt: Mehrere, überwiegend ausländische Journalisten, die im Ausland über Menschenrechtsverletzungen in Krisengebieten oder autoritär regierten Staaten berichten, wandten sich mit ihren Verfassungsbeschwerden gegen etliche Bestimmungen des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst (BNDG), konkret gegen die 2016 eingefügten (siehe dazu BT-Drs. 18/9041) Befugnisse zur strategischen Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den BND (§§ 6 ff. BNDG). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die strategische Fernmeldeaufklärung von Ausländern im Ausland vom Inland aus Erkenntnisse über internationale und übergeordnete, für die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland bedeutsame Themen gewinnen wie z.B. internationaler Terrorismus, Proliferation von Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen, internationale organisierte Kriminalität sowie politische Lageentwicklung in bestimmten Ländern (BT-Drs. 18/9041, S. 1). Durch die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung könne der BND ohne Zeitverzug aktuelle und authentische Informationen erlangen und damit besonders wichtige auftragsrelevante Erkenntnisse aus internationalen Datenströmen gewinnen (BT-Drs. 18/9041, S. 1). Dazu darf gem. § 6 I S. 1 BNDG der BND vom Inland aus mit technischen Mitteln Informationen einschließlich personenbezogener Daten aus Telekommunikationsnetzen, über die Telekommunikation von Ausländern im Ausland erfolgt (Telekommunikationsnetze), verarbeiten (Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung), wenn diese Daten erforderlich sind, um
Die Erhebung von Inhaltsdaten darf gem. § 6 II S. 1 BNDG dabei (nur) anhand von Suchbegriffen erfolgen. Konkrete Anlasstatbestände oder Verdachtsgrade nennt das BNDG indes nicht. Vielmehr genügt – bezogen auf die Kommunikation von Ausländern im Ausland – allein das allgemeine außen- und sicherheitspolitische Interesse zur Gewinnung von Anhaltspunkten für Gefahrenlagen (vgl. § 6 II S. 2 BNDG). Auf diese Weise erhobene Verkehrsdaten dürfen gem. § 6 VI S. 1 BNDG für höchstens sechs Monate gespeichert und (gem. § 6 VI S. 2 i.V.m. § 19 I BNDG) verarbeitet (und damit auch ausgewertet) werden. Insbesondere gegen diese Befugnisse richten sich die Verfassungsbeschwerden. Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des ihnen zustehenden Telekommunikationsgeheimnisses (Art. 10 I GG) und der ihnen zustehenden Pressefreiheit (Art. 5 I S. 2 GG).
BVerfG, Urteil v. 19.05.2020 – 1 BvR 2835/17
Mit Urteil v. 19.05.2020 hat der 1. Senat des BVerfG entschieden, dass die Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den Bundesnachrichtendienst (BND) an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden ist und nach der derzeitigen Ausgestaltung der Ermächtigungsgrundlagen gegen das grundrechtliche Telekommunikationsgeheimnis (Art. 10 I GG) und die Pressefreiheit (Art. 5 I S. 2 GG) verstößt. Ob das Urteil angesichts der Notwendigkeit der strategischen Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
I. Sachverhalt: Mehrere, überwiegend ausländische Journalisten, die im Ausland über Menschenrechtsverletzungen in Krisengebieten oder autoritär regierten Staaten berichten, wandten sich mit ihren Verfassungsbeschwerden gegen etliche Bestimmungen des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst (BNDG), konkret gegen die 2016 eingefügten (siehe dazu BT-Drs. 18/9041) Befugnisse zur strategischen Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den BND (§§ 6 ff. BNDG). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die strategische Fernmeldeaufklärung von Ausländern im Ausland vom Inland aus Erkenntnisse über internationale und übergeordnete, für die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland bedeutsame Themen gewinnen wie z.B. internationaler Terrorismus, Proliferation von Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen, internationale organisierte Kriminalität sowie politische Lageentwicklung in bestimmten Ländern (BT-Drs. 18/9041, S. 1). Durch die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung könne der BND ohne Zeitverzug aktuelle und authentische Informationen erlangen und damit besonders wichtige auftragsrelevante Erkenntnisse aus internationalen Datenströmen gewinnen (BT-Drs. 18/9041, S. 1). Dazu darf gem. § 6 I S. 1 BNDG der BND vom Inland aus mit technischen Mitteln Informationen einschließlich personenbezogener Daten aus Telekommunikationsnetzen, über die Telekommunikation von Ausländern im Ausland erfolgt (Telekommunikationsnetze), verarbeiten (Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung), wenn diese Daten erforderlich sind, um
1. frühzeitig Gefahren für die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland erkennen und diesen begegnen zu können,
2. die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu wahren oder
3. sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung über Vorgänge zu gewinnen (...).
Die Erhebung von Inhaltsdaten darf gem. § 6 II S. 1 BNDG dabei (nur) anhand von Suchbegriffen erfolgen. Konkrete Anlasstatbestände oder Verdachtsgrade nennt das BNDG indes nicht. Vielmehr genügt – bezogen auf die Kommunikation von Ausländern im Ausland – allein das allgemeine außen- und sicherheitspolitische Interesse zur Gewinnung von Anhaltspunkten für Gefahrenlagen (vgl. § 6 II S. 2 BNDG). Auf diese Weise erhobene Verkehrsdaten dürfen gem. § 6 VI S. 1 BNDG für höchstens sechs Monate gespeichert und (gem. § 6 VI S. 2 i.V.m. § 19 I BNDG) verarbeitet (und damit auch ausgewertet) werden. Insbesondere gegen diese Befugnisse richten sich die Verfassungsbeschwerden. Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des ihnen zustehenden Telekommunikationsgeheimnisses (Art. 10 I GG) und der ihnen zustehenden Pressefreiheit (Art. 5 I S. 2 GG).
II. Problemaufriss: Wie anhand des Sachverhalts naheliegt, geht es nicht nur um Fragen der Grundrechtsverletzung, sondern bereits um die vorgelagerten Fragen, ob die Grundrechte des Grundgesetzes überhaupt auf Ausländer im Ausland anwendbar sind und ob sich die Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt (und damit auch des BND) aus Art. 1 III GG auch auf nicht-deutsche Territorien erstreckt.
III. Prüfungsgegenstand: Gegenstand des Urteils des BVerfG und der vorliegenden Darstellung sind sowohl die Erhebung und Verarbeitung der Daten von Ausländern im Ausland als auch die Übermittlung der hierdurch gewonnenen Daten an andere Stellen sowie die Kooperation mit anderen ausländischen Nachrichtendiensten (Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung bzw. „Ausland-Ausland-Telekommunikationsüberwachung“). Die Befugnisse des BND zur strategischen Überwachung der Telekommunikation, an der auf mindestens einer Seite Deutsche oder Inländer beteiligt sind (§§ 5 ff. des G-10-Gesetzes), waren nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem BVerfG.
IV. Grundrechtsprüfung: Zu prüfen gilt, ob die behaupteten Grundrechtsverletzungen bestehen. Zunächst wird geprüft, ob die Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab überhaupt zur Verfügung stehen, denn das Verfassungsbeschwerdeverfahren betrifft die Telekommunikationsüberwachung durch den BND gegenüber Journalisten im Ausland. Wäre die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Art. 1 III GG auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt, stünden die Grundrechte des Grundgesetzes nicht als Prüfungsmaßstab zur Verfügung. Bejaht man die Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab, werden sodann die beanstandeten Vorschriften des BNDG am Maßstab des Art. 10 I GG geprüft, um schließlich zu untersuchen, inwieweit sie auch den Anforderungen des Art. 5 I S. 2 GG entsprechen.
1. Grundrechtsbindung des BND bei Auslandsaufklärung/Anwendbarkeit der Grundrechte des Grundgesetzes
Auf den ersten Blick erscheint es zweifelhaft, ob der BND an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden ist, sofern er außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland Daten erhebt. Denn die Anwendbarkeit der Grundrechte als Bestandteil des Grundgesetzes kann ja nicht weiter reichen als die Anwendbarkeit des Grundgesetzes selbst. Von der Nichtgeltung der Grundrechte des Grundgesetzes bei Aufklärungsmaßnahmen im Ausland (ohne Involvierung von Deutschen oder Inländern) ging bislang wohl auch der Gesetzgeber aus, indem er Art. 10 I GG nicht als einschränkbares Grundrecht im BNDG zitiert. Dem ist das BVerfG nunmehr entgegengetreten. Art. 1 III GG begründe eine umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes. Einschränkende Anforderungen, die die Grundrechtsbindung von einem territorialen Bezug zum Bundesgebiet oder der Ausübung spezifischer Hoheitsbefugnisse abhängig machten, ließen sich weder der Vorschrift selbst noch ihrer Entstehungsgeschichte oder systematischen Einbettung entnehmen. Dem grundgesetzlichen Anspruch eines umfassenden, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Grundrechtsschutzes entspreche es vielmehr, dass die Grundrechte als subjektive Rechte immer dann schützten, wenn der deutsche Staat handele und damit potentiell Schutzbedarf auslösen könne – unabhängig davon, an welchem Ort, gegenüber wem und in welcher Form. Das gelte jedenfalls für die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber Überwachungsmaßnahmen, wie sie hier in Frage stünden (Rn. 89 des Urteils).
Ist also der BND auch bei Auslandsaufklärung an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden und stehen damit die Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab zur Verfügung, gilt es nunmehr, die Vereinbarkeit der strategischen Fernmeldeaufklärung mit den Grundrechten des Grundgesetzes zu prüfen.
2. (Un-)Vereinbarkeit mit Art. 10 I GG
Zunächst könnte eine Verletzung des Art. 10 I GG vorliegen.
a. Schutzbereich
Art. 10 I GG schützt u.a. die Vertraulichkeit der Kommunikationsvorgänge und der Inhalte von individueller Telekommunikation. Das Grundrecht dient damit der Wahrung des Persönlichkeitsrechts, das sich durch einen privaten, vor der Öffentlichkeit verborgenen Austausch von Nachrichten, Gedanken und Meinungen kennzeichnet. Art. 10 I GG schützt in seiner Funktion als Abwehrrecht vor Eingriffen des Staates allgemein. Die öffentliche Gewalt soll grundsätzlich nicht die Möglichkeit haben, sich Kenntnis vom Inhalt des über Telekommunikationsanlagen abgewickelten mündlichen oder schriftlichen Informations- und Gedankenaustauschs zu verschaffen. Wird also die Telekommunikation der beschwerdeführenden Journalisten überwacht und werden Telekommunikationsinhalte gespeichert, ist Art. 10 I GG thematisch einschlägig. Der sachliche Schutzbereich ist eröffnet.
Die Beschwerdeführer, überwiegend ausländische Journalisten, die im Ausland über Menschenrechtsverletzungen in Krisengebieten oder autoritär regierten Staaten berichten, sind unabhängig davon, ob sie selbstständig oder für ausländische Insititutionen tätig sind, auch in persönlicher Hinsicht vom Schutzbereich erfasst.
b. Eingriff
Die angegriffenen Vorschriften des BNDG ermächtigen zur Erhebung personenbezogener Daten im Wege der heimlichen Telekommunikationsüberwachung und betreffen damit den Gewährleistungsgehalt des durch Art. 10 I GG geschützten Telekommunikationsgeheimnisses (Rn. 111 des Urteils). Ein Eingriff liegt vor.
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Beschränkungen des Telekommunikationsgeheimnisses dürfen zunächst nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, Art. 10 II S. 1 GG. Das BNDG ist ein Gesetz i.S.d. dieses Gesetzesvorbehalts.
Die angegriffenen Vorschriften des BNDG ermächtigen zur Erhebung personenbezogener Daten im Wege der heimlichen Telekommunikationsüberwachung und betreffen damit den Gewährleistungsgehalt des durch Art. 10 I GG geschützten Telekommunikationsgeheimnisses (Rn. 111 des Urteils). Ein Eingriff liegt vor.
c. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Beschränkungen des Telekommunikationsgeheimnisses dürfen zunächst nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, Art. 10 II S. 1 GG. Das BNDG ist ein Gesetz i.S.d. dieses Gesetzesvorbehalts.
Das einschränkende Gesetz muss zunächst formell verfassungsgemäß
sein. Es muss unter Beachtung von Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sein. Formelle Fehler können sich insbesondere in Bezug auf die Gesetzgebungskompetenz
ergeben, weil Eingriffe in Art. 10 I GG sowohl der Gefahrenabwehr als auch der Strafverfolgung dienen können. Gefahrenabwehr ist – sofern keine Bundeskompetenz besteht (vgl. etwa Art. 73 I Nr. 9a GG) – Ländersache (vgl. Art. 30, 70 I GG), wohingegen Strafverfolgung der Bundesgesetzgebungskompetenz des Art. 74 I Nr. 1 GG (gerichtliches Verfahren) unterfällt. Auch Gesetze, die der Strafverfolgungsvorsorge dienen, sind dem Bereich der Strafverfolgung und damit der Bundesgesetzgebungskompetenz zuzuordnen.
Wie das BVerfG entschieden hat, können die Befugnisse zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung auf die Gesetzgebungskompetenz der „auswärtigen Angelegenheiten“ nach Art. 73 I Nr. 1 GG gestützt werden. Zwar eröffne die Bestimmung nicht die Aufklärung von Straftaten mit Auslandsbezug als solche. Dem BND könne auf dieser Kompetenzgrundlage aber nicht nur die Aufgabe einer politischen Unterrichtung der Bundesregierung, sondern auch die Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internationaler Dimension als eigene, nicht operativ wahrzunehmende Aufgabe übertragen werden. Es müsse sich dabei um Gefahren handeln, die sich ihrer Art und ihrem Gewicht nach auf die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in der Staatengemeinschaft auswirken können und gerade in diesem Sinne von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung seien (Leitsatz 4 sowie Rn. 123-128 des Urteils).
Da das BNDG Art. 10 I GG als einschränkbares Grundrecht zwar in § 3 III BNDG zitiert (in Bezug auf die Eingriffsbefugnisse nach § 3 I und II BNDG), nicht aber in Bezug auf die Befugnisse nach § 6 BNDG, könnte insoweit ein Verstoß gegen das Zitiergebot aus Art. 19 I S. 2 GG vorliegen. Dazu müsste das Zitiergebot zunächst aber überhaupt gelten. Das BVerfG greift die Argumentation der Bundesregierung auf, wonach das Zitiergebot nicht gelte, wenn die betreffenden Vorschriften eine lange bestehende Verwaltungspraxis aufgriffen und nunmehr erstmals gesetzlich regelten, bzw. wenn das Gesetz geltende Grundrechtsbeschränkungen durch das bisherige Recht unverändert oder mit geringen Abweichungen wiederhole (hier erfolgt der Verweis auf BVerfGE 35, 185, 188 f.). Sodann aber erteilt das BVerfG diesem Ansatz eine Absage. Das Zitiergebot sei gerade dann verletzt, wenn der Gesetzgeber ausgehend von einer bestimmten Auslegung des Schutzbereichs – wie hier der Annahme fehlender Grundrechtsbindung deutscher Staatsgewalt bei im Ausland auf Ausländer wirkendem Handeln – die Grundrechte als nicht betroffen erachte. Denn dann fehle es am Bewusstsein des Gesetzgebers, zu Grundrechtseingriffen zu ermächtigen, und an dessen Willen, sich über deren Auswirkungen Rechenschaft abzulegen, was gerade Sinn des Zitiergebots sei (Rn. 135 des Urteils mit Verweis auf BVerfGE 85, 386, 404; 113, 348, 366; 129, 208, 236 f.). Zudem entziehe sich der Gesetzgeber einer öffentlichen Debatte, in der Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen zu klären seien (a.a.O. mit Verweis auf BVerfGE 85, 386, 403 f.; 129, 208, 236 f.).
Zwischenergebnis:
Liegt damit ein Verstoß gegen das Zitiergebot
vor, sind die angegriffenen Regelungen des § 6 BNDG bereits formell verfassungswidrig.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob sie auch materiell verfassungswidrig
sind. Bei der Prüfung der materiellen Verfassungskonformität sind – wie insbesondere aus der Formulierung „unverletzlich“ in Art. 10 I GG folgt – gerade bei heimlichen Maßnahmen wie der Telekommunikationsüberwachung besonders strenge Anforderungen
an die Rechtmäßigkeit zu stellen. So muss – wie bei R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 746 ausgeführt – die gesetzliche Grundlage, die zur Telekommunikationsüberwachung ermächtigt, einen Katalog von Anlasstatbeständen
enthalten, die dem Schutz von überragend wichtigen Rechtsgütern dienen, sowie tatsächliche Anhaltspunkte
für das Vorliegen eines solchen Anlasstatbestands fordern, um dem Bestimmtheitsgrundsatz
und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
bereits auf Tatbestandsseite Konturen zu verleihen. Des Weiteren muss die Tat auch im Einzelfall schwer wiegen
und die entsprechende Ermächtigung muss Vorkehrungen enthalten, um den Kernbereich privater Lebensgestaltung
(auch nachgelagert) zu schützen. Schließlich sind angesichts der Schwere und Heimlichkeit der Maßnahme ein grundsätzlicher Richtervorbehalt
sowie eine nachträgliche Unterrichtung des Betroffenen
erforderlich. Auch ist dem Parlament in periodischen Abständen Bericht zu erstatten (siehe insgesamt dazu BVerfGE 129, 208, 241 ff.).
An der Normenklarheit
und der erforderlichen Bestimmtheit
des § 6 BNDG bestehen keine Bedenken. Das sieht auch das BVerfG so (Rn. 140 des Urteils). Jedoch beantstandet das BVerfG nicht, dass § 6 BNDG keine konkreten Anlasstatbestände
enthält, sondern die Telekommunikationsüberwachung quasi verdachtslos zulässt, obwohl das Gericht in seinen Urteilen zur Telekommunikationsüberwachung nach § 100a StPO (BVerfGE 129, 208, 242 f. – TKÜ-Neuregelung) und zu den Überwachungsmaßnahmen nach dem BKAG (BVerfGE 141, 220, 268 ff.) u.a. qualifizierte Gefahrenlagen und einen konkreten Kriterienkatalog verlangt.
So heißt es im Urteil zur TKÜ-Neuregelung: „Zudem werden die Anlasstaten, bei denen die Telekommunikationsüberwachung als Ermittlungsmaßnahme in Betracht kommt, nicht lediglich mittels abstrakter Kriterien definiert, sondern in einem Katalog einzeln benannt. Ferner bedarf es einer gesicherten Tatsachenbasis („bestimmte Tatsachen“) sowohl für die Annahme eines Tatverdachts als auch für die Erstreckung der Maßnahme auf Dritte als Nachrichtenmittler (vgl. BVerfGE 107, 299 [321 ff.]; 109, 279 [350 f.]; 113, 348 [373, 385 f.] zu § 100c Abs. 1 Nr. 3 StPO). Damit hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen der Überwachungsmaßnahme in grundsätzlich nachvollziehbarer Weise umschrieben (vgl. BVerfGE 110, 33 [54]).“
Und im BKAG-Urteil heißt es: „Dem genügt § 20g Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BKAG nicht. Zwar knüpft die Vorschrift an eine mögliche Begehung terroristischer Straftaten an. Die diesbezüglichen Prognoseanforderungen sind hierbei jedoch nicht hinreichend gehaltvoll ausgestaltet. Die Vorschrift schließt nicht aus, dass sich die Prognose allein auf allgemeine Erfahrungssätze stützt. Sie enthält weder die Anforderung, dass ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und absehbares Geschehen erkennbar sein muss, noch die alternative Anforderung, dass das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründen muss, dass sie in überschaubarer Zukunft terroristische Straftaten begeht. Damit gibt sie den Behörden und Gerichten keine hinreichend bestimmten Kriterien an die Hand
(...)“ (BVerfGE 141, 220, 291).
Im vorliegend zu besprechenden Urteil behandelt das BVerfG das Fehlen von Anlasstatbeständen und eines Kriterienkatalogs im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das ist selbstverständlich vertretbar, irritiert aber, da das Gericht insbesondere im Urteil über die TKÜ-Neuregelung verlangt, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müsse bereits auf Tatbestandsseite Konturen verliehen werden.
Unabhängig von dieser dogmatischen Ungereimtheit liegt der Fokus auf der Prüfung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Die Befugnisnormen müssten einen legitimen Zweck verfolgen, zur Erreichung des Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sein (Rn. 141 des Urteils mit Verweis auf BVerfGE 67, 157, 173; 120, 378, 427; 141, 220, 265 Rn. 93).
Legitimer Zweck:
Der mit einer gesetzlichen Regelung verfolgte Zweck ist legitim, wenn er auf das Wohl der Allgemeinheit gerichtet ist bzw. wenn ein öffentliches Interesse verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen ist (BVerfGE 124, 300, 331). Wie das BVerfG im vorliegenden Fall festgestellt hat, soll nach dem Willen des Gesetzgebers die strategische Überwachung Erkenntnisse über das Ausland verschaffen, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik seien. Sie solle damit dazu beitragen, frühzeitig Gefahren zu erkennen, die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zu wahren und die Bundesregierung in außen- und sicherheitspolitischen Fragen mit Informationen zu versorgen. Hierin liege ein legitimes Ziel.
Geeignetheit:
Die Regelung des § 6 BNDG müsste auch geeignet sein. Geeignet ist die staatliche Maßnahme, wenn mit ihrer Hilfe das angestrebte Ziel erreicht werden kann (Vgl. nur BVerfGE 81, 156, 192; 96, 10, 21; 115, 276, 308; 126, 112, 144; 134, 204, 226; 141, 82, 100; BVerfG NVwZ 2017, 1111, 1123; BVerfG NJW 2018, 2109, 2111; BVerfG NJW 2018, 2542, 2543 f.; BVerfG NJW 2019, 827, 833; BVerfG NStZ-RR 2020, 104). Das BVerfG hat hinsichtlich der in Rede stehenden Regelung des § 6 BNDG entschieden, dass die strategische Telekommunikationsüberwachung geeignet sei, das mit ihr verfolgte legitime Ziel zu erreichen. Denn sie ermögliche es, an außen- und sicherheitspolitische Informationen zu gelangen. Dass hierbei in großem Umfang zunächst Daten miterfasst würden, die keinen relevanten Informationsgehalt hätten, ändere nichts daran, dass die gesamthafte Erfassung und Auswertung von Datenströmen im Ergebnis zu bedeutsamen Erkenntnissen führen könne.
Erforderlichkeit:
Darüber hinaus müsste die angegriffene Regelung erforderlich sein. Das wäre der Fall, wenn kein gleich wirksames, aber für den Grundrechtsträger weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker belastendes Mittel zur Erreichung des Ziels zur Verfügung stünde (BVerfG NJW 2018, 2109, 2112 mit Verweis auf BVerfGE 113, 167, 259; 135, 90, 118. Vgl. auch BVerfGE 30, 292, 316; 63, 88, 115; 77, 84, 109; 90, 145, 172; 100, 313, 375; 116, 202, 225; 145, 20, 80; BVerfG NJW 2019, 827, 830 f.). Nach Auffassung des BVerfG ist das bei § 6 BNDG der Fall: Ohne die breit angelegte anlasslose Erfassung von
Datenströmen und deren Auswertung könnten entsprechende Informationen
nicht gewonnen werden. Ein weniger eingriffsintensives Mittel, das
generell vergleichbare Informationen gewährleistete, sei nicht
ersichtlich. Die strategische Überwachung (genauer müsste es heißen: „Die gesetzliche Befugnis zur strategischen Überwachung“, denn es steht ja die Regelung des § 6 BNDG in Frage, nicht die konkrete Einzelmaßnahme) genüge den Anforderungen der
Erforderlichkeit.
Angemessenheit:
Schließlich müsste die Regelung des § 6 BNDG angemessen, d.h. verhältnismäßig i.e.S. sein. Das wäre der Fall, wenn der mit ihr verfolgte Zweck in seiner Wertigkeit nicht außer Verhältnis zur Intensität des Eingriffs steht (vgl. nur BVerfG NJW 2019, 1432, 1433; BVerfG NJW 2019, 827, 830; BVerfG NJW 2019, 584, 585; BVerfGE 117, 163, 182 f.; 133, 277, 322; BVerwG NJW 2018, 2067, 2070). Dabei gilt der Grundsatz: Je intensiver der Grundrechtseingriff ist, desto gewichtiger müssen die Gründe sein, um den Eingriff zu rechtfertigen. Im vorliegenden Fall stellt das BVerfG fest, dass es sich bei der strategischen Telekommunikationsüberwachung allein schon deshalb um ein Instrument von besonders schwerem Eingriffsgewicht handele, weil mit ihr heimlich in persönliche Kommunikationsbeziehungen eingedrungen werde, die oftmals privaten und unter Umständen auch höchstvertraulichen Charakter hätten. Zudem seien sie anlasslos möglich und die Befugnisnorm sei im Wesentlichen nur final (also nicht konditional) formuliert. Als anlasslose, im Wesentlichen nur final angeleitete und begrenzte Befugnis sei sie jedoch eine Ausnahmebefugnis, die auf die Auslandsaufklärung durch eine Behörde, welche selbst keine operativen Befugnisse habe, begrenzt bleiben müsse und nur durch deren besonderes Aufgabenprofil gerechtfertigt sei (Rn. 166 des Urteils). Das BVerfG stellt in den Leitsätzen 5-8 und ab Rn. 145 des Urteils folgende Anforderungen an die Vereinbarkeit mit Art. 10 I GG:
- Erforderlich seien insbesondere Maßgaben zur Aussonderung der Telekommunikationsdaten von Deutschen und Inländern, eine Begrenzung der zu erhebenden Daten, die Festlegung qualifizierter Überwachungszwecke, die Strukturierung der Überwachung auf der Grundlage eigens festgelegter Maßnahmen, besondere Anforderungen an gezielt personenbezogene Überwachungsmaßnahmen, Grenzen für die bevorratende Speicherung von Verkehrsdaten, Rahmenbestimmungen zur Datenauswertung, Vorkehrungen zum Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen, die Gewährleistung eines Kernbereichsschutzes und Löschungspflichten (Rn. 169 ff. des Urteils).
- Die Übermittlung personenbezogener Daten aus der strategischen Überwachung sei nur zum Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter zulässig und setze eine konkretisierte Gefahrenlage oder einen hinreichend konkretisierten Tatverdacht voraus. Ausgenommen seien hiervon Berichte an die Bundesregierung, soweit diese ausschließlich der politischen Information und Vorbereitung von Regierungsentscheidungen dienten (Rn. 211 des Urteils). Die Übermittlung setze eine förmliche Entscheidung des BND voraus und bedürfe der Protokollierung unter Nennung der einschlägigen Rechtsgrundlage. Gehe es um die Übermittlung an ausländische Stellen, sei vorher eine Vergewisserung über den rechtsstaatlichen Umgang mit den Daten geboten; hierbei bedürfe es einer auf die betroffene Person bezogenen Prüfung, wenn es Anhaltspunkte gebe, dass diese durch die Datenübermittlung spezifisch gefährdet werden könne (Rn. 231 ff. des Urteils).
- Regelungen zur Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten genügten grundrechtlichen Anforderungen nur, wenn sie gewährleisteten, dass die rechtsstaatlichen Grenzen durch den gegenseitigen Austausch nicht überspielt würden und die Verantwortung des BND für die von ihm erhobenen und ausgewerteten Daten im Kern gewahrt bliebe (Rn. 237 ff. des Urteils). Wolle der BND von einem Partnerdienst bestimmte Suchbegriffe nutzen, um die Treffer ohne nähere inhaltliche Auswertung automatisiert an diesen zu übermitteln, erfordere dies eine sorgfältige Kontrolle dieser Suchbegriffe sowie der hieran anknüpfenden Trefferfälle. Die bei Auslandsübermittlungen geltenden Vergewisserungspflichten gölten entsprechend. Die gesamthafte Übermittlung von Verkehrsdaten an Partnerdienste setze einen qualifizierten Aufklärungsbedarf im Hinblick auf eine spezifisch konkretisierte Gefahrenlage voraus. Für den Umgang der Partnerdienste mit den übermittelten Daten seien gehaltvolle Zusagen einzuholen (Rn. 254 ff. des Urteils).
- Die Befugnisse zur strategischen Überwachung, zur Übermittlung der mit ihr gewonnenen Erkenntnisse und zur diesbezüglichen Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten seien (zudem) mit den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit nur vereinbar, wenn sie durch eine unabhängige objektivrechtliche Kontrolle flankiert seien. Sie sei als kontinuierliche Rechtskontrolle auszugestalten, die einen umfassenden Kontrollzugriff ermögliche (Rn. 272 des Urteils). Hierfür sei einerseits eine mit abschließenden Entscheidungsbefugnissen verbundene gerichtsähnliche Kontrolle zu gewährleisten, der die wesentlichen Verfahrensschritte der strategischen Überwachung unterlägen, sowie andererseits eine administrative Kontrolle, die eigeninitiativ stichprobenmäßig den gesamten Prozess der Überwachung auf seine Rechtmäßigkeit prüfen könne (Rn. 274 ff. des Urteils). Zu gewährleisten sei eine Kontrolle in institutioneller Eigenständigkeit. Hierzu gehörten ein eigenes Budget, eine eigene Personalhoheit sowie Verfahrensautonomie. Die Kontrollorgane seien personell wie sächlich so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen könnten. Sie müssten gegenüber dem Bundesnachrichtendienst alle für eine effektive Kontrolle erforderlichen Befugnisse haben. Dabei sei auch dafür Sorge zu tragen, dass die Kontrolle nicht durch die „Third Party Rule“ behindert werde (Rn. 292 des Urteils).
Das bedeutet: Trotz der hohen Eingriffsintensität bzgl. des Telekommunikationsgrundrechts aus Art. 10 I GG wäre eine gesetzliche Regelung unter Beachtung der Vorgaben des BVerfG verfassungskonform. Die angegriffenen Regelungen des BNDG werden diesen Vorgaben jedoch nicht gerecht und sind verfassungswidrig. Jedoch hat das BVerfG die betreffenden Regelungen nicht für nichtig erklärt (Rn. 329 f. des Urteils). Anderenfalls wäre eine strategische Auslandstelekommunikationsüberwachung ab sofort nicht mehr möglich gewesen. Das wiederum wäre mit Blick auf das Sicherheitsbedürfnis der Bundesrepublik Deutschland nicht hinzunehmen. Daher hat das BVerfG die Vorschriften trotz ihrer Verfassungswidrigkeit nicht für nichtig erklärt, sondern ihre Fortgeltung bis zum 31.12.2021 angeordnet. Setzt also der Gesetzgeber die Vorgaben um, ist die strategische Auslandstelekommunikationsüberwachung mit Art. 10 I GG vereinbar.
3. (Un-)Vereinbarkeit mit Art. 5 I S. 2 GG
Auf die Frage nach der (Un-)Vereinbarkeit mit der Pressefreiheit aus Art. 5 I S. 2 GG geht das BVerfG immer nur beiläufig im Zusammenhang mit der Prüfung am Maßstab des Art. 10 I GG ein. Apodiktisch formuliert es, die angegriffenen Regelungen seien in formeller Hinsicht verfassungswidrig, weil sie gegen das Zitiergebot des Art. 19 I S. 2 GG verstießen (siehe Rn. 134 des Urteils) und auch nicht zentralen materiellen Anforderungen des Art. 5 I S. 2 GG (siehe etwa Rn. 86, 137 des Urteils) genügten. Lediglich Rn. 325 widmet es allein Art. 5 I S. 2 GG: „Die Vorschriften sind auch insoweit, als sie zu Überwachungsmaßnahmen gegenüber Journalisten ermächtigen und damit Eingriffe in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG begründen, mit der Verfassung unvereinbar, da sie den spezifischen Schutzbedürfnissen unabhängiger ausländischer Journalisten nicht angemessen Rechnung tragen (...).“ Methodisch korrekt hätte die Prüfung am Maßstab des Art. 5 I S. 2 GG aber eigenständig erfolgen müssen. Denn es handelt sich um zwei voneinander unabhängige Grundrechte, die unterschiedliche Schutzbereiche und Schrankenvorbehalte beinhalten sowie unterschiedliche Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung stellen. Eine verzahnte Prüfung ist – jedenfalls in der juristischen Ausbildung – nicht anerkannt, wenngleich sie der Rechtsprechung des BVerfG nicht fremd ist. Das ist insoweit nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wie umfangreich die Urteile anderenfalls ausfallen würden und wie viele Redundanzen bzw. Verweise sie enthalten müssten.
Rolf Schmidt (24.05.2020)
16.05.2020: Polizei und Tätowierung – Zur Reichweite der beamtenrechtlichen Dienstpflichten
BVerwG, Urteil v. 14.05.2020 – 2 C 13.19
Mit Urteil v. 14.05.2020 hat der 2. Senat des BVerwG entschieden, dass es – bei Bestehen einer entsprechenden landesrechtlichen Gesetzesvorschrift – Polizeivollzugsbeamten untersagt ist, sich im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich, d.h. konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen. Unabhängig von dieser unpräzisen Eingangsformel (es geht nicht um ein Tätowierungsverbot, sondern um das äußere Erscheinungsbild während des Dienstes) soll im Folgenden untersucht werden, ob das Urteil des BVerwG angesichts der Grundrechtsrelevanz überzeugt.
Sachverhalt: Dem Rechtsstreit lag eine ablehnende Entscheidung des Dienstherrn des klagenden Polizeibeamten zugrunde. Der Beamte hatte beim Dienstherrn beantragt, ihm eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm zu genehmigen. Das Tattoo solle an traumhafte Flitterwochen auf Hawaii erinnern. Der Dienstherr lehnte unter Verweis auf Art. 75 II des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBeamtG) den Antrag ab.
Art. 75 II BayBeamtG lautet: Soweit es das Amt erfordert, kann die oberste Dienstbehörde nähere Bestimmungen über ... das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen. Dazu zählen auch Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale.
Problemaufriss: Wie bereits anhand des Wortlautes der Vorschrift unschwer zu erkennen ist, sind bereits die Eingangsformeln der Pressemitteilung des BVerwG: „Polizeivollzugsbeamte in Bayern dürfen sich an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen nicht tätowieren lassen“ und: „Das Bayerische Beamtengesetz untersagt Polizeivollzugsbeamten unmittelbar, sich im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich, d.h. konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen“ unpräzise. Denn das untersagt Art. 75 II BayBeamtG nicht – und schon gar nicht unmittelbar. Dort steht nichts von Tätowierungsverbot, sondern die Vorschrift befugt nur die oberste Dienstbehörde zum Erlass näherer Bestimmungen über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen. Und auch der Dienstherr dürfte kein Tätowierungsverbot verhängen, sondern nur – bei Vorliegen eines Dienstvergehens – disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen (siehe Art. 6 ff. BayDG). Im Folgenden soll das Urteil methodisch eingebettet in einer Grundrechtsprüfung aufbereitet werden.
Ausgangslage: Im vorliegenden Fall steht die Frage im Mittelpunkt, ob die allgemeinen beamtenrechtlichen Dienstpflichten bzw. Grundpflichten (§§ 60 ff. BBG; §§ 33 ff. BeamtStG) so stark wirken, dass sie die grundrechtlich gewährte Freiheit eines Beamten, sich tätowieren zu lassen, rechtswirksam einschränken können. In Betracht kommt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG. Wie bei R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 266 erläutert, haben der BGH und das BVerfG mit Blick auf die Menschenwürde (Art. 1 I GG) schon frühzeitig die Notwendigkeit erkannt, dass dem Einzelnen ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf Achtung und Entfaltung seiner Persönlichkeit zustehen muss, das über das reine Abwehrrecht des Art. 2 I GG hinausgeht (vgl. BGHZ 13, 334, 337 ff. – Leserbrief; 30, 7, 12 ff. – Caterina Valente; BVerfGE 35, 202, 220 ff. – Soldatenmord von Lebach; aus jüngerer Zeit vgl. etwa BVerfG NVwZ 2018, 877, 878 – geschlechtliche Identität; BVerfG 6.11.2019 – 1 BvR 16/13 Rn 80 – „Recht auf Vergessenwerden I“ – insoweit nicht abgedruckt in NVwZ 2020, 53 ff.; BVerfG 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17 Rn 111 – Kopftuchverbot ggü Rechtsreferendarinnen; BVerwG NVwZ 2020, 247 ff. – Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbedienstete). Aus einer Zusammenschau aus Art. 2 I GG und Art. 1 I GG ergibt sich somit das allgemeine Persönlichkeitsrecht (APR), das unter Zugrundelegung der ständigen Rechtsprechung (des BVerfG) verschiedene Aspekte des sachlichen Schutzbereichs umfasst (Übersicht nach R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 267 ff.):
Zu prüfen ist weiterhin, ob ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegt. Dem Rechtsstreit lag – wie aufgezeigt – eine ablehnende Entscheidung des Dienstherrn des klagenden Polizeibeamten zugrunde. Der Beamte hatte beim Dienstherrn beantragt, ihm eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm zu genehmigen, was der Dienstherr abgelehnt hatte. Klage und Berufung des Beamten blieben ohne Erfolg. Gegenstand der Beschwer ist somit die gerichtlich bestätigte Ausgangsentscheidung des Dienstherrn. Diese bildet mithin den Eingriffsakt.
(Staatliche) Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sind trotz der Bezugnahme auf Art. 1 I GG grds. rechtfertigungsfähig. Denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist dogmatisch dem Art. 2 I GG zugeordnet, dessen Schutzniveau lediglich durch Art. 1 I GG verstärkt wird (siehe R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 266). Insoweit zieht die Rspr. auch die Schrankentrias des Art. 2 I GG heran (Vgl. nur BVerfG NJW 2001, 594, 595 – Willy Brandt; BVerfGE 120, 180, 201; 101, 361, 387 – jeweils Caroline von Hannover; 97, 391, 401; BVerfG NJW 2001, 2320, 2321 – DNA-Identitätsfeststellungsgesetz – allesamt zurückgehend auf BVerfGE 65, 1, 43 – Volkszählung).
(Staatliche) Eingriffe bedürfen daher zunächst einer formellen gesetzlichen Grundlage (die selbstverständlich auch die allgemeinen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen wie das Bestimmtheitsgebot, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz etc. beachten muss; insoweit lediglich klarstellend BVerfG NJW 2018, 2385, 2386 – Durchsuchung von Kanzleiräumen – mit Verweis auf BVerfGE 113, 29, 50 ff.). Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist (trotz der Heranziehung der Schrankentrias des Art. 2 I GG) wegen der Hochrangigkeit und Absolutheit des Würdeschutzes ein strengerer Maßstab anzulegen als bei der allgemeinen Verhaltensfreiheit aus Art. 2 I GG (vgl. BVerfG NJW 2014, 2019, 2021: „Eine Regelung, die zu Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ermächtigt, ist jedoch nur dann zulässig, wenn sie zum Schutz eines gewichtigen Gemeinschaftsgutes geeignet und erforderlich ist und der Schutzzweck hinreichend schwer wiegt, so dass er die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts in ihrem Ausmaß rechtfertigt“; siehe auch BVerwG NVwZ 2020, 247 ff. – Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbedienstete).
Eingriffsgrundlage (Rechtsgrundlage) könnte Art. 75 II S. 1 BayBeamtG sein. Nach dieser Vorschrift kann – soweit es das Amt erfordert – die oberste Dienstbehörde nähere Bestimmungen u.a. über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen. Dazu zählen gem. Art. 75 II S. 2 BayBeamtG auch Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale.
Fraglich ist aber zunächst, ob diese Vorschrift dem Bestimmtheitsgrundsatz entspricht. Dieser Grundsatz ist nicht nur Ausdruck des Demokratieprinzips, sondern auch des Rechtsstaatsprinzips. Er besagt, dass eine Rechtsvorschrift klar zum Ausdruck bringen muss, welche Auswirkungen die gesetzliche Regelung für den Bürger hat (vgl. BVerfGE 49, 168, 181; 59, 104, 114; 62, 169, 182 f.; 80, 103, 107 f.; 114, 1, 53; BVerfG NVwZ 2011, 94, 99 f.; BVerfG NJW 2018, 2619, 2622 – Fixierung von untergebrachten Personen). Ist das Gesetz zu unbestimmt, ist es schon deshalb verfassungswidrig (siehe R. Schmidt, Staatsorganisationsrecht, 21. Aufl. 2020, Rn. 191). Zweifel an der Bestimmtheit bestehen also insbesondere dann, wenn das Gesetz unbestimmte Rechtsbegriffe enthält.
Nach Auffassung des BVerwG (das insoweit Bezug nimmt auf den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof) stellt Art. 75 II S. 1 BayBeamtG eine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage dar, die die oberste Dienstbehörde ermächtigt, bei Polizeivollzugsbeamten das Tragen von Tätowierungen zu reglementieren. Im Gesetz sei für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale (wie etwa ein Branding oder ein Ohrtunnel) im beim Tragen der Uniform sichtbaren Körperbereich geregelt. Dies ergebe sich aus der Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung. Danach seien äußerlich erkennbare Tätowierungen und vergleichbare auf Dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren Bereich mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten unvereinbar.
Stellungnahme: Zwar wurde vom Verfasser aufgezeigt, dass vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen stets kritisch zu betrachten ist. Andererseits ist die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen in einem System abstrakt-genereller Rechtsetzung aber unerlässlich. Der Gesetzgeber kann nicht alle erdenklichen Lebenssachverhalte antizipiert in den Normen aufnehmen. Dafür bietet das Leben zu viele Besonderheiten und Verschiedenartigkeiten. Daher muss der Wortlaut einer Norm – freilich unter Beachtung des Bestimmtheitsgrundsatzes – ein bestimmtes Maß an Abstraktheit aufweisen. Hinzu kommt, dass es der Verwaltung möglich sein muss, auch atypischen, unvorhersehbaren Situationen zu begegnen. Auch nach der Rechtsprechung des BVerfG bestehen gegen die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe keine Bedenken, „wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden (vgl. dazu nebst Beispielen R. Schmidt, Allgemeines Verwaltungsrecht, 22. Aufl. 2020, Rn. 269 ff.), insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt“ (BVerfG NJW 2018, 2619, 2622 – Fixierung von untergebrachten Personen – mit Verweis auf BVerfGE 45, 363, 371 f.; 86, 288, 311 (st. Rspr.). Vorliegend lässt sich mit dem BVerwG gut vertreten, Art. 75 II BayBeamtG sei hinreichend bestimmt formuliert. Denn in S. 2 der Bestimmung ist von „sonstige(n) sichtbare(n) und nicht sofort ablegbare(n) Erscheinungsmerkmale(n)“ die Rede. Tätowierungen sind nicht „sofort ablegbar“ und – sofern sie am Gesicht, am Hals oder an (Unter-)Armen angebracht sind – i.d.R. auch „sichtbar“. Gerade bei Tragen einer Sommeruniform sind Tätowierungen am Hals und an den (Unter-)Armen i.d.R. gut sichtbar.
Möglicherweise ist aber jedenfalls zu beanstanden, dass das BVerwG – jedenfalls in seiner Pressemitteilung zum noch nicht veröffentlichten Urteil – methodisch nicht (hinreichend) zwischen dem Bestimmtheitsgrundsatz und der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG differenziert. Denn aus dem Demokratieprinzip (aber auch aus dem Rechtsstaatsprinzip) folgt weiterhin die Verpflichtung des parlamentarischen Gesetzgebers, in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und nicht dem Handeln und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen. Geht es um Grundrechtseingriffe, hat er die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen selbst zu treffen. Lediglich die Befugnis zur Regelung von Einzelheiten und Konkretisierungen darf der Exekutive überlassen werden. Soll die Einschränkung einer Rechtsverordnung, Satzung oder einem Verwaltungsakt überlassen bleiben, muss das ermächtigende förmliche Gesetz aber alle für die Grundrechtsausübung wesentlichen Fragen selbst regeln. Speziell zur Berufsfreiheit gilt dabei: Je schwerwiegender der Eingriff in die Berufsfreiheit ausfällt, desto detaillierter muss die formell-gesetzliche Regelung sein. Lediglich Randfragen der Berufszulassung und generell Fragen der Berufsausübung können der Exekutive überlassen werden (siehe R. Schmidt, Grundrechte, 25. Auflage, 2020, Rn. 798). Und in einer anderen Entscheidung heißt es: „Dabei muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich sind (...). Je stärker in grundrechtlich geschützte Bereiche eingegriffen wird, desto deutlicher muss das gesetzgeberische Wollen zum Ausdruck kommen (...)“ (BVerfG NJW 2019, 584, 585 mit Verweis auf BVerfGE 73, 280, 295; 80, 1, 20; 87, 287, 317; 98, 49, 60).
Vor diesem Hintergrund ist zweifelhaft, ob Art. 75 II S. 1 BayBeamtG der Wesentlichkeitsrechtsprechung gerecht wird. Denn in dieser Vorschrift wird lediglich die oberste Dienstbehörde ermächtigt, nähere Bestimmungen u.a. über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen, wozu auch Bestimmungen über Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale zählen. Das Gesetz selbst enthält keine konkreten Angaben über die Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild. Das legt die Annahme eines Verstoßes gegen die Wesentlichkeitsrechtsprechung nahe.
So stellt etwa eine Verordnung eines Landesjustizministeriums, die es dem Justizprüfungsamt erlaubt, auf der Basis einer Auflage einer Rechtsreferendarin muslimischen Glaubens zu verbieten, im Gerichtssaal (auf der Richterbank sitzend bzw. als Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft agierend) oder bei Vernehmungen ein Kopftuch zu tragen, keine hinreichende Rechtsgrundlage dar (richtig VG Augsburg 30.6.2016 – Au 2 K 15.457 – mit Bespr. v. Muckel, JA 2017, 78; siehe auch BVerfG NJW 2017, 2333, 2334 – Kopftuchverbot ggü einer Referendarin im Gerichtssaal; VGH München BayVBl 2018, 672). Denn eine solche Angelegenheit ist von einer derart hohen Grundrechtsrelevanz, dass sie nur durch den förmlichen Gesetzgeber geregelt werden könnte. Existiert also keine Verbotsregelung im Justizausbildungsgesetz (JAG) bzw. keine Verweisung von dort auf die beamtengesetzliche Regelung über die Neutralitätspflicht (in der jeweils geltenden Fassung, sog. dynamische Verweisung), liegt ein Verstoß gegen die Wesentlichkeitsrechtsprechung vor (siehe BVerfG 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17 Rn. 84 –Kopftuchverbot ggü Rechtsreferendarinnen).
Auch ist die Festlegung von Altershöchstgrenzen für die Einstellung in den öffentlichen Dienst derart wesentlich für die betroffenen Bewerber, dass sie nur durch formelles Gesetz erfolgen kann. Werden Altersgrenzen lediglich in Laufbahnverordnungen (Rechtsverordnungen) festgelegt, ist dies bereits wegen Verstoßes gegen Art. 80 I S. 2 GG bzw. die Wesentlichkeitsrechtsprechung rechtswidrig, wenn es an einer hinreichend bestimmten Ermächtigungsgrundlage fehlt.
Auch bestimmte körperliche Anforderungen, die an einen Beruf gestellt werden (etwa Mindestgröße für den Polizeidienst), müssen vom Gesetzgeber selbst geregelt werden und dürfen weder der Regelung durch Laufbahnverordnung (Rechtsverordnung) noch durch Ministeriumserlass (Verwaltungsvorschrift) überlassen werden (siehe dazu VG Düsseldorf 8.8.2017 – 2 K 7427/17 – mit Verweis auf BVerfGE 139, 19; siehe auch OVG Münster NWVBl 2018, 27 ff.).
Ebenso ist entschieden worden, dass die Ablehnung eines Polizeibewerbers wegen einer (sichtbaren) Tätowierung schon allein dann rechtswidrig ist, wenn sich die Kriterien für die Ablehnungsentscheidung nicht auf eine formell-gesetzliche Rechtsgrundlage stützen lassen; keinesfalls genügt eine Verwaltungspraxis (OVG Berlin-Brandenburg 28.8.2018 – 4 S 36.18).
Überträgt man die in den genannten Fällen gewonnenen Erkenntnisse, könnte das in der Tat zu der Annahme führen, Art. 75 II S. 1 BayBeamtG werde der Wesentlichkeitsrechtsprechung nicht gerecht. Jedoch relativiert das BVerfG die aufgezeigten vermeintlich hohen Anforderungen wiederum, indem es formuliert, dass sich die Eingriffsvoraussetzungen nicht ohne weiteres aus dem Wortlaut des Gesetzes ergeben müssten; es genüge, dass sie sich mit Hilfe allgemeiner Auslegungsgrundsätze erschließen lassen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusammenhang und der Vorgeschichte der Regelung (BVerfG NJW 2019, 584, 585 mit Verweis auf BVerfGE 19, 17, 30; 58, 257, 277; 62, 203, 210; 80, 1, 20 f.; 82, 209, 224).
Wohl vor diesem Hintergrund hat das BVerwG im vorliegenden Fall entschieden, dass bereits im Bayerischen Beamtengesetz selbst für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale (wie etwa ein Branding oder ein Ohrtunnel) im beim Tragen der Uniform sichtbaren Körperbereich geregelt sei. Dies ergebe sich aus der Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung.
Auch wenn man damit von der Vereinbarkeit des Art. 75 II BayBeamtG mit der Wesentlichkeitsrechtsprechung ausgeht, bleibt noch die Frage zu klären, ob die Regelung des Art. 75 II BayBeamtG und die darauf ergangene behördliche Versagungsverfügung auch verhältnismäßig sind.
Da die gesetzliche Regelung der obersten Dienstbehörde lediglich die Befugnis einräumt, nähere Bestimmungen über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen zu treffen, nicht aber zwingende Maßnahmen vorschreibt, ist sie als Ermessensnorm insoweit nicht zu beanstanden (Anm.: In einer Fallbearbeitung müssten die Komponenten des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes geprüft werden; bei der Angemessenheit wäre dann das Schutzgut der beamtenrechtlichen Neutralitätspflicht mit dem APR – abstrakt – abzuwägen).
Bei der Einzelfallprüfung erweist sich die Verhältnismäßigkeit als problematisch. Kann man von der Geeignetheit und Erforderlichkeit noch ausgehen, ist aber die Angemessenheit der Versagungsverfügung zweifelhaft. Denn angemessen ist eine staatliche Maßnahme nur dann, wenn das mit ihr verfolgte Ziel in seiner Wertigkeit nicht außer Verhältnis zur Intensität des Eingriffs steht (vgl. nur BVerfG NJW 2019, 1432, 1433; BVerfG NJW 2019, 827, 830; BVerfG NJW 2019, 584, 585; BVerfGE 117, 163, 182 f.; 133, 277, 322; BVerwG NJW 2018, 2067, 2070). Je schwerwiegender die Grundrechtsbeeinträchtigung ist, desto gewichtiger müssen die Gründe für die Einschränkung sein. An dieser Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne könnte es vorliegend fehlen. Das mit der Versagung der Genehmigung des Stechens einer beim Tragen der Dienstkleidung sichtbaren Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm verfolgte Ziel ist die Gewährleistung der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten. Die Rechtsgemeinschaft soll sich darauf verlassen dürfen, dass Polizeibeamte als Repräsentanten des demokratischen Rechtsstaates stets neutral und unvoreingenommen ihren Dienst verrichten und entsprechend auftreten. In Ansehung von Funktion und Bedeutung ihres Amtes haben sie staatliche Neutralität und Gesetzestreue zu verkörpern (siehe etwa § 60 BBG, § 33 BeamtStG). Zu Recht weist die Rechtsprechung darauf hin, dass das Berufsbeamtentum eine stabile gesetzestreue Verwaltung sichern, die freiheitlich demokratische Rechtsordnung verteidigen und durch Unabhängigkeit und Unparteilichkeit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften darstellen soll. Das Vertrauen, dass der Beamte diesem Auftrag gerecht werde, und dessen er zur Erfüllung seiner Aufgabe bedürfe, dürfe der Beamte auch durch sein außerdienstliches Verhalten nicht beeinträchtigen (VG Magdeburg, Urt. v. 28.1.2020 – 15 A 4/19 Rn. 26 mit Verweis auf BVerwG, Urt. v. 30.08.2000 – 1 D 37.99).
Allerdings hat sich in jüngerer Zeit ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen. So werden nach der Rechtsprechung (siehe etwa VG Magdeburg, Urt. v. 28.1.2020 – 15 A 4/19) Beamte nicht mehr als Vorbild in allen Lebenslagen angesehen, die besonderen Anforderungen an Moral und Anstand unterliegen. Die Vorstellung, dass der Beamte „niemals Privatmann“ sei, sondern auch außerhalb des Dienstes Beamter, der stets auf seine Amtsstellung Rücksicht zu nehmen habe, habe der Gesetzgeber zum Schutz der Privatsphäre des Beamten bewusst aufgegeben (siehe § 47 I S. 2 BeamtStG, wo der in der Vorgängervorschrift des BRRG vorhandene Ansehensverlust nicht übernommen wurde). Der Gesetzgeber habe durch die gesetzliche Regelung zum Ausdruck bringen wollen, dass von einem Beamten außerdienstlich kein wesentlich anderes Sozialverhalten als von jedem Bürger erwartet werde. Das trifft auf im Privatleben angebrachte Tätowierungen zu. Tätowierungen weisen jedoch die Besonderheit auf, dass sie sich während der Dienstausübung allenfalls verdecken, nicht aber ablegen lassen, wodurch ein innerdienstlicher Bezug hergestellt ist. Daher lassen sich die Pflichten insbesondere eines Polizeibeamten, in Ansehung von Funktion und Bedeutung ihres Amtes staatliche Neutralität und Gesetzestreue zu verkörpern, nicht relativieren.
Freilich bleibt die Frage zu beantworten, ob eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm das Ansehen des Beamten im Hinblick auf Neutralität und Gesetzestreue tatsächlich zu erschüttern vermag. Das BVerwG ist dieser Auffassung. Äußerlich erkennbare Tätowierungen und vergleichbare auf Dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren Bereich seien mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten unvereinbar. Durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützte individuelle Interessen der Polizeivollzugsbeamten an einer Tätowierung müssten für den – bezogen auf den Gesamtkörper beim Tragen der Dienstkleidung kleinen – sichtbaren Bereich gegenüber der Notwendigkeit eines einheitlichen und neutralen Erscheinungsbildes zurücktreten.
Stellungnahme: Eine solche Annahme ist – entgegen der Auffassung des BVerwG – nicht zwingend. Denn wie aufgezeigt, sind auch an innerdienstliche Verhaltensweisen mit Persönlichkeitsbezug nicht mehr dieselben hohen Maßstäbe anzulegen, wie das früher der Fall war. Geht also von einer Tätowierung keine die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdende Wirkung aus (wie das insbesondere bei den Nationalsozialismus verherrlichenden Motiven der Fall wäre) und bringt sie keine beleidigenden, gewaltverherrlichenden, Angst einflößenden oder obszönen Botschaften zum Ausdruck und sollte auch nicht die Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten in Frage gestellt sein, sollte dem APR der Vorrang verliehen werden.
So hat auch das OVG Münster im Rahmen eines Eilverfahrens entschieden, dass das Land NRW einen Polizeianwärter nicht wegen einer großflächigen Löwen-Tätowierung auf der Brust ablehnen darf (OVG Münster, Beschl. v. 12.05.2020 – 6 B 212/20). Die den Antrag auf Einstellung in den Polizeidienst ablehnende Dienstbehörde begründete ihre Entscheidung damit, es bestünden wegen des Tattoos Zweifel an der charakterlichen Eignung. Der Zähne fletschende Löwenkopf wirke angriffslustig und aggressiv auf den Betrachter und er vermittle einen gewaltverherrlichenden Eindruck. Der Polizeianwärter bringe damit zum Ausdruck, dass er sich nicht an die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gebunden fühle.
Nun wurde auch vom Verfasser dieses Beitrags aufgezeigt, dass gewaltverherrlichende Motive durchaus die Gewährleistung der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten in Frage stellen. Die Rechtsgemeinschaft soll sich darauf verlassen dürfen, dass Polizeibeamte als Repräsentanten des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates stets neutral und unvoreingenommen ihren Dienst verrichten und entsprechend auftreten (s.o.). Jedoch darf bezweifelt werden, ob das Motiv eines Zähne fletschenden Löwenkopfs angriffslustig und aggressiv auf den Betrachter wirkt und einen gewaltverherrlichenden Eindruck vermittelt, der Zweifel an der Bindung an die freiheitliche demokratische Grundordnung aufkommen lässt. Denn auch die Rechtsprechung geht (in Bezug auf die Meinungsäußerungsfreiheit) im Allgemeinen davon aus, dass bei Aussagen mehrdeutigen Inhalts diejenige zugrunde zu legen sei, die von dem Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sei. Verkenne das Gericht diese Deutungsmöglichkeit und damit die Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit, verletze es mit seinem die Meinungsäußerungsfreiheit beschränkenden Urteil das Grundrecht aus Art. 5 I S. 1 Var. 1 GG (BVerfG NJW 2009, 908, 909). Generell hat das BVerfG in zahlreichen Entscheidungen in Zweifelsfällen eine weite, nämlich diejenige Auslegung gewählt, „welche die juristische Wirkungskraft der Grundrechtsnorm am stärksten entfaltet“ (Vgl. nur BVerfGE 7, 377, 397; 32, 54, 72; 39, 1, 38; 78, 179, 193).
Zu Recht hat daher auch das OVG Münster entschieden, dass der fein konturierten, realitätsgetreuen Abbildung eines männlichen Löwenkopfes in brüllender Manier kein in ihrem Deutungsgehalt eindeutiger, die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage stellender Inhalt zukomme. Angesichts der Intensität des mit der Ablehnung verbundenen Eingriffs in die Berufsfreiheit bedürfe es weiterer Anhaltspunkte, um aus dem vom Antragsteller gewählten Motiv auf eine Eignungszweifel begründende, hier insbesondere gewaltverherrlichende Einstellung seiner Person schließen zu können. An solchen Anhaltspunkten fehle es hier jedoch. Der Antragsteller habe eine gewaltverherrlichende Einstellung dementiert und auf im Zusammenhang mit seiner Trainertätigkeit erworbene soziale Kompetenzen hingewiesen. Für ihn stehe der Löwe für Stärke, Mut und Macht (OVG Münster, Beschl. v. 12.05.2020 – 6 B 212/20).
Ergebnis: Übertragen auf den vorliegend zu besprechenden Fall bedeutet das: Es ist bereits zweifelhaft, ob die Vorschrift des Art. 75 II BayBeamtG mit der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG vereinbar ist. Jedenfalls aber ist die ablehnende Entscheidung der obersten Dienstbehörde unverhältnismäßig, weil sie die Bedeutung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verkennt. Denn geht von einer Tätowierung keine die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdende Wirkung aus (wie das insbesondere bei den Nationalsozialismus verherrlichenden Motiven der Fall wäre) und bringt sie keine beleidigenden, gewaltverherrlichenden, Angst einflößenden oder obszönen Botschaften zum Ausdruck, ist dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Vorrang zu gewähren, außer, aus dem Gesamterscheinungsbild ergibt sich die Gefahr, dass die Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten nicht gewährleistet ist. Die ablehnende Entscheidung der obersten Dienstbehörde sowie die sie bestätigenden Gerichtsurteile sind – da sie dieser Frage offenbar nicht nachgegangen sind – rechtswidrig und verletzen den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
BVerwG, Urteil v. 14.05.2020 – 2 C 13.19
Mit Urteil v. 14.05.2020 hat der 2. Senat des BVerwG entschieden, dass es – bei Bestehen einer entsprechenden landesrechtlichen Gesetzesvorschrift – Polizeivollzugsbeamten untersagt ist, sich im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich, d.h. konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen. Unabhängig von dieser unpräzisen Eingangsformel (es geht nicht um ein Tätowierungsverbot, sondern um das äußere Erscheinungsbild während des Dienstes) soll im Folgenden untersucht werden, ob das Urteil des BVerwG angesichts der Grundrechtsrelevanz überzeugt.
Sachverhalt: Dem Rechtsstreit lag eine ablehnende Entscheidung des Dienstherrn des klagenden Polizeibeamten zugrunde. Der Beamte hatte beim Dienstherrn beantragt, ihm eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm zu genehmigen. Das Tattoo solle an traumhafte Flitterwochen auf Hawaii erinnern. Der Dienstherr lehnte unter Verweis auf Art. 75 II des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBeamtG) den Antrag ab.
Art. 75 II BayBeamtG lautet: Soweit es das Amt erfordert, kann die oberste Dienstbehörde nähere Bestimmungen über ... das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen. Dazu zählen auch Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale.
Problemaufriss: Wie bereits anhand des Wortlautes der Vorschrift unschwer zu erkennen ist, sind bereits die Eingangsformeln der Pressemitteilung des BVerwG: „Polizeivollzugsbeamte in Bayern dürfen sich an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen nicht tätowieren lassen“ und: „Das Bayerische Beamtengesetz untersagt Polizeivollzugsbeamten unmittelbar, sich im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich, d.h. konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen“ unpräzise. Denn das untersagt Art. 75 II BayBeamtG nicht – und schon gar nicht unmittelbar. Dort steht nichts von Tätowierungsverbot, sondern die Vorschrift befugt nur die oberste Dienstbehörde zum Erlass näherer Bestimmungen über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen. Und auch der Dienstherr dürfte kein Tätowierungsverbot verhängen, sondern nur – bei Vorliegen eines Dienstvergehens – disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen (siehe Art. 6 ff. BayDG). Im Folgenden soll das Urteil methodisch eingebettet in einer Grundrechtsprüfung aufbereitet werden.
Ausgangslage: Im vorliegenden Fall steht die Frage im Mittelpunkt, ob die allgemeinen beamtenrechtlichen Dienstpflichten bzw. Grundpflichten (§§ 60 ff. BBG; §§ 33 ff. BeamtStG) so stark wirken, dass sie die grundrechtlich gewährte Freiheit eines Beamten, sich tätowieren zu lassen, rechtswirksam einschränken können. In Betracht kommt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG. Wie bei R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 266 erläutert, haben der BGH und das BVerfG mit Blick auf die Menschenwürde (Art. 1 I GG) schon frühzeitig die Notwendigkeit erkannt, dass dem Einzelnen ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf Achtung und Entfaltung seiner Persönlichkeit zustehen muss, das über das reine Abwehrrecht des Art. 2 I GG hinausgeht (vgl. BGHZ 13, 334, 337 ff. – Leserbrief; 30, 7, 12 ff. – Caterina Valente; BVerfGE 35, 202, 220 ff. – Soldatenmord von Lebach; aus jüngerer Zeit vgl. etwa BVerfG NVwZ 2018, 877, 878 – geschlechtliche Identität; BVerfG 6.11.2019 – 1 BvR 16/13 Rn 80 – „Recht auf Vergessenwerden I“ – insoweit nicht abgedruckt in NVwZ 2020, 53 ff.; BVerfG 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17 Rn 111 – Kopftuchverbot ggü Rechtsreferendarinnen; BVerwG NVwZ 2020, 247 ff. – Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbedienstete). Aus einer Zusammenschau aus Art. 2 I GG und Art. 1 I GG ergibt sich somit das allgemeine Persönlichkeitsrecht (APR), das unter Zugrundelegung der ständigen Rechtsprechung (des BVerfG) verschiedene Aspekte des sachlichen Schutzbereichs umfasst (Übersicht nach R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 267 ff.):
- Die Intimsphäre, insbesondere das Schamgefühl (vgl. BVerfG NJW 2015, 3158, 3159 – Körperliche Durchsuchung bei nacktem Körper) und das Sexualleben (BVerfG NJW 2015, 1506 ff. – kein Auskunftsanspruch Scheinvater gegen Mutter aus § 242 BGB auf Nennung des Namens des biologischen Vaters; BGH NJW 2016, 1094, 1095 f. – Löschungsanspruch in Bezug auf Intimfotos).
- Die enge persönliche Lebenssphäre; das APR verleiht dem Einzelnen die Befugnis, sich (räumlich) zurückzuziehen, abzuschirmen, für sich und allein zu bleiben (vgl. nur BVerfGE 120, 180, 199; 101, 361, 382 ff. – jeweils Caroline von Hannover; BGH MDR 2017, 879 f).
- Das Recht auf Selbstbestimmung. Damit ist zunächst das Recht gemeint, die eigene Abstammung zu kennen, die dem Betroffenen grds. nicht vorenthalten werden darf, da anderenfalls das Persönlichkeitsrecht verletzt sein kann (BVerfGE 90, 263, 270 f. – Anfechtung der Ehelichkeit; 96, 56, 63 – Recht auf Kenntnis des Vaters; BVerfG NJW 2016, 1939, 1940 – isolierte Klärung der Abstammung). Geschützt ist v.a. die sexuelle Selbstbestimmung, insbesondere in Bezug auf das Sexualleben, die Wahl der geschlechtlichen Identität, d.h. das Recht, einem bestimmten Geschlecht anzugehören, die Intersexualität und das Recht, weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht anzugehören (siehe dazu BVerfGE 47, 46, 73 – Sexualkundeunterricht; 49, 286, 287 ff. – Transsexueller; BVerfG NJW 2011, 909 – Transsexueller; NVwZ 2018, 877, 878 – geschlechtliche Identität; BVerwG NJW 2016, 2761 f. – Störung der Geschlechtsidentität; BGH NJW 2016, 1094, 1095 – geschlechtliche Intimität; siehe auch EuGH NVwZ 2018, 643 ff. – Homosexualitätstests für Asylbewerber mit Art. 7 GRC unvereinbar).
- Das Recht auf Selbstbestimmung schließt das Recht ein, auf therapeutische Maßnahmen zu verzichten sowie lebensverlängernde Maßnahmen abzulehnen (BVerfG NJW 2017, 53, 55 ff.; BVerwG NJW 2017, 2215, 2217).
- Nach der vom Verfasser bereits in der 21. Auflage (März 2017) seines Grundrechtsbuchs vertretenen Auffassung ist durch Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG generell die Entscheidung über den selbstbestimmten Tod und damit auch über den Suizid geschützt, jedenfalls sofern die freie Willensbestimmung nicht ausgeschlossen ist (so die 21. Aufl. Rn. 290; später auch BVerwG NJW 2017, 2215, 2217 sowie BGH NJW-RR 2017, 964, 965). Die staatliche Schutzpflicht muss hinter das Recht des Einzelnen auf einen frei verantworteten Suizid zurücktreten (21. Aufl. a.a.O.).
- Und nicht zuletzt schützt das APR auch die Freiheit, den eigenen Körper nach Belieben mit Tätowierungen zu versehen.
Zu prüfen ist weiterhin, ob ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegt. Dem Rechtsstreit lag – wie aufgezeigt – eine ablehnende Entscheidung des Dienstherrn des klagenden Polizeibeamten zugrunde. Der Beamte hatte beim Dienstherrn beantragt, ihm eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm zu genehmigen, was der Dienstherr abgelehnt hatte. Klage und Berufung des Beamten blieben ohne Erfolg. Gegenstand der Beschwer ist somit die gerichtlich bestätigte Ausgangsentscheidung des Dienstherrn. Diese bildet mithin den Eingriffsakt.
(Staatliche) Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sind trotz der Bezugnahme auf Art. 1 I GG grds. rechtfertigungsfähig. Denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist dogmatisch dem Art. 2 I GG zugeordnet, dessen Schutzniveau lediglich durch Art. 1 I GG verstärkt wird (siehe R. Schmidt, Grundrechte, 25. Aufl. 2020, Rn. 266). Insoweit zieht die Rspr. auch die Schrankentrias des Art. 2 I GG heran (Vgl. nur BVerfG NJW 2001, 594, 595 – Willy Brandt; BVerfGE 120, 180, 201; 101, 361, 387 – jeweils Caroline von Hannover; 97, 391, 401; BVerfG NJW 2001, 2320, 2321 – DNA-Identitätsfeststellungsgesetz – allesamt zurückgehend auf BVerfGE 65, 1, 43 – Volkszählung).
(Staatliche) Eingriffe bedürfen daher zunächst einer formellen gesetzlichen Grundlage (die selbstverständlich auch die allgemeinen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen wie das Bestimmtheitsgebot, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz etc. beachten muss; insoweit lediglich klarstellend BVerfG NJW 2018, 2385, 2386 – Durchsuchung von Kanzleiräumen – mit Verweis auf BVerfGE 113, 29, 50 ff.). Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist (trotz der Heranziehung der Schrankentrias des Art. 2 I GG) wegen der Hochrangigkeit und Absolutheit des Würdeschutzes ein strengerer Maßstab anzulegen als bei der allgemeinen Verhaltensfreiheit aus Art. 2 I GG (vgl. BVerfG NJW 2014, 2019, 2021: „Eine Regelung, die zu Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ermächtigt, ist jedoch nur dann zulässig, wenn sie zum Schutz eines gewichtigen Gemeinschaftsgutes geeignet und erforderlich ist und der Schutzzweck hinreichend schwer wiegt, so dass er die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts in ihrem Ausmaß rechtfertigt“; siehe auch BVerwG NVwZ 2020, 247 ff. – Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbedienstete).
Eingriffsgrundlage (Rechtsgrundlage) könnte Art. 75 II S. 1 BayBeamtG sein. Nach dieser Vorschrift kann – soweit es das Amt erfordert – die oberste Dienstbehörde nähere Bestimmungen u.a. über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen. Dazu zählen gem. Art. 75 II S. 2 BayBeamtG auch Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale.
Fraglich ist aber zunächst, ob diese Vorschrift dem Bestimmtheitsgrundsatz entspricht. Dieser Grundsatz ist nicht nur Ausdruck des Demokratieprinzips, sondern auch des Rechtsstaatsprinzips. Er besagt, dass eine Rechtsvorschrift klar zum Ausdruck bringen muss, welche Auswirkungen die gesetzliche Regelung für den Bürger hat (vgl. BVerfGE 49, 168, 181; 59, 104, 114; 62, 169, 182 f.; 80, 103, 107 f.; 114, 1, 53; BVerfG NVwZ 2011, 94, 99 f.; BVerfG NJW 2018, 2619, 2622 – Fixierung von untergebrachten Personen). Ist das Gesetz zu unbestimmt, ist es schon deshalb verfassungswidrig (siehe R. Schmidt, Staatsorganisationsrecht, 21. Aufl. 2020, Rn. 191). Zweifel an der Bestimmtheit bestehen also insbesondere dann, wenn das Gesetz unbestimmte Rechtsbegriffe enthält.
Nach Auffassung des BVerwG (das insoweit Bezug nimmt auf den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof) stellt Art. 75 II S. 1 BayBeamtG eine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage dar, die die oberste Dienstbehörde ermächtigt, bei Polizeivollzugsbeamten das Tragen von Tätowierungen zu reglementieren. Im Gesetz sei für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale (wie etwa ein Branding oder ein Ohrtunnel) im beim Tragen der Uniform sichtbaren Körperbereich geregelt. Dies ergebe sich aus der Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung. Danach seien äußerlich erkennbare Tätowierungen und vergleichbare auf Dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren Bereich mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten unvereinbar.
Stellungnahme: Zwar wurde vom Verfasser aufgezeigt, dass vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen stets kritisch zu betrachten ist. Andererseits ist die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen in einem System abstrakt-genereller Rechtsetzung aber unerlässlich. Der Gesetzgeber kann nicht alle erdenklichen Lebenssachverhalte antizipiert in den Normen aufnehmen. Dafür bietet das Leben zu viele Besonderheiten und Verschiedenartigkeiten. Daher muss der Wortlaut einer Norm – freilich unter Beachtung des Bestimmtheitsgrundsatzes – ein bestimmtes Maß an Abstraktheit aufweisen. Hinzu kommt, dass es der Verwaltung möglich sein muss, auch atypischen, unvorhersehbaren Situationen zu begegnen. Auch nach der Rechtsprechung des BVerfG bestehen gegen die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe keine Bedenken, „wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden (vgl. dazu nebst Beispielen R. Schmidt, Allgemeines Verwaltungsrecht, 22. Aufl. 2020, Rn. 269 ff.), insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt“ (BVerfG NJW 2018, 2619, 2622 – Fixierung von untergebrachten Personen – mit Verweis auf BVerfGE 45, 363, 371 f.; 86, 288, 311 (st. Rspr.). Vorliegend lässt sich mit dem BVerwG gut vertreten, Art. 75 II BayBeamtG sei hinreichend bestimmt formuliert. Denn in S. 2 der Bestimmung ist von „sonstige(n) sichtbare(n) und nicht sofort ablegbare(n) Erscheinungsmerkmale(n)“ die Rede. Tätowierungen sind nicht „sofort ablegbar“ und – sofern sie am Gesicht, am Hals oder an (Unter-)Armen angebracht sind – i.d.R. auch „sichtbar“. Gerade bei Tragen einer Sommeruniform sind Tätowierungen am Hals und an den (Unter-)Armen i.d.R. gut sichtbar.
Möglicherweise ist aber jedenfalls zu beanstanden, dass das BVerwG – jedenfalls in seiner Pressemitteilung zum noch nicht veröffentlichten Urteil – methodisch nicht (hinreichend) zwischen dem Bestimmtheitsgrundsatz und der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG differenziert. Denn aus dem Demokratieprinzip (aber auch aus dem Rechtsstaatsprinzip) folgt weiterhin die Verpflichtung des parlamentarischen Gesetzgebers, in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und nicht dem Handeln und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen. Geht es um Grundrechtseingriffe, hat er die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen selbst zu treffen. Lediglich die Befugnis zur Regelung von Einzelheiten und Konkretisierungen darf der Exekutive überlassen werden. Soll die Einschränkung einer Rechtsverordnung, Satzung oder einem Verwaltungsakt überlassen bleiben, muss das ermächtigende förmliche Gesetz aber alle für die Grundrechtsausübung wesentlichen Fragen selbst regeln. Speziell zur Berufsfreiheit gilt dabei: Je schwerwiegender der Eingriff in die Berufsfreiheit ausfällt, desto detaillierter muss die formell-gesetzliche Regelung sein. Lediglich Randfragen der Berufszulassung und generell Fragen der Berufsausübung können der Exekutive überlassen werden (siehe R. Schmidt, Grundrechte, 25. Auflage, 2020, Rn. 798). Und in einer anderen Entscheidung heißt es: „Dabei muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich sind (...). Je stärker in grundrechtlich geschützte Bereiche eingegriffen wird, desto deutlicher muss das gesetzgeberische Wollen zum Ausdruck kommen (...)“ (BVerfG NJW 2019, 584, 585 mit Verweis auf BVerfGE 73, 280, 295; 80, 1, 20; 87, 287, 317; 98, 49, 60).
Vor diesem Hintergrund ist zweifelhaft, ob Art. 75 II S. 1 BayBeamtG der Wesentlichkeitsrechtsprechung gerecht wird. Denn in dieser Vorschrift wird lediglich die oberste Dienstbehörde ermächtigt, nähere Bestimmungen u.a. über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen treffen, wozu auch Bestimmungen über Haar- und Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale zählen. Das Gesetz selbst enthält keine konkreten Angaben über die Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild. Das legt die Annahme eines Verstoßes gegen die Wesentlichkeitsrechtsprechung nahe.
So stellt etwa eine Verordnung eines Landesjustizministeriums, die es dem Justizprüfungsamt erlaubt, auf der Basis einer Auflage einer Rechtsreferendarin muslimischen Glaubens zu verbieten, im Gerichtssaal (auf der Richterbank sitzend bzw. als Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft agierend) oder bei Vernehmungen ein Kopftuch zu tragen, keine hinreichende Rechtsgrundlage dar (richtig VG Augsburg 30.6.2016 – Au 2 K 15.457 – mit Bespr. v. Muckel, JA 2017, 78; siehe auch BVerfG NJW 2017, 2333, 2334 – Kopftuchverbot ggü einer Referendarin im Gerichtssaal; VGH München BayVBl 2018, 672). Denn eine solche Angelegenheit ist von einer derart hohen Grundrechtsrelevanz, dass sie nur durch den förmlichen Gesetzgeber geregelt werden könnte. Existiert also keine Verbotsregelung im Justizausbildungsgesetz (JAG) bzw. keine Verweisung von dort auf die beamtengesetzliche Regelung über die Neutralitätspflicht (in der jeweils geltenden Fassung, sog. dynamische Verweisung), liegt ein Verstoß gegen die Wesentlichkeitsrechtsprechung vor (siehe BVerfG 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17 Rn. 84 –Kopftuchverbot ggü Rechtsreferendarinnen).
Auch ist die Festlegung von Altershöchstgrenzen für die Einstellung in den öffentlichen Dienst derart wesentlich für die betroffenen Bewerber, dass sie nur durch formelles Gesetz erfolgen kann. Werden Altersgrenzen lediglich in Laufbahnverordnungen (Rechtsverordnungen) festgelegt, ist dies bereits wegen Verstoßes gegen Art. 80 I S. 2 GG bzw. die Wesentlichkeitsrechtsprechung rechtswidrig, wenn es an einer hinreichend bestimmten Ermächtigungsgrundlage fehlt.
Auch bestimmte körperliche Anforderungen, die an einen Beruf gestellt werden (etwa Mindestgröße für den Polizeidienst), müssen vom Gesetzgeber selbst geregelt werden und dürfen weder der Regelung durch Laufbahnverordnung (Rechtsverordnung) noch durch Ministeriumserlass (Verwaltungsvorschrift) überlassen werden (siehe dazu VG Düsseldorf 8.8.2017 – 2 K 7427/17 – mit Verweis auf BVerfGE 139, 19; siehe auch OVG Münster NWVBl 2018, 27 ff.).
Ebenso ist entschieden worden, dass die Ablehnung eines Polizeibewerbers wegen einer (sichtbaren) Tätowierung schon allein dann rechtswidrig ist, wenn sich die Kriterien für die Ablehnungsentscheidung nicht auf eine formell-gesetzliche Rechtsgrundlage stützen lassen; keinesfalls genügt eine Verwaltungspraxis (OVG Berlin-Brandenburg 28.8.2018 – 4 S 36.18).
Überträgt man die in den genannten Fällen gewonnenen Erkenntnisse, könnte das in der Tat zu der Annahme führen, Art. 75 II S. 1 BayBeamtG werde der Wesentlichkeitsrechtsprechung nicht gerecht. Jedoch relativiert das BVerfG die aufgezeigten vermeintlich hohen Anforderungen wiederum, indem es formuliert, dass sich die Eingriffsvoraussetzungen nicht ohne weiteres aus dem Wortlaut des Gesetzes ergeben müssten; es genüge, dass sie sich mit Hilfe allgemeiner Auslegungsgrundsätze erschließen lassen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusammenhang und der Vorgeschichte der Regelung (BVerfG NJW 2019, 584, 585 mit Verweis auf BVerfGE 19, 17, 30; 58, 257, 277; 62, 203, 210; 80, 1, 20 f.; 82, 209, 224).
Wohl vor diesem Hintergrund hat das BVerwG im vorliegenden Fall entschieden, dass bereits im Bayerischen Beamtengesetz selbst für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale (wie etwa ein Branding oder ein Ohrtunnel) im beim Tragen der Uniform sichtbaren Körperbereich geregelt sei. Dies ergebe sich aus der Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung.
Auch wenn man damit von der Vereinbarkeit des Art. 75 II BayBeamtG mit der Wesentlichkeitsrechtsprechung ausgeht, bleibt noch die Frage zu klären, ob die Regelung des Art. 75 II BayBeamtG und die darauf ergangene behördliche Versagungsverfügung auch verhältnismäßig sind.
Da die gesetzliche Regelung der obersten Dienstbehörde lediglich die Befugnis einräumt, nähere Bestimmungen über das während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der Beamten und Beamtinnen zu treffen, nicht aber zwingende Maßnahmen vorschreibt, ist sie als Ermessensnorm insoweit nicht zu beanstanden (Anm.: In einer Fallbearbeitung müssten die Komponenten des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes geprüft werden; bei der Angemessenheit wäre dann das Schutzgut der beamtenrechtlichen Neutralitätspflicht mit dem APR – abstrakt – abzuwägen).
Bei der Einzelfallprüfung erweist sich die Verhältnismäßigkeit als problematisch. Kann man von der Geeignetheit und Erforderlichkeit noch ausgehen, ist aber die Angemessenheit der Versagungsverfügung zweifelhaft. Denn angemessen ist eine staatliche Maßnahme nur dann, wenn das mit ihr verfolgte Ziel in seiner Wertigkeit nicht außer Verhältnis zur Intensität des Eingriffs steht (vgl. nur BVerfG NJW 2019, 1432, 1433; BVerfG NJW 2019, 827, 830; BVerfG NJW 2019, 584, 585; BVerfGE 117, 163, 182 f.; 133, 277, 322; BVerwG NJW 2018, 2067, 2070). Je schwerwiegender die Grundrechtsbeeinträchtigung ist, desto gewichtiger müssen die Gründe für die Einschränkung sein. An dieser Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne könnte es vorliegend fehlen. Das mit der Versagung der Genehmigung des Stechens einer beim Tragen der Dienstkleidung sichtbaren Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm verfolgte Ziel ist die Gewährleistung der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten. Die Rechtsgemeinschaft soll sich darauf verlassen dürfen, dass Polizeibeamte als Repräsentanten des demokratischen Rechtsstaates stets neutral und unvoreingenommen ihren Dienst verrichten und entsprechend auftreten. In Ansehung von Funktion und Bedeutung ihres Amtes haben sie staatliche Neutralität und Gesetzestreue zu verkörpern (siehe etwa § 60 BBG, § 33 BeamtStG). Zu Recht weist die Rechtsprechung darauf hin, dass das Berufsbeamtentum eine stabile gesetzestreue Verwaltung sichern, die freiheitlich demokratische Rechtsordnung verteidigen und durch Unabhängigkeit und Unparteilichkeit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften darstellen soll. Das Vertrauen, dass der Beamte diesem Auftrag gerecht werde, und dessen er zur Erfüllung seiner Aufgabe bedürfe, dürfe der Beamte auch durch sein außerdienstliches Verhalten nicht beeinträchtigen (VG Magdeburg, Urt. v. 28.1.2020 – 15 A 4/19 Rn. 26 mit Verweis auf BVerwG, Urt. v. 30.08.2000 – 1 D 37.99).
Allerdings hat sich in jüngerer Zeit ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen. So werden nach der Rechtsprechung (siehe etwa VG Magdeburg, Urt. v. 28.1.2020 – 15 A 4/19) Beamte nicht mehr als Vorbild in allen Lebenslagen angesehen, die besonderen Anforderungen an Moral und Anstand unterliegen. Die Vorstellung, dass der Beamte „niemals Privatmann“ sei, sondern auch außerhalb des Dienstes Beamter, der stets auf seine Amtsstellung Rücksicht zu nehmen habe, habe der Gesetzgeber zum Schutz der Privatsphäre des Beamten bewusst aufgegeben (siehe § 47 I S. 2 BeamtStG, wo der in der Vorgängervorschrift des BRRG vorhandene Ansehensverlust nicht übernommen wurde). Der Gesetzgeber habe durch die gesetzliche Regelung zum Ausdruck bringen wollen, dass von einem Beamten außerdienstlich kein wesentlich anderes Sozialverhalten als von jedem Bürger erwartet werde. Das trifft auf im Privatleben angebrachte Tätowierungen zu. Tätowierungen weisen jedoch die Besonderheit auf, dass sie sich während der Dienstausübung allenfalls verdecken, nicht aber ablegen lassen, wodurch ein innerdienstlicher Bezug hergestellt ist. Daher lassen sich die Pflichten insbesondere eines Polizeibeamten, in Ansehung von Funktion und Bedeutung ihres Amtes staatliche Neutralität und Gesetzestreue zu verkörpern, nicht relativieren.
Freilich bleibt die Frage zu beantworten, ob eine beim Tragen der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung mit dem Schriftzug „aloha“ auf dem Unterarm das Ansehen des Beamten im Hinblick auf Neutralität und Gesetzestreue tatsächlich zu erschüttern vermag. Das BVerwG ist dieser Auffassung. Äußerlich erkennbare Tätowierungen und vergleichbare auf Dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren Bereich seien mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten unvereinbar. Durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützte individuelle Interessen der Polizeivollzugsbeamten an einer Tätowierung müssten für den – bezogen auf den Gesamtkörper beim Tragen der Dienstkleidung kleinen – sichtbaren Bereich gegenüber der Notwendigkeit eines einheitlichen und neutralen Erscheinungsbildes zurücktreten.
Stellungnahme: Eine solche Annahme ist – entgegen der Auffassung des BVerwG – nicht zwingend. Denn wie aufgezeigt, sind auch an innerdienstliche Verhaltensweisen mit Persönlichkeitsbezug nicht mehr dieselben hohen Maßstäbe anzulegen, wie das früher der Fall war. Geht also von einer Tätowierung keine die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdende Wirkung aus (wie das insbesondere bei den Nationalsozialismus verherrlichenden Motiven der Fall wäre) und bringt sie keine beleidigenden, gewaltverherrlichenden, Angst einflößenden oder obszönen Botschaften zum Ausdruck und sollte auch nicht die Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten in Frage gestellt sein, sollte dem APR der Vorrang verliehen werden.
So hat auch das OVG Münster im Rahmen eines Eilverfahrens entschieden, dass das Land NRW einen Polizeianwärter nicht wegen einer großflächigen Löwen-Tätowierung auf der Brust ablehnen darf (OVG Münster, Beschl. v. 12.05.2020 – 6 B 212/20). Die den Antrag auf Einstellung in den Polizeidienst ablehnende Dienstbehörde begründete ihre Entscheidung damit, es bestünden wegen des Tattoos Zweifel an der charakterlichen Eignung. Der Zähne fletschende Löwenkopf wirke angriffslustig und aggressiv auf den Betrachter und er vermittle einen gewaltverherrlichenden Eindruck. Der Polizeianwärter bringe damit zum Ausdruck, dass er sich nicht an die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gebunden fühle.
Nun wurde auch vom Verfasser dieses Beitrags aufgezeigt, dass gewaltverherrlichende Motive durchaus die Gewährleistung der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten in Frage stellen. Die Rechtsgemeinschaft soll sich darauf verlassen dürfen, dass Polizeibeamte als Repräsentanten des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates stets neutral und unvoreingenommen ihren Dienst verrichten und entsprechend auftreten (s.o.). Jedoch darf bezweifelt werden, ob das Motiv eines Zähne fletschenden Löwenkopfs angriffslustig und aggressiv auf den Betrachter wirkt und einen gewaltverherrlichenden Eindruck vermittelt, der Zweifel an der Bindung an die freiheitliche demokratische Grundordnung aufkommen lässt. Denn auch die Rechtsprechung geht (in Bezug auf die Meinungsäußerungsfreiheit) im Allgemeinen davon aus, dass bei Aussagen mehrdeutigen Inhalts diejenige zugrunde zu legen sei, die von dem Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sei. Verkenne das Gericht diese Deutungsmöglichkeit und damit die Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit, verletze es mit seinem die Meinungsäußerungsfreiheit beschränkenden Urteil das Grundrecht aus Art. 5 I S. 1 Var. 1 GG (BVerfG NJW 2009, 908, 909). Generell hat das BVerfG in zahlreichen Entscheidungen in Zweifelsfällen eine weite, nämlich diejenige Auslegung gewählt, „welche die juristische Wirkungskraft der Grundrechtsnorm am stärksten entfaltet“ (Vgl. nur BVerfGE 7, 377, 397; 32, 54, 72; 39, 1, 38; 78, 179, 193).
Zu Recht hat daher auch das OVG Münster entschieden, dass der fein konturierten, realitätsgetreuen Abbildung eines männlichen Löwenkopfes in brüllender Manier kein in ihrem Deutungsgehalt eindeutiger, die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage stellender Inhalt zukomme. Angesichts der Intensität des mit der Ablehnung verbundenen Eingriffs in die Berufsfreiheit bedürfe es weiterer Anhaltspunkte, um aus dem vom Antragsteller gewählten Motiv auf eine Eignungszweifel begründende, hier insbesondere gewaltverherrlichende Einstellung seiner Person schließen zu können. An solchen Anhaltspunkten fehle es hier jedoch. Der Antragsteller habe eine gewaltverherrlichende Einstellung dementiert und auf im Zusammenhang mit seiner Trainertätigkeit erworbene soziale Kompetenzen hingewiesen. Für ihn stehe der Löwe für Stärke, Mut und Macht (OVG Münster, Beschl. v. 12.05.2020 – 6 B 212/20).
Ergebnis: Übertragen auf den vorliegend zu besprechenden Fall bedeutet das: Es ist bereits zweifelhaft, ob die Vorschrift des Art. 75 II BayBeamtG mit der Wesentlichkeitsrechtsprechung des BVerfG vereinbar ist. Jedenfalls aber ist die ablehnende Entscheidung der obersten Dienstbehörde unverhältnismäßig, weil sie die Bedeutung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verkennt. Denn geht von einer Tätowierung keine die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdende Wirkung aus (wie das insbesondere bei den Nationalsozialismus verherrlichenden Motiven der Fall wäre) und bringt sie keine beleidigenden, gewaltverherrlichenden, Angst einflößenden oder obszönen Botschaften zum Ausdruck, ist dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Vorrang zu gewähren, außer, aus dem Gesamterscheinungsbild ergibt sich die Gefahr, dass die Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten nicht gewährleistet ist. Die ablehnende Entscheidung der obersten Dienstbehörde sowie die sie bestätigenden Gerichtsurteile sind – da sie dieser Frage offenbar nicht nachgegangen sind – rechtswidrig und verletzen den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Rolf Schmidt
(16.05.2020)
09.05.2020: Anleihenkauf der EZB – Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
BVerfG, Urteil v. 05.05.2020 – 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16
Mit Urteil v. 05.05.2020 hat der 2. Senat des BVerfG entschieden, dass das von der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelegte Public Sector Purchase Programme (PSPP), ein Teil des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) zum Ankauf von Staatsanleihen an den Sekundärmärkten, das wiederum ein Rahmenprogramm der EZB zum Ankauf von Vermögenswerten („Anleihenkauf der EZB“) darstellt, nicht von vornherein die zugewiesenen Kompetenzen überschritten habe. Einen Ultra-vires-Akt stelle aber das bestätigende Urteil des EuGH (EuGH EuZW 2019, 162) dar. Denn der EuGH habe die im europäischen Rechtsraum überkommenen Auslegungsmethoden und allgemeinen, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamen Rechtsgrundsätze wie insbesondere den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit außer Acht gelassen. Er habe in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des auch bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 I S. 2, IV EUV) verkannt, weshalb sein Urteil wegen der vollständigen Ausklammerung der tatsächlichen Auswirkungen des Programms auf die Wirtschaftspolitik methodisch nicht mehr vertretbar sei. Eine offenkundige Außerachtlassung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der damit einhergehenden Gesamtabwägung sei vom Mandat des Art. 19 I S. 2 EUV nicht umfasst. Es liege ein Verstoß gegen Art. 38 I S. 1 GG i.V.m. Art. 20 I und II GG i.V.m. Art. 79 III GG vor. Ob das Urteil des BVerfG überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
BVerfG, Urteil v. 05.05.2020 – 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16
Mit Urteil v. 05.05.2020 hat der 2. Senat des BVerfG entschieden, dass das von der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelegte Public Sector Purchase Programme (PSPP), ein Teil des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) zum Ankauf von Staatsanleihen an den Sekundärmärkten, das wiederum ein Rahmenprogramm der EZB zum Ankauf von Vermögenswerten („Anleihenkauf der EZB“) darstellt, nicht von vornherein die zugewiesenen Kompetenzen überschritten habe. Einen Ultra-vires-Akt stelle aber das bestätigende Urteil des EuGH (EuGH EuZW 2019, 162) dar. Denn der EuGH habe die im europäischen Rechtsraum überkommenen Auslegungsmethoden und allgemeinen, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamen Rechtsgrundsätze wie insbesondere den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit außer Acht gelassen. Er habe in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des auch bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 I S. 2, IV EUV) verkannt, weshalb sein Urteil wegen der vollständigen Ausklammerung der tatsächlichen Auswirkungen des Programms auf die Wirtschaftspolitik methodisch nicht mehr vertretbar sei. Eine offenkundige Außerachtlassung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der damit einhergehenden Gesamtabwägung sei vom Mandat des Art. 19 I S. 2 EUV nicht umfasst. Es liege ein Verstoß gegen Art. 38 I S. 1 GG i.V.m. Art. 20 I und II GG i.V.m. Art. 79 III GG vor. Ob das Urteil des BVerfG überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
Ausgangslage:
Wie bei R. Schmidt, Staatsorganisationsrecht, 21. Aufl. 2020, Rn. 338 erläutert, beruht das EU-Recht auf dem Prinzip der enumerativen Einzelermächtigung (vgl. Art. 5 EUV): Die Union verfügt nur über solche Kompetenzen, die ihr enumerativ übertragen wurden. Insbesondere kommt ihr keine „Kompetenz-Kompetenz“ zu, d.h. nicht die Befugnis, sich selbstständig neue Kompetenzen zu geben (dies ist der Unterschied zum verfassten Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland: Das Grundgesetz verleiht dem Bund – wenn auch unter Mitwirkung der Länder über den Bundesrat – die Kompetenz, durch Änderung des Grundgesetzes seine Kompetenzen auszuweiten). Die Europäische Union kann ihre Aufgaben und Zuständigkeiten nicht selbst ausweiten, sondern nur solche in Anspruch nehmen, die ihr durch Vertragsergänzungen oder -änderungen eingeräumt worden sind („enumerative Handlungsermächtigung“). Eine Generalermächtigung, d.h. die Übertragung der Befugnis, Verfassungsrecht zu setzen und eigene Kompetenzen zu begründen bzw. vorhandene auszuweiten, wäre trotz der Integrationsermächtigung des Art. 23 I S. 1 und 2 GG unter der Geltung des Grundgesetzes auch nicht möglich, denn auf ihre staatliche Souveränität kann die Bundesrepublik Deutschland nicht verzichten. Das schreibt Art. 79 III GG fest, der u.a. die Unveränderbarkeit der Art. 1 GG und Art. 20 GG anordnet und dabei auch vor der Integrationsermächtigung in Art. 23 I S. 1 u. 2 GG nicht Halt macht (vgl. Art. 23 I S. 3 GG – Bestandssicherungsklausel, dazu R. Schmidt, Staatsorganisationsrecht, 21. Aufl. 2020, Rn. 348). In Art. 20 I, II GG ist das Demokratieprinzip als geltendes Verfassungsrecht festgeschrieben. Der Bundestag als unmittelbar demokratisch legitimiertes Organ wäre seiner Aufgabe, alle wesentlichen Aspekte des Gemeinwesens zu regeln, beraubt, erhielte die EU umfassende Hoheitsrechte.
Verfügt die EU damit also lediglich über übertragene Einzelermächtigungen, folgt daraus, dass sie auch nur Maßnahmen ergreifen und Akte erlassen darf, die von den übertragenen Kompetenzen gedeckt sind. Überschreiten Organe der EU die ihnen eingeräumten Handlungsbefugnisse (Kompetenzüberschreitung), sind – wie das BVerfG in ständiger Rechtsprechung zum Ausdruck bringt – daraus hervorgegangene „ausbrechende Rechtsakte“ („Ultra-vires-Akte“) für deutsche Stellen nicht verbindlich. Für solche Rechtsakte könne dann kein Anwendungsvorrang des EU-Rechts gegenüber nationalem (Verfassungs-)Recht bestehen, sodass Prüfungsmaßstab der fraglichen nationalen Norm, die aufgrund von sekundärem EU-Recht ergeht, wieder das Grundgesetz sei. In diesem Fall entscheide dann wieder das BVerfG im Rahmen einer „Ultra-vires-Kontrolle“ (BVerfGE 126, 286, 302 – Honeywell bzw. Mangold; BVerfG NJW 2019, 3204, 3206 ff. – Europäische Bankenunion).
Das BVerfG fordert aber eine „besondere Qualität“ der ausbrechenden Rechtsakte der Union, um eine Prüfungskompetenz annehmen zu können: Während es im Lissabon-Urteil (BVerfGE 123, 267, 348 ff.) seine Kontrollbefugnis noch auf „ersichtliche Grenzüberschreitungen“ festgelegt hatte, machte es in seinem „Honeywell-Beschluss“ (BVerfGE 126, 286, 302) einschränkend deutlich, dass es sich hinsichtlich der Überprüfung von Rechtsakten der EU am Maßstab des Grundgesetzes nur dann für zuständig erachte, wenn der gerügte Ultra-vires-Verstoß „praktisch kompetenzbegründend wirkt“, wobei ein „hinreichend qualifizierter“ Verstoß dergestalt zu fordern sei, „dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zwischen Mitgliedstaat und Union im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die rechtsstaatliche Gesetzesbindung erheblich ins Gewicht fällt“. Damit stellt das BVerfG also sehr hohe Anforderungen, damit von einem „ausbrechenden Rechtsakt“ gesprochen werden kann.
Ganz
offensichtlich versucht das BVerfG damit also, einen Kompetenzkonflikt
mit dem EuGH nach Möglichkeit zu vermeiden. Im vorliegend zu
besprechenden Fall schien es aber einen solchen Konflikt nicht mehr
abwenden zu können.
Das BVerfG entscheidet aber nicht nur im Fall einer Kompetenzüberschreitung eines Organs der EU, sondern auch dann, wenn durch eine Maßnahme der EU in Art. 79 III GG genannte unabänderbare und damit integrationsfeste Verfassungsprinzipien aus Art. 1 GG und Art. 20 GG, die zudem durch Art. 4 II EUV geschützt sind, missachtet würden (vgl. BVerfGE 126, 286, 302 mit Bezugnahme auf BVerfGE 75, 223, 235 ff.; 113, 273, 296; 123, 267, 353 f.; vgl. auch BVerfG NJW 2016, 1149, 1150 f. – Identitätskontrolle). Sollte durch eine Maßnahme der EU also ein durch Art. 79 III GG für unantastbar erklärter Grundsatz aus Art. 1 GG oder Art. 20 GG berührt werden, findet der Anwendungsvorrang der EU (ebenfalls) seine Grenzen. In diesem Fall erklärt sich das BVerfG dann für zuständig und erklärt den betreffenden EU-Rechtsakt im Rahmen einer „Identitätskontrolle“ (Kontrolle der Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland) für unanwendbar BVerfG NJW 2016, 1149, 1151 – Identitätskontrolle).
Zu prüfen gilt es daher, ob mit dem PSPP-Programm der EZB ein „hinreichend qualifizierter“ Rechtsverstoß (ein Ultra-vires-Akt) bzw. eine Verletzung der Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland vorliegt.
Sachverhalt:
Das EAPP ist ein Rahmenprogramm, das sich aus mehreren Unterprogrammen zusammensetzt. Unter anderem zählt das PSPP zu diesen Unterprogrammen. Gemäß der Begründung der EZB – die das BVerfG heranzieht – zielt das EAPP auf eine Ausweitung der Geldmenge und damit auf eine geldpolitische Lockerung (vgl. EZB, Pressemitteilung v. 22.01.2015 – in Bezug genommen von BVerfG Rn. 3). Unternehmen und private Haushalte sollen Finanzmittel günstiger aufnehmen können. Dies befördere Investitionen und Konsum, freilich mit der Folge, dass sich die Inflation einem „Niveau von 2 % annähern“ könne (vgl. 2. Erwägungsgrund Beschluss <EU> 2015/774 der EZB v. 04.03.2015 über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten <EZB/2015/10>, ABl EU Nr. L 121 v. 14.05.2015, S. 20; vgl. auch Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juni 2016, S. 39) – BVerfG Rn. 3. Um hypothetischen Verlusten zu begegnen, erwerben im
Rahmen des PSPP die EZB und die Zentralbanken der
Euro-Mitgliedstaaten nach einem bestimmten Kapitalschlüssel und unter
bestimmten Bedingungen v.a. Staatsanleihen.
Wie das BVerfG feststellt, war der Umfang des EAPP (bzw. des PSPP) 2015/2016 zunächst auf monatliche Ankäufe in Höhe von 60 Milliarden Euro begrenzt. Im April 2016 wurde das Volumen der Ankäufe auf monatlich etwa 80 Milliarden Euro angehoben (BVerfG Rn. 5). Nach zwischenzeitlicher Absenkung des Ankaufvolumens beschloss der EZB-Rat am 12. September 2019 die Wiederaufnahme der Anleihekäufe ab dem 1. November 2019 im Umfang eines Netto-Ankaufvolumens von 20 Milliarden Euro monatlich (vgl. EZB, Pressemitteilung v. 12.09.2019, S. 1; Einleitende Bemerkungen zur Pressekonferenz v. 12.09.2019, S. 1) – BVerfG Rn. 7.
Zum 8.11.2019 hatten die EZB und die nationalen Zentralbanken der Eurozone (Art. 282 I S. 2 AEUV) im Rahmen des EAPP Wertpapiere im Gesamtwert von 2.557.800 Millionen Euro erworben, wovon 2.088.100 Millionen Euro (81,63 %) auf das PSPP entfielen (vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht November 2019, S. 24) – BVerfG Rn. 8.
Geltend gemachte Grundrechtsverletzung:
Die Beschwerdeführer machen geltend, das angegriffene Programm stelle eine hinreichend qualifizierte Kompetenzübertretung dar und verletze die durch das Grundgesetz geschützte Verfassungsidentität. Die staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland hätten entgegen ihrer Integrationsverantwortung nicht auf die Unterlassung und Beseitigung dieser Rechtsverstöße hingewirkt. Damit werde auch das Recht der Beschwerdeführer aus Art. 38 I S. 1 GG verletzt. Nach den vom BVerfG entwickelten Maßstäben seien die Verfassungsorgane verpflichtet, gegen die mit Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 II GG unvereinbare Ausweitung der Kompetenzen der EZB in den bislang den Mitgliedstaaten vorbehaltenen Bereich der Wirtschafts- und Fiskalpolitik vorzugehen.
Die Entscheidung des BVerfG:
In seinem Urteil macht das BVerfG nochmals deutlich, dass die Wahrung der kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union entscheidende Bedeutung für die Gewährleistung des demokratischen Prinzips habe. Die Finalität des Integrationsprogramms dürfe nicht dazu führen, dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung als eines der Fundamentalprinzipien der Europäischen Union faktisch außer Kraft gesetzt werde (Rn. 158 des Urteils). Das heißt: Die begrenzte Einzelermächtigung wahrt das Demokratieprinzip aus Art. 20 I, II GG und damit auch das individualschützende grundrechtsgleiche Recht aus Art. 38 I S. 1 GG. Eine Maßnahme der EU, die jenseits einer übertragenen Einzelermächtigung ergangen ist, stellt einen Ultra-vires-Akt bzw. eine Verletzung der Verfassungsidentität dar und entfaltet innerstaatlich keine Rechtswirkung. Jedoch nimmt sich das BVerfG bei der Feststellung eines solchen „ausbrecherischen Akts“ zurück. Bei der Frage nach der Gültigkeit oder Auslegung einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union legt es seiner Prüfung grundsätzlich den Inhalt und die Beurteilung zugrunde, die die Maßnahme durch den EuGH erhalten hat (Rn. 118 des Urteils). Entscheidet also der EuGH über die Vereinbarkeit eines Aktes des Sekundärrechts mit Primärrecht, sieht sich das BVerfG daran gebunden, außer die Entscheidung des EuGH stellt – trotz des weiten Ermessens des handelnden Organs, das das BVerfG diesem einräumt – einen Ultra-vires-Akt bzw. eine Verletzung der Verfassungsidentität dar.
Im vorliegenden Fall hat das BVerfG im PSPP und dem bestätigenden Urteil des EuGH nicht von vornherein einen Ultra-vires-Akt bzw. eine Verletzung der Verfassungsidentität festgestellt. Im Gegenteil geht es davon aus, dass das PSPP keine qualifizierte Verletzung des Verbots monetärer Staatsfinanzierung (Art. 123 I AEUV) und auch keine Verletzung der Verfassungsidentität darstellt. Es hat aber beanstandet, dass der EuGH bei der Prüfung des PSPP in nicht hinreichender Weise den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten angewendet habe, was zur Folge habe, dass die damit verbundene wertende Gesamtbetrachtung fehlerhaft sei, die für das Demokratieprinzip und den Grundsatz der Volkssouveränität erhebliches Gewicht habe. Die weitgehende Entleerung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der damit verbundene Verzicht auf eine wertende Gesamtbetrachtung seien geeignet, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union zu verschieben und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen. Eine offenkundige Außerachtlassung der im europäischen Rechtsraum überkommenen Auslegungsmethoden oder allgemeiner, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamer Rechtsgrundsätze sei nicht nur (methodisch) nicht mehr nachvollziehbar, sondern auch vom Mandat des Art. 19 I S. 2 EUV nicht umfasst (Rn. 158 ff. des Urteils). Damit habe der EuGH gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gem. Art. 5 I EUV verstoßen. Sein Urteil stelle einen Ultra-vires-Akt dar. Es liege ein Verstoß gegen Art. 38 I S. 1 GG i.V.m. Art. 20 I und II GG i.V.m. Art. 79 III GG vor (Rn. 158 ff. des Urteils).
Bewertung:
Zu Recht weist das BVerfG darauf hin, dass das Europäische System der Zentralbanken keine Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben darf (Rn. 139 des Urteils). Auch ist der Feststellung zuzustimmen, dass das Verbot monetärer Staatsfinanzierung (Art. 123 I AEUV) es nicht ausschließt, unter dem Gesichtspunkt des Art. 5 I S. 2, IV EUV (wonach für die Ausübung der aus den begrenzten Einzelermächtigungen folgenden Zuständigkeiten der Union die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gelten) die Auswirkungen zu erfassen, die ein Ankaufprogramm für Staatsanleihen etwa für die Staatsverschuldung, Sparguthaben, Altersvorsorge, Immobilienpreise, das Überleben wirtschaftlich nicht überlebensfähiger Unternehmen habe, und sie – im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung – zu dem angestrebten und erreichbaren währungspolitischen Ziel in Beziehung zu setzen. Denn die wertende Gesamtbetrachtung ist Kernelement jeder Verhältnismäßigkeitsprüfung; auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts. Art. 5 I S. 2, IV EUV stellt dies klar. Die Nichtvornahme einer angezeigten Verhältnismäßigkeitsprüfung stellt also in der Tat einen schweren Fehler und damit einen „hinreichend qualifizierten“ Verstoß dar.
Wenn aber das BVerfG davon ausgeht, dass das PSPP nicht gegen das Verbot monetärer Staatsfinanzierung (Art. 123 I AEUV) verstößt, hätte daran auch die Vornahme einer wertenden Gesamtbetrachtung durch den EuGH nichts geändert. Mit der gleichen Überlegung nicht ergebnisrelevant (fehlende Fehlerkausalität) war dann auch die vom BVerfG beanstandete nicht erfüllte Verpflichtung der Bundesregierung und des Bundestags, aufgrund ihrer Integrationsverantwortung auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken und ihre Rechtsauffassung gegenüber der Europäischen Zentralbank deutlich zu machen oder auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände zu sorgen (vgl. Rn. 232 des Urteils). Daher war die Entscheidung des BVerfG nach Auffassung des Verfassers nicht zwingend. Es hätte ausgereicht, den „hinreichend qualifizierten“ Rechtsverstoß des EuGH aufzuzeigen, wegen fehlender Kausalität es aber dabei zu belassen. Das wiederum wirft die Frage nach der Zielsetzung der Entscheidung auf. Möglicherweise ist sie in den Kontext zum Beschluss des Ersten Senats v. 06.11.2019 – 1 BvR 276/17 („Recht auf Vergessenwerden II“) einzuordnen. Dort hatte ja das BVerfG entschieden, dass es Akte deutscher Stellen, die unionsrechtlich vollständig vereinheitlichte Regelungen des Unionsrechts anwenden, am Maßstab der Unionsgrundrechte (!) prüft, soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt werden. Auch diese Entscheidung wurde vom Verfasser kritisiert (siehe den Aktuelles-Beitrag v. 01.12.2019), weil das BVerfG für sich einen Prüfungsmaßstab in Anspruch nimmt, der vom Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Danach prüft das BVerfG – wie sich aus Art. 93 GG ergibt – Akte der öffentlichen Gewalt allein am Maßstab des Grundgesetzes. Daran ändert auch die (selbst auferlegte) „Integrationsverantwortung“ des BVerfG nichts. Und mit ebenjener „Integrationsverantwortung“ stellt sich das BVerfG im Urteil zum Anleihenkauf der EZB gegen den EuGH. Vielleicht ist die Antwort auf die vom Verfasser aufgeworfene Frage nach dem Grund simpel: Das BVerfG möchte auf „Augenhöhe“ mitentscheiden oder tendiert sogar zur „Letztentscheidungskompetenz“.
Wenn aber das BVerfG davon ausgeht, dass das PSPP nicht gegen das Verbot monetärer Staatsfinanzierung (Art. 123 I AEUV) verstößt, hätte daran auch die Vornahme einer wertenden Gesamtbetrachtung durch den EuGH nichts geändert. Mit der gleichen Überlegung nicht ergebnisrelevant (fehlende Fehlerkausalität) war dann auch die vom BVerfG beanstandete nicht erfüllte Verpflichtung der Bundesregierung und des Bundestags, aufgrund ihrer Integrationsverantwortung auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken und ihre Rechtsauffassung gegenüber der Europäischen Zentralbank deutlich zu machen oder auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände zu sorgen (vgl. Rn. 232 des Urteils). Daher war die Entscheidung des BVerfG nach Auffassung des Verfassers nicht zwingend. Es hätte ausgereicht, den „hinreichend qualifizierten“ Rechtsverstoß des EuGH aufzuzeigen, wegen fehlender Kausalität es aber dabei zu belassen. Das wiederum wirft die Frage nach der Zielsetzung der Entscheidung auf. Möglicherweise ist sie in den Kontext zum Beschluss des Ersten Senats v. 06.11.2019 – 1 BvR 276/17 („Recht auf Vergessenwerden II“) einzuordnen. Dort hatte ja das BVerfG entschieden, dass es Akte deutscher Stellen, die unionsrechtlich vollständig vereinheitlichte Regelungen des Unionsrechts anwenden, am Maßstab der Unionsgrundrechte (!) prüft, soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt werden. Auch diese Entscheidung wurde vom Verfasser kritisiert (siehe den Aktuelles-Beitrag v. 01.12.2019), weil das BVerfG für sich einen Prüfungsmaßstab in Anspruch nimmt, der vom Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Danach prüft das BVerfG – wie sich aus Art. 93 GG ergibt – Akte der öffentlichen Gewalt allein am Maßstab des Grundgesetzes. Daran ändert auch die (selbst auferlegte) „Integrationsverantwortung“ des BVerfG nichts. Und mit ebenjener „Integrationsverantwortung“ stellt sich das BVerfG im Urteil zum Anleihenkauf der EZB gegen den EuGH. Vielleicht ist die Antwort auf die vom Verfasser aufgeworfene Frage nach dem Grund simpel: Das BVerfG möchte auf „Augenhöhe“ mitentscheiden oder tendiert sogar zur „Letztentscheidungskompetenz“.
Rolf Schmidt (09.05.2020)
27.02.2020: Verfassungswidrigkeit des Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung
BVerfG, Urteil v. 26.02.2020 – 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16
Mit Urteil v. 26.02.2020 hat der 2. Senat des BVerfG entschieden, dass das in § 217 I StGB normierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gegen das Grundgesetz (d.h. gegen die Grundrechte der jeweiligen Beschwerdeführer) verstößt und nichtig ist, weil es die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
BVerfG, Urteil v. 26.02.2020 – 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16
Mit Urteil v. 26.02.2020 hat der 2. Senat des BVerfG entschieden, dass das in § 217 I StGB normierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gegen das Grundgesetz (d.h. gegen die Grundrechte der jeweiligen Beschwerdeführer) verstößt und nichtig ist, weil es die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
Sachverhalt:
Nach § 217 I StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt. Gegen diese Strafnorm wandten sich u.a. Vereine mit Sitz in Deutschland und in der Schweiz, die Suizidhilfe anbieten, schwer erkrankte Personen, die ihr Leben mit Hilfe eines solchen Vereins beenden möchten, in der ambulanten oder stationären Patientenversorgung tätige Ärzte sowie im Bereich suizidbezogener Beratung tätige Rechtsanwälte. Sie machten eine Verletzung der ihnen jeweils zustehenden Grundrechte geltend. Hinsichtlich der Prüfung ist daher entsprechend dem Kreis der Beschwerdeführer zu differenzieren:
A. Vereinbarkeit des § 217 I StGB mit Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG auf Seiten der Sterbewilligen
Zunächst könnte die Strafnorm des § 217 I StGB mit Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG der Sterbewilligen unvereinbar sein. Dazu müsste zunächst der Schutzbereich dieses Grundrechts eröffnet sein.
I. Eröffnung des Schutzbereichs
Da das reine Abwehrrecht aus Art. 2 I GG den Anforderungen eines umfassenden Schutzes der Persönlichkeit nicht gerecht wird, haben der BGH und das BVerfG schon frühzeitig die Notwendigkeit erkannt, das Schutzniveau des Art. 2 I GG zu verstärken und durch Elemente der Menschenwürde zu durchsetzen. So entstand aus einer Zusammenschau von Art. 2 I GG und Art. 1 I GG das allgemeine Persönlichkeitsrecht (vgl. BGHZ 13, 334, 337 ff.; 30, 7, 12 ff.; BVerfGE 35, 202, 220 ff.; aus jüngerer Zeit vgl. etwa BVerfG NVwZ 2018, 877, 878 – geschlechtliche Identität; BVerfG 6.11.2019 – 1 BvR 16/13 Rn. 80 – „Recht auf Vergessenwerden I“ – insoweit nicht abgedruckt in NVwZ 2020, 53 ff.). Wenn auch durch Elemente der Menschenwürde verstärkt, ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht (APR) dogmatisch dennoch in Art. 2 I GG verortet, um es im Grundansatz einer Abwägung mit widerstreitenden Verfassungsgütern (insbesondere Grundrechte Anderer) zugängig machen zu können.
Unter Heranziehung der ständigen Rechtsprechung (des BVerfG) lassen sich verschiedene Aspekte des Schutzbereichs ausmachen (Übersicht nach R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 267 ff.):
- Die Intimsphäre, insbesondere das Schamgefühl (vgl. BVerfG NJW 2015, 3158, 3159 – Körperliche Durchsuchung bei nacktem Körper) und das Sexualleben (BVerfG NJW 2015, 1506 ff. – kein Auskunftsanspruch Scheinvater gegen Mutter aus § 242 BGB auf Nennung des Namens des biologischen Vaters; BGH NJW 2016, 1094, 1095 f. – Löschungsanspruch in Bezug auf Intimfotos).
- Die enge persönliche Lebenssphäre; das APR verleiht dem Einzelnen die Befugnis, sich (räumlich) zurückzuziehen, abzuschirmen, für sich und allein zu bleiben (vgl. nur BVerfGE 120, 180, 199; 101, 361, 382 ff. – jeweils Caroline von Hannover; BGH MDR 2017, 879 f).
- Das Recht auf Selbstbestimmung. Damit ist zunächst das Recht gemeint, die eigene Abstammung zu kennen, die dem Betroffenen grds. nicht vorenthalten werden darf, da anderenfalls das Persönlichkeitsrecht verletzt sein kann (BVerfGE 90, 263, 270 f. – Anfechtung der Ehelichkeit; 96, 56, 63 – Recht auf Kenntnis des Vaters; BVerfG NJW 2016, 1939, 1940 – isolierte Klärung der Abstammung). Geschützt ist v.a. die sexuelle Selbstbestimmung, insbesondere in Bezug auf das Sexualleben, die Wahl der geschlechtlichen Identität, d.h. das Recht, einem bestimmten Geschlecht anzugehören, die Intersexualität und das Recht, weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht anzugehören (siehe dazu BVerfGE 47, 46, 73 – Sexualkundeunterricht; 49, 286, 287 ff. – Transsexueller; BVerfG NJW 2011, 909 – Transsexueller; NVwZ 2018, 877, 878 – geschlechtliche Identität; BVerwG NJW 2016, 2761 f. – Störung der Geschlechtsidentität; BGH NJW 2016, 1094, 1095 – geschlechtliche Intimität; siehe auch EuGH NVwZ 2018, 643 ff. – Homosexualitätstests für Asylbewerber mit Art. 7 GRC unvereinbar).
- Das Recht auf Selbstbestimmung schließt das Recht ein, auf therapeutische Maßnahmen zu verzichten sowie lebensverlängernde Maßnahmen abzulehnen (BVerfG NJW 2017, 53, 55 ff.; BVerwG NJW 2017, 2215, 2217). Nach der vom Verfasser bereits in der 21. Auflage (März 2017) seines Grundrechtsbuchs vertretenen Auffassung ist durch Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG generell die Entscheidung über den selbstbestimmten Tod und damit auch über den Suizid geschützt, jedenfalls sofern die freie Willensbestimmung nicht ausgeschlossen ist (so die 21. Aufl. Rn. 290; später auch BVerwG NJW 2017, 2215, 2217 sowie BGH NJW-RR 2017, 964, 965). Die staatliche Schutzpflicht muss hinter das Recht des Einzelnen auf einen frei verantworteten Suizid zurücktreten (21. Aufl. a.a.O.).
Das BVerfG hat sich dieser Auffassung angeschlossen. Es hat entschieden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse. Das beinhalte das Recht des zur freien Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Menschen, sich das Leben zu nehmen (Rn. 204 ff. der Entscheidung). Die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, sei von existentieller Bedeutung für die Persönlichkeit eines Menschen. Welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sehe und ob und aus welchen Gründen er sich vorstellen könne, sein Leben selbst zu beenden, unterliege höchstpersönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Der Entschluss zur Selbsttötung betreffe Grundfragen menschlichen Daseins und berühre wie keine andere Entscheidung Identität und Individualität des Menschen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse deshalb nicht nur das Recht, nach freiem Willen lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen. Es erstrecke sich auch auf die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben eigenhändig zu beenden (Rn. 209 der Entscheidung). Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, entziehe sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit. Sie bedürfe keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung, sondern sei im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren (Rn. 210 der Entscheidung).
Auch erteilt das BVerfG dem von der bisher h.M. geltend gemachten Einwand, mit der Entscheidung über den Freitod seien Fragen der nicht disponiblen Menschenwürde betroffen, weshalb über den Freitod nicht entschieden werden könne, eine überaus deutliche Absage: Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben sei unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung; sie sei, wenngleich letzter, Ausdruck von Würde (Rn. 211 der Entscheidung).
Damit steht also fest: Die Menschenwürde verhindert nicht die Entscheidung über den Freitod; sie schützt sie.
Schließlich spannt das BVerfG den Bogen zur assistierten Sterbehilfe, indem es das Recht, sich selbst zu töten, auf die Freiheit erstreckt, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Grundgesetz gewährleiste die Entfaltung der Persönlichkeit im Austausch mit Dritten, die ihrerseits in Freiheit handeln. Sei die Wahrnehmung eines Grundrechts von der Einbeziehung Dritter abhängig und hänge die freie Persönlichkeitsentfaltung an der Mitwirkung eines anderen, schütze das Grundrecht auch davor, durch ein Verbot gegenüber Dritten, im Rahmen ihrer Freiheit Unterstützung anzubieten, beschränkt zu werden (Rn. 213 der Entscheidung).
Fazit zum Schutzbereich:
In deutlicher Klarheit erstreckt das BVerfG den sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ergebenden Schutz auf die eigenverantwortliche Entscheidung über den Freitod. Das schließt das Recht der Hinzuziehung von assistierenden Dritten ein. Die (indisponible) Menschenwürde steht dem nicht entgegen, weil sie gerade auch die Entscheidungumfasst,in Würde zu sterben.
II. Eingriff in den Schutzbereich
Ein Eingriff in den Schutzbereich liegt immer vor, wenn die Ausübung des Freiheitsrechts in beliebiger Weise beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird. Das kann durch rechtsförmliches oder (bei Intensitätsäquivalenz) durch faktisches bzw. faktisch-mittelbares staatliches Verhalten geschehen. Indem § 217 I StGB die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt, greift der Staat in das allgemeine Persönlichkeitsrecht Sterbewilliger ein. Daran ändert nach zutreffender Auffassung des BVerfG auch der Umstand nichts, dass diese nicht unmittelbare Adressaten der Norm sind. Auch staatliche Maßnahmen, die eine mittelbare oder faktische Wirkung entfalten, könnten Grundrechte beeinträchtigen, wenn sie in ihrer Zielsetzung und Wirkung einem normativen und direkten Eingriff gleichkämen, und müssten dann von Verfassungs wegen hinreichend gerechtfertigt sein. Das in § 217 I StGB strafbewehrte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung entfalte eine objektiv die Freiheit zum Suizid einschränkende Wirkung. Es mache es dem Einzelnen faktisch weitgehend unmöglich, Suizidhilfe zu erhalten. Diese Einschränkung individueller Freiheit sei von der Zweckrichtung des Verbots bewusst umfasst und begründe einen Eingriff auch gegenüber suizidwilligen Personen. Angesichts der existentiellen Bedeutung, die der Selbstbestimmung über das eigene Leben für die personale Identität, Individualität und Integrität zukomme, wiege der Eingriff besonders schwer (Rn. 218 der Entscheidung).
III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs
Fraglich ist, ob der durch § 217 I StGB vorgenommene Eingriff in den Schutzbereich des Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Das wäre der Fall, wenn Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG einschränkbar und die Strafnorm des § 217 I StGB formell und materiell mit den Bestimmungen und Grundsätzen des Verfassungsrechts vereinbar wäre.
1. Einschränkbarkeit des Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG
Trotz der Bezugnahme auf den nicht einschränkbaren Art. 1 I GGsind (staatliche) Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht grds. rechtfertigungsfähig. Denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist dogmatisch dem Art. 2 I GG zugeordnet, dessen Schutzniveau (lediglich) durch Art. 1 I GG verstärkt wird (siehe R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 266). Insoweit zieht die Rspr. auch die Schrankentrias des Art. 2 I GG heran (vgl. nur BVerfG NJW 2001, 594, 595 – Willy Brandt; BVerfGE 120, 180, 201; 101, 361, 387 – jeweils Caroline von Hannover; 97, 391, 401; BVerfG NJW 2001, 2320, 2321 – DNA-Identitätsfeststellungsgesetz – allesamt zurückgehend auf BVerfGE 65, 1, 43 – Volkszählung).
2. Formelle und materielle Vereinbarkeit des § 217 I StGB mit Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG
a. Formelle Seite
In formeller
Hinsicht bestehen keine Bedenken; der Bund war gem. Art. 72 I, 74 I Nr. 1 GG zuständig für den Erlass der Strafnorm. Auch bestehen keine Bedenken an der Erforderlichkeit der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet bzw. der Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse (Art. 72 II GG).
b. Materielle Seite
Bedenken bestehen aber hinsichtlich der materiellen
Seite, insbesondere an der Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Eine grundrechtsbeeinträchtigende Maßnahme ist nur dann verhältnismäßig, wenn
- der vom Staat verfolgte Zweck legitim ist, also als solcher verfolgt werden darf,
- der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Ziels geeignet,
- der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Ziels erforderlich
- und der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Ziels angemessen ist
(siehe nur BVerfG NJW 2019, 1432, 1433 – Parteienfinanzierung; BVerfG NJW 2019, 827, 833 – Automatisierte Kennzeichenerfassung – jeweils mit Verweis auf die st. Rspr. BVerfGE 67, 157, 173; 120, 378, 427; 141, 220, 265).
aa.) Legitim
ist der Zweck, wenn er auf das Wohl der Allgemeinheit gerichtet ist bzw. wenn ein öffentliches Interesse verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen ist (BVerfGE 124, 300, 331 – Rudolf-Heß-Gedenkfeier).
Der Zweck des § 217 I StGB besteht nach Auffassung des BVerfG darin, die Selbstbestimmung des Einzelnen über sein Leben und hierdurch das Leben als solches zu schützen (Rn. 227 der Entscheidung). Das ist abzulehnen. Vielmehr besteht der Zweck gerade nicht in dem Schutz der Selbstbestimmung, sondern die Strafnorm schränkt die Selbstbestimmung ein, indem sie die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe stellt. Zweck der Vorschrift ist also vielmehr, das Leben zu schützen, was freilich nichts an der Legitimität der Regelung ändert.
Auch die folgenden Ausführungen des BVerfG sind nicht kohärent. Das BVerfG stellt zwar zutreffend auf die in der Verfassung begründete staatliche Schutzpflicht ab. Dann aber meint es, Art. 1 I S. 2 GG i.V.m. Art. 2 II S. 1 GG verpflichteten den Staat, die Autonomie des Einzelnen bei der Entscheidung über die Beendigung seines Lebens und hierdurch das Leben als solches zu schützen (Rn. 232 der Entscheidung). Das ist widersprüchlich. Entweder muss der Staat die Entscheidungsautonomie schützen (und damit die Entscheidung über den eigenen Tod) oder das Leben, was die Entscheidung über den Tod ausschließt.
Auch die folgenden Ausführungen des BVerfG sind nicht kohärent. Das BVerfG stellt zwar zutreffend auf die in der Verfassung begründete staatliche Schutzpflicht ab. Dann aber meint es, Art. 1 I S. 2 GG i.V.m. Art. 2 II S. 1 GG verpflichteten den Staat, die Autonomie des Einzelnen bei der Entscheidung über die Beendigung seines Lebens und hierdurch das Leben als solches zu schützen (Rn. 232 der Entscheidung). Das ist widersprüchlich. Entweder muss der Staat die Entscheidungsautonomie schützen (und damit die Entscheidung über den eigenen Tod) oder das Leben, was die Entscheidung über den Tod ausschließt.
Stellt man richtigerweise allein auf die Pflicht des Staates ab, sich schützend vor das Leben zu stellen, hat dieser mit § 217 I StGB einen legitimen Zweck verfolgt, nämlich den Einzelnen vor einer möglicherweise übereilten, unüberlegten, unbegründeten und ggf. im Erwartungsdruck von außen veranlassten Suizidentscheidung zu bewahren. Zutreffend formuliert das BVerfG denn auch, dass die Vorschrift auch insoweit ein legitimes Anliegen verfolge, als sie verhindern wolle, dass sich der assistierte Suizid in der Gesellschaft als normale Form der Lebensbeendigung durchsetze (Rn. 233 der Entscheidung).
bb.)
§ 217 I StGB müsste auch geeignet sein. Geeignet
ist die gesetzliche Regelung, wenn mit ihrer Hilfe das angestrebte Ziel erreicht bzw. gefördert werden kann (vgl. nur BVerfGE 81, 156, 192 – Verunglimpfung der Nationalhymne; 96, 10, 21 – Räumliche Aufenthaltsbeschränkung); 115, 276, 308 – Sportwetten; 126, 112, 144 – Neuordnung des Rettungsdienstwesens; 134, 204, 226 – Werkverwertungsverträge; 141, 82, 100 – Partnerschaftsgesellschaft; BVerfG NVwZ 2017, 1111, 1123 – Spielhallen; BVerfG NJW 2018, 2109, 2111 – § 40 Ia LFGB; BVerfG NJW 2018, 2542, 2543 f. – Befristung von Arbeitsverträgen); BVerfG NJW 2019, 827, 830 – Automatisierte Kennzeichenerfassung).
Nach Auffassung des BVerfG stellt die Regelung des § 217 I StGB als Strafnorm grundsätzlich ein geeignetes Instrument des Rechtsgüterschutzes dar, weil das strafbewehrte Verbot gefahrträchtiger Handlungsweisen den erstrebten Rechtsgüterschutz zumindest fördern könne (Rn. 260 der Entscheidung). Das ist zutreffend, sofern man den „erstrebten Rechtsgüterschutz“ auf den Lebensschutz, nicht auf die Suizidentscheidung bezieht.
cc.)
Weiterhin müsste § 217 I StGB erforderlich
sein. Das wäre der Fall, wenn keine gleich wirksame, aber für den Grundrechtsträger weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker belastende Regelung zur Erreichung des Ziels zur Verfügung stünde (BVerfG NJW 2018, 2109, 2112 mit Verweis auf BVerfGE 113, 167, 259; 135, 90, 118; vgl. auch BVerfGE 30, 292, 316; 63, 88, 115; 77, 84, 109; 90, 145, 172; 100, 313, 375; 116, 202, 225; 145, 20, 80; BVerfG NJW 2019, 827, 830).
Das BVerfG hat die Frage, ob § 217 I StGB erforderlich ist, um die legitimen Schutzanliegen des Gesetzgebers zu erreichen, offengelassen, da die von der Vorschrift ausgehende Einschränkung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben jedenfalls nicht angemessen sei (Rn. 263 der Entscheidung). In einer studentischen Falllösung würde eine solche Vorgehensweise regelmäßig zur Beanstandung führen, da sie nicht methodengerecht ist. Denn sind Regelungen anderen Inhalts denkbar, die weniger intensiv die Grundrechte des Beschwerdeführers beeinträchtigen, jedoch ebenso das Ziel erreichen, ist die angegriffene Regelung gerade nicht erforderlich. Oder anders formuliert: Zu einer Angemessenheitsprüfung der angegriffenen Regelung gelangt man erst, wenn diese zuvor als jedenfalls erforderlich eingestuft wurde. Dies hätte das BVerfG durchaus auch im Rahmen der Erforderlichkeit prüfen können, denn bei Rn. 281 ff. der Entscheidung zeigt es andere in Betracht kommende (freilich nicht durchdringende) Möglichkeiten eines assistierten Suizids auf.
dd.)
Davon unbeschadet müsste § 217 I StGB aber jedenfalls angemessen sein. Angemessen
ist die gesetzliche Regelung, wenn der mit ihr verfolgte Zweck in seiner Wertigkeit nicht außer Verhältnis zur Intensität des Eingriffs steht (Verhältnismäßigkeit i.e.S.) (vgl. nur BVerfG NJW 2019, 1432, 1433 – Parteienfinanzierung; BVerfG NJW 2019, 827, 830 – Automatisierte Kennzeichenerfassung; BVerfG NJW 2019, 584, 585 – E-Mail-Anbieter muss IP-Adressen temporär speichern und den Strafverfolgungsbehörden nennen; BVerfGE 117, 163, 182 f. – Erfolgshonorar; 133, 277, 322 – Antiterrordateigesetz; BVerwG NJW 2018, 2067, 2070 (Dieselfahrverbot). In der vorliegenden Entscheidung verwendet das BVerfG eine abweichende Formulierung, wonach eine Freiheitseinschränkung (nur) dann angemessen sei, wenn das Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen stehe (Rn. 265 der Entscheidung). Ein Grund für diese Abweichung ist nicht ersichtlich und steht auch im Widerspruch zum zuvor selbst aufgestellten Prüfungsmaßstab, wonach das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung am Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen sei (Rn. 223 der Entscheidung). Ein „vernünftiges Verhältnis“ der widerstreitenden Rechtsgüter spiegelt sicherlich nicht das Erfordernis einer „strikten Verhältnismäßigkeit“ wider. Immerhin betont das BVerfG, dass die Entscheidung des Gesetzgebers einer hohen Kontrolldichte unterliege, wenn schwere Grundrechtseingriffe in Frage stehen. Die existentielle Bedeutung, die der Selbstbestimmung speziell für die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität im Umgang mit dem eigenen Leben zukomme, lege dem Gesetzgeber daher strenge Bindungen bei der normativen Ausgestaltung eines Schutzkonzepts im Zusammenhang mit der Suizidhilfe auf (Rn. 266 der Entscheidung). Das ist richtig, hat aber nichts mit einem „vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen“ zu tun. Ungeachtet dieser unüberlegt erscheinenden, sogar widersprüchlichen Eingangsformulierung ist die folgende Begründung aber sehr dezidiert und inhaltlich sehr überzeugend, wenn das BVerfG formuliert, dass die Straflosigkeit der Selbsttötung und der Hilfe dazu als Ausdruck der verfassungsrechtlich gebotenen Anerkennung individueller Selbstbestimmung nicht zur freien Disposition des Gesetzgebers stehe (Rn. 267 der Entscheidung) und der Verfassungsordnung des Grundgesetzes ein Menschenbild zugrunde liege, das von der Würde des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung bestimmt sei und Ausgangspunkt jedes regulatorischen Ansatzes zu sein habe (Rn. 274 der Entscheidung). Folgerichtig formuliert das BVerfG, dass die staatliche Schutzpflicht zugunsten der Selbstbestimmung und des Lebens erst dort gegenüber dem Freiheitsrecht des Einzelnen den Vorrang erhalten könne, wo dieser Einflüssen ausgeliefert sei, die die Selbstbestimmung über das eigene Leben gefährdeten (Rn. 275 der Entscheidung). Zwar dürfe der Gesetzgeber allgemeine Suizidprävention betreiben und insbesondere krankheitsbedingten Selbsttötungswünschen durch Ausbau und Stärkung palliativmedizinischer Behandlungsangebote entgegenwirken. Auch müsse er Faktoren entgegenwirken, die die freie Selbstbestimmung der Sterbewilligen beeinflussen können. Dieser sozialpolitischen Verpflichtung dürfe der Gesetzgeber sich aber nicht dadurch entziehen, dass er das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Selbstbestimmung außer Kraft setze. Dem Einzelnen müsse die Freiheit verbleiben, auf die Erhaltung des Lebens zielende Angebote auszuschlagen und eine seinem Verständnis von der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz entspringende Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe Dritter zu beenden, umzusetzen. Ein gegen die Autonomie gerichteter Lebensschutz widerspreche dem Selbstverständnis einer Gemeinschaft, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt der Werteordnung stehe und die sich damit zur Achtung und zum Schutz der freien menschlichen Persönlichkeit als oberstem Wert ihrer Verfassung verpflichte (Rn. 277 der Entscheidung).
Sodann nimmt das BVerfG Bezug zur Strafnorm des § 217 I StGB und stellt fest, dassdas Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötungden genannten verfassungsrechtlich zwingend zu wahrenden Entfaltungsraum autonomer Selbstbestimmung verletze. Die Regelung des § 217 I StGB erkenne die verfassungsrechtlich geforderte Straflosigkeit der Selbsttötung und der Beihilfe hierzu zwar grundsätzlich an, indem sie ausschließlich die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung als vom Gesetzgeber besonders autonomiegefährdend eingestuftes Phänomen einer Strafandrohung unterstelle (hier folgt der Verweis auf BT-Drs. 18/5373, S. 2). Das Verbot führe aber dazu, dass das Recht auf Selbsttötung in weiten Teilen faktisch entleert sei, weil die fortbestehende Straffreiheit nicht geschäftsmäßiger Suizidhilfe, der gesetzliche Ausbau von Angeboten der Palliativmedizin und des Hospizdienstes und die Verfügbarkeit von Suizidhilfeangeboten im Ausland nicht geeignet seien, die vom Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ausgehende Einschränkung grundrechtlicher Freiheit auszugleichen. Der Einzelne könne auf die Inanspruchnahme dieser Alternativen nicht ohne Verletzung seines Selbstbestimmungsrechts verwiesen werden (Rn. 278 der Entscheidung).
In der Folge zeigt das BVerfG andere in Betracht kommende (freilich nicht durchdringende) Möglichkeiten eines assistierten Suizids auf (die bei schulmäßig angewendeter Rechtsmethodik und auch in Übereinstimmung mit den sonstigen Prüfungsgrundsätzen des BVerfG korrekterweise bei der Erforderlichkeit hätten geprüft werden sollen). Ohne geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe sei der Einzelne maßgeblich auf die individuelle Bereitschaft eines Arztes angewiesen, an einer Selbsttötung zumindest durch Verschreibung der benötigten Wirkstoffe assistierend mitzuwirken. Von einer solchen individuellen ärztlichen Bereitschaft werde man bei realistischer Betrachtungsweise nur im Ausnahmefall ausgehen können. Ärzte zeigten bislang eine geringe Bereitschaft, Suizidhilfe zu leisten, und könnten hierzu auch nicht verpflichtet werden; aus dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben leite sich kein Anspruch gegenüber Dritten auf Suizidhilfe ab. Zudem setze das ärztliche Berufsrecht der Bereitschaft, Suizidhilfe zu leisten, weitere Grenzen. Die in den Berufsordnungen der meisten Landesärztekammern festgeschriebenen berufsrechtlichen Verbote ärztlicher Suizidhilfe unterstellten die Verwirklichung der Selbstbestimmung des Einzelnen nicht nur geografischen Zufälligkeiten, sondern wirkten zumindest faktisch handlungsleitend. Der Zugang zu Möglichkeiten der assistierten Selbsttötung dürfe aber nicht davon abhängen, dass Ärzte sich bereit zeigten, ihr Handeln nicht am geschriebenen Recht auszurichten, sondern sich unter Berufung auf ihre eigene verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit eigenmächtig darüber hinwegzusetzen. Solange diese Situation fortbestehe, schaffe sie einen tatsächlichen Bedarf nach geschäftsmäßigen Angeboten der Suizidhilfe. Auch Verbesserungen der palliativmedizinischen Patientenversorgung seien ebenso wenig geeignet, eine unverhältnismäßige Beschränkung der individuellen Selbstbestimmung auszugleichen. Sie mögen bestehende Defizite beseitigen und hierdurch geeignet sein, die Zahl darauf zurückzuführender Sterbewünsche todkranker Menschen zu reduzieren. Sie seien aber kein Korrektiv zur Beschränkung in freier Selbstbestimmung gefasster Selbsttötungsentschlüsse. Eine Pflicht zur Inanspruchnahme palliativmedizinischer Behandlung bestehe nicht. Die Entscheidung für die Beendigung des eigenen Lebens umfasse zugleich die Entscheidung gegen bestehende Alternativen und sei auch insoweit als Akt autonomer Selbstbestimmung zu akzeptieren.
Schließlich weist das BVerfG darauf hin, dass die Möglichkeit, Sterbehilfe im Ausland zu suchen, kein Argument für die Verfassungskonformität sein kann. Die staatliche Gemeinschaft dürfe den Einzelnen nicht auf die Möglichkeit verweisen, im Ausland Angebote der Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Der Staat müsse den erforderlichen Grundrechtsschutz gem. Art. 1 III GG innerhalb der eigenen Rechtsordnung gewährleisten (Rn. 300 der Entscheidung).
3. Vereinbarkeit des § 217 I StGB und der bisherigen Ergebnisse mit Art. 8 I EMRK
Der als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Grundrechte heranzuziehenden Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) und den vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) formulierten grundlegenden konventionsrechtlichen Wertungen wird das BVerfG dadurch gerecht, dass es schließlich prüft, ob sein bislang erarbeitetes Ergebnis dem Maßstab des Art. 8 I EMRK, wonach jede Person das Recht u.a. auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens hat, standhält (Rn. 304 der Entscheidung). Nach der Rechtsprechung des EGMR folge aus Art. 8 I EMRK das Recht, sein Leben selbstbestimmt nach individuellen Vorstellungen zu führen (hier erfolgt der Verweis auf EGMR, Urt. v. 29.4.2002, Nr. 2346/02, § 61). Des Weiteren habe der EGMR entschieden,dass
das Recht des Einzelnen, darüber zu entscheiden, wie und wann er sein
Leben beenden möchte, einen Aspekt des Rechts auf Achtung seines
Privatlebens nach Art. 8 EMRK darstelle, solange nur der Betroffene einen freien Willen bilden und danach
handeln könne (hier erfolgt der Verweis auf EGMR, Urt. v. 20.1.2011, Nr. 31322/07, § 51).
Ist danach der Schutzbereich des Art. 8 I EMRK eröffnet, prüft das BVerfG, ob die durch das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids vorgenommene Beschränkung des Schutzbereichs vom Schrankenvorbehalt des Art. 8 II EMRK gedeckt ist. Denn danach „darf eine Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer“. Das BVerfG verweist wiederum auf die Rechtsprechung des EGMR (Rn. 305 der Entscheidung). Dieser habe anerkannt, dass sich Einschränkungen nach Art. 8 II EMRK aus Gründen des Lebensschutzes Dritter ergeben können. Bei der Abwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen einerseits und der aus Art. 2 EMRK abgeleiteten Schutzpflicht des Staates für das Leben andererseits billige er den Vertragsstaaten in diesem sensiblen Bereich indes einen erheblichen Einschätzungs- und Ermessensspielraum zu (hier erfolgt der Verweis auf EGMR, Urt. v. 29.4.2002, Nr. 2346/02, §§ 70 f.; Urt. v. 20.1.2011, Nr. 31322/07, §§ 53, 55; Urt. v. 19.7.2012, Nr. 497/09, § 70). Danach sei es in erster Linie Aufgabe der Vertragsstaaten, die von einer Suizidhilfe ausgehenden Risiken und Missbrauchsgefahren zu bewerten (hier erfolgt wieder ein Verweis auf EGMR, Urt. v. 29.4.2002, Nr. 2346/02, § 74). Wähle ein Land eine liberale Regelung, seien geeignete Maßnahmen zur Umsetzung und zur Prävention erforderlich, die auch Missbrauch zu verhindern hätten (hier erfolgt ein Verweis auf EGMR, Urt. v. 20.1.2011, Nr. 31322/07, § 57). Werde die Entscheidung, sich selbst zu töten, nicht freien Willens und nicht bei vollem Verständnis der Umstände getroffen, verpflichte Art. 2 EMRK die staatlichen Behörden, die Selbsttötung zu verhindern. Das in Art. 2 EMRK garantierte Recht auf Leben verpflichte die Staaten, vulnerable Personen – auch gegen selbstgefährdende Handlungen – zu schützen und ein Verfahren zu etablieren, welches gewährleiste, dass die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, tatsächlich dem freien Willen des Betroffenen entspricht (hier erfolgt der Verweis auf EGMR, Urt. v. 20.1.2011, Nr. 31322/07, §§ 54, 58). Jedoch betone der EGMR aber auch, dass das Recht, selbst zu bestimmen, wann und auf welche Art das eigene Leben enden soll, nicht nur theoretisch oder scheinbar bestehen dürfe (hier erfolgt der Verweis auf EGMR, Urt. v. 20.1.2011, Nr. 31322/07, §§ 59 f.).
Eine Subsumtion seiner zu Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG erarbeiteten Ergebnisse unter diese vom EGMR aufgestellten Grundsätze nimmt das BVerfG nicht vor; allerdings dürfte klar geworden sein, dass die freiverantwortliche Entscheidung über den eigenen Tod vom Schutz des Art. 8 I EMRK umfasst ist und unter den Voraussetzungen des Art. 8 II EMRK (i.V.m. Art. 2 I EMRK) nur eingeschränkt werden kann, wenn die Entscheidung, sich selbst zu töten, nicht freien Willens und nicht bei vollem Verständnis der Umstände getroffen wird.
Aufbautechnisch sei angemerkt, dass das BVerfG die Vereinbarkeit des Verbots geschäftsmäßiger Sterbehilfe am Maßstab des Art. 8 I EMRK also nicht eigenständig prüft, sondern bei der Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes die Wertungen der EMRK und die Rechtsprechung des EGMR als Auslegungshilfe einfließen lässt, was rechtsmethodisch nicht zu beanstanden ist und vom Verfasser daher unter Punkt A. behandelt wurde.
B. Vereinbarkeit mit Art. 12 I GG auf Seiten der assistierenden Ärzte
und der beratenden Anwälte
Hinsichtlich der in Betracht kommenden Verletzung der Berufsfreiheit auf Seiten der assistierenden Ärzte und beratenden Anwälte deutscher Staatsangehörigkeit geht das BVerfG ohne Weiteres von der Eröffnung des Schutzbereichs aus, indem es in der geschäftsmäßig gewährten, verschafften oder vermittelten Gelegenheit zur Selbsttötung eine auf Dauer angelegte und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dienende Tätigkeit sieht (Rn. 310 der Entscheidung mit Verweis auf BVerfGE 7, 377, 397; 54, 301, 313; 102, 197, 212; 110, 304, 321; 126, 112, 136). In begrüßenswerter Weise stellt das BVerfG nunmehr klar, dass ein einfachgesetzliches Verbot (wie § 217 StGB) nicht in der Lage ist, den verfassungsrechtlichen Berufsbegriff zu definieren (Rn. 311 der Entscheidung). Denn in einigen Entscheidungen hatte das Gericht den Begriff des Berufs durch das einschränkende Merkmal der erlaubten Betätigung eingeengt (vgl. BVerfGE 7, 377, 397; 81, 70, 85; 102, 197, 213), was vom Verfasser schon immer kritisiert wurde mit dem Argument, dass es dadurch der einfache Gesetzgeber in der Hand habe, durch ein entsprechendes Verbotsgesetz den verfassungsrechtlichen Begriff des Berufs zu definieren und bestimmte Tätigkeiten einfach aus dem Schutzbereich von Art. 12 I GG auszuschließen. Denn Folge wäre, dass „einfachgesetzlich verbotene Tätigkeiten“ dem Maßstab von Art. 12 I GG entzogen würden, was methodisch – trotz des Umstands, dass Art. 12 I GG unter einem Regelungsvorbehalt (dazu R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 765) steht – nicht überzeugt, weil Beschränkungen eines grundrechtlichen Schutzbereichs nur durch Verfassungsinterpretation vorgenommen werden können (R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 771).
Auch greift laut BVerfG die Regelung des § 217 I StGB in die Berufsfreiheit von Ärzten und Rechtsanwälten mit deutscher Staatsangehörigkeit jedenfalls insoweit ein, als sie ihnen unter Strafandrohung untersagt, im Rahmen ihrer ärztlichen oder anwaltlichen Berufsausübung geschäftsmäßig Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren, zu verschaffen oder zu vermitteln.
Eine Prüfung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung findet im BVerfG-Urteil praktisch nicht statt. Das BVerfG geht in Rn. 331 der Entscheidung vielmehr davon aus, dass die zu Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG erarbeiteten Ergebnisse übertragbar sind. So heißt es in Rn. 331 der Entscheidung, das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verstoße aufgrund seiner Unvereinbarkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlossenen Personen gegen objektives Verfassungsrecht und sei infolgedessen auch gegenüber den unmittelbaren Normadressaten nichtig. Die als Ausprägung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben grundrechtlich geschützte Freiheit des Einzelnen, sich selbst mit Unterstützung und in Begleitung von zur Hilfe bereiten Dritten das Leben zu nehmen, stehe in inhaltlicher Abhängigkeit zu dem grundrechtlichen Schutz der Suizidhilfe. Die Entscheidung zur Selbsttötung sei in ihrer Umsetzung nicht nur in tatsächlicher Hinsicht davon abhängig, dass Dritte bereit sind, Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren, zu verschaffen oder zu vermitteln. Die Dritten müssten ihre Bereitschaft zur Suizidhilfe auch rechtlich umsetzen dürfen. Anderenfalls liefe das Recht des Einzelnen auf Selbsttötung faktisch leer. In Fällen derartiger rechtlicher Abhängigkeit stünden die Handlungsweisen der Beteiligten in einem funktionalen Zusammenhang. Der grundrechtliche Schutz des Handelns des einen sei Voraussetzung für die Ausübung eines Grundrechts durch den anderen (hier erfolgt der Verweis auf Kloepfer, in: Festschrift für Klaus Stern, 2012, S. 405, 413 ff.). Erst dadurch, dass zwei Personen Grundrechte in einer auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Weise ausüben könnten, hier die Umsetzung des Wunsches nach assistierter Selbsttötung, werde der verfassungsrechtliche Schutz auf selbstbestimmtes Sterben wirksam. Der Gewährleistung des Rechts auf Selbsttötung korrespondiere daher auch ein entsprechend weitreichender grundrechtlicher Schutz des Handelns des Suizidassistenten.
Bewertung:
Das mag zwar vorliegend im Ergebnis stimmen, da aber Art. 12 I GG grundrechtsspezifische Anforderungen an die Prüfung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung stellt, würde man in einer studentischen Fallbearbeitung bzw. Themenarbeit eine separate Prüfung am Maßstab des Art. 12 I GG vornehmen müssen. V.a. aber würde es wohl zur Beanstandung führen, wenn man schlicht formulierte, dass § 217 I StGB aufgrund seiner Unvereinbarkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlossenen Personen gegen objektives Verfassungsrecht verstoße und daher auch mit Art. 12 I GG unvereinbar wäre. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Verfassungsprinzip sich ergeben könnte, das Abwehrrecht des Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG sei „objektives Verfassungsrecht“. Denn als objektives Verfassungsrecht werden Staatsziele, Staatsorganisationsstrukturen (Kompetenzordnung; Verfahrensregelungen; Finanzverfassung, Wehrverfassung etc.) bezeichnet, nicht aber Grundrechte, auch nicht, wenn man ihnen eine objektive Wertordnung entnimmt.
C. Vereinbarkeit mit Art. 9 I GG auf Seiten der Sterbehilfevereine
Hinsichtlich der in Betracht kommenden Verletzung der Vereinigungsfreiheit auf Seiten der ein öffentliches Suizidhilfeangebot bereitstellenden Sterbehilfevereine geht das BVerfG zunächst davon aus, dass Art. 9 I GG auch ein kollektives Freiheitsrecht enthält (Grundrechtsträger sind dann also nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Vereinigung selbst – sog. Lehre vom „Doppelgrundrecht“). Inhaltlich garantiert es umfassend die Existenz und die Funktionsfähigkeit der Vereinigung, die Selbstbestimmung über die eigene Organisation, das Verfahren der Willensbildung und die Führung der Geschäfte (BVerfG NVwZ 2003, 855 – Schießsportverein; BVerfGE 50, 290, 354 – Mitbestimmung).
Einschränkend ist jedoch zu beachten, dass sich die Vereinigung jedenfalls dann nicht auf Art. 9 I GG berufen kann, wenn sich die Tätigkeit außerhalb des vereinsspezifischen Bereichs bewegt. Das BVerfG geht sogar noch weiter. Entgegen dem sonst von ihm vertretenen Standpunkt, grundrechtliche Schutzbereiche grundsätzlich weit auszulegen („in dubio pro libertate“ – dazu R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 118), verneint es hinsichtlich der kollektiven Vereinigungsfreiheit eine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung). Bei Verneinung des Art. 9 I GG ist die Vereinigung aber immerhin durch das betätigungsspezifische Grundrecht geschützt, allerdings nur, soweit es auf Personenmehrheiten anwendbar ist (Art. 19 III GG).
Ob aber das BVerfG bei Sterbehilfevereinen letztlich den Schutzbereich des Art. 9 I GG verneint mit dem Argument, Art. 9 I GG schütze hinsichtlich der kollektiven Vereinigungsfreiheit keine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung), ist unklar, da eine Subsumtion ausbleibt. Jedenfalls aber setzt das BVerfG seine Prüfung am Maßstab des Art. 9 II GG fort, was auf eine Eröffnung des Schutzbereichs schließen lässt. Aber auch dies lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, da das BVerfG in Bezug auf Sterbehilfevereine, die von der Strafnorm des § 217 I StGB betroffen waren, meint, dass das materielle Unwerturteil über strafrechtswidrige Zwecke verfolgende Vereinigungen aus Art. 9 II GG selbst folge und verfassungsunmittelbar wirke (Rn. 328 der Entscheidung). Das wird man als Hinweis auf eine verfassungsunmittelbare bzw. grundrechtsimmanente Grundrechtsschranke verstehen müssen, zumal das BVerfG formuliert, die Umsetzung des materiellen Unwerturteils setze lediglich die Existenz von Strafgesetzen voraus und die Ausgestaltung eines Vereinsverbots sei dem Gesetzgeber überantwortet, der die Grenzen der Schranke des Art. 9 II GG nicht ausdehnen dürfe (Rn. 328 der Entscheidung mit Verweis auf BVerfGE 80, 244, 254). Ist Aufgabe des Gesetzgebers also lediglich die Ausgestaltung eines Vereinsverbots, heißt das letztlich, dass das Verbot bei Verwirklichung eines Strafgesetzes (dazu R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 691) ipso jure eintritt und lediglich festgestellt werden muss. Für die Annahme einer verfassungsunmittelbaren bzw. grundrechtsimmanenten Grundrechtsschranke spricht schließlich der Umstand, dass das BVerfG von „Vereinsverbot nach Art. 9 II GG i.V.m. § 3 VereinsG“ (Rn. 327 der Entscheidung) spricht. Damit qualifiziert es Art. 9 II GG wohl als Eingriffsgrundlage und sieht die Vorschrift nicht als (bloßen) Gesetzesvorbehalt. Das ergibt sich auch aus einem Vergleich mit Art. 8 GG, dessen Abs. 2 unstreitig einen Gesetzesvorbehalt darstellt und der daher auch nicht vom BVerfG „i.V.“ mit bspw. § 15 I VersG genannt wird. Gleichgültig, welchen Standpunkt man aber letztlich vertritt, bedarf es im Fall einer Freiheitsverkürzung einer das Verbot ausgestaltenden formell-gesetzlichen Grundlage. Gerade aber eine auf Art. 9 I GG bezogene Freiheitsverkürzung scheint das BVerfG dann doch abzulehnen, indem es schließlich meint, die beschwerdeführenden deutschen Vereine seien in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) betroffen (und verletzt), da sie gezwungen (gewesen) seien, ihre auf Erbringung oder Vermittlung von Suizidhilfe gerichteten Aktivitäten (vorläufig) einzustellen, um nicht mit den Maßgaben des § 217 I StGB in Konflikt zu treten.
Bewertung: Das hätte man auch einfacher haben können, indem man schlicht den Schutzbereich des Art. 9 I GG verneint hätte mit dem Argument, dieses Grundrecht garantiere zwar umfassend die Existenz und die Funktionsfähigkeit der Vereinigung, die Selbstbestimmung über die eigene Organisation, das Verfahren der Willensbildung und die Führung der Geschäfte, nicht aber eine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung), um die es vorliegend lediglich gehe.
Hinsichtlich der in Betracht kommenden Verletzung der Vereinigungsfreiheit auf Seiten der ein öffentliches Suizidhilfeangebot bereitstellenden Sterbehilfevereine geht das BVerfG zunächst davon aus, dass Art. 9 I GG auch ein kollektives Freiheitsrecht enthält (Grundrechtsträger sind dann also nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Vereinigung selbst – sog. Lehre vom „Doppelgrundrecht“). Inhaltlich garantiert es umfassend die Existenz und die Funktionsfähigkeit der Vereinigung, die Selbstbestimmung über die eigene Organisation, das Verfahren der Willensbildung und die Führung der Geschäfte (BVerfG NVwZ 2003, 855 – Schießsportverein; BVerfGE 50, 290, 354 – Mitbestimmung).
Einschränkend ist jedoch zu beachten, dass sich die Vereinigung jedenfalls dann nicht auf Art. 9 I GG berufen kann, wenn sich die Tätigkeit außerhalb des vereinsspezifischen Bereichs bewegt. Das BVerfG geht sogar noch weiter. Entgegen dem sonst von ihm vertretenen Standpunkt, grundrechtliche Schutzbereiche grundsätzlich weit auszulegen („in dubio pro libertate“ – dazu R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 118), verneint es hinsichtlich der kollektiven Vereinigungsfreiheit eine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung). Bei Verneinung des Art. 9 I GG ist die Vereinigung aber immerhin durch das betätigungsspezifische Grundrecht geschützt, allerdings nur, soweit es auf Personenmehrheiten anwendbar ist (Art. 19 III GG).
Ob aber das BVerfG bei Sterbehilfevereinen letztlich den Schutzbereich des Art. 9 I GG verneint mit dem Argument, Art. 9 I GG schütze hinsichtlich der kollektiven Vereinigungsfreiheit keine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung), ist unklar, da eine Subsumtion ausbleibt. Jedenfalls aber setzt das BVerfG seine Prüfung am Maßstab des Art. 9 II GG fort, was auf eine Eröffnung des Schutzbereichs schließen lässt. Aber auch dies lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, da das BVerfG in Bezug auf Sterbehilfevereine, die von der Strafnorm des § 217 I StGB betroffen waren, meint, dass das materielle Unwerturteil über strafrechtswidrige Zwecke verfolgende Vereinigungen aus Art. 9 II GG selbst folge und verfassungsunmittelbar wirke (Rn. 328 der Entscheidung). Das wird man als Hinweis auf eine verfassungsunmittelbare bzw. grundrechtsimmanente Grundrechtsschranke verstehen müssen, zumal das BVerfG formuliert, die Umsetzung des materiellen Unwerturteils setze lediglich die Existenz von Strafgesetzen voraus und die Ausgestaltung eines Vereinsverbots sei dem Gesetzgeber überantwortet, der die Grenzen der Schranke des Art. 9 II GG nicht ausdehnen dürfe (Rn. 328 der Entscheidung mit Verweis auf BVerfGE 80, 244, 254). Ist Aufgabe des Gesetzgebers also lediglich die Ausgestaltung eines Vereinsverbots, heißt das letztlich, dass das Verbot bei Verwirklichung eines Strafgesetzes (dazu R. Schmidt, Grundrechte, 24. Aufl. 2019, Rn. 691) ipso jure eintritt und lediglich festgestellt werden muss. Für die Annahme einer verfassungsunmittelbaren bzw. grundrechtsimmanenten Grundrechtsschranke spricht schließlich der Umstand, dass das BVerfG von „Vereinsverbot nach Art. 9 II GG i.V.m. § 3 VereinsG“ (Rn. 327 der Entscheidung) spricht. Damit qualifiziert es Art. 9 II GG wohl als Eingriffsgrundlage und sieht die Vorschrift nicht als (bloßen) Gesetzesvorbehalt. Das ergibt sich auch aus einem Vergleich mit Art. 8 GG, dessen Abs. 2 unstreitig einen Gesetzesvorbehalt darstellt und der daher auch nicht vom BVerfG „i.V.“ mit bspw. § 15 I VersG genannt wird. Gleichgültig, welchen Standpunkt man aber letztlich vertritt, bedarf es im Fall einer Freiheitsverkürzung einer das Verbot ausgestaltenden formell-gesetzlichen Grundlage. Gerade aber eine auf Art. 9 I GG bezogene Freiheitsverkürzung scheint das BVerfG dann doch abzulehnen, indem es schließlich meint, die beschwerdeführenden deutschen Vereine seien in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) betroffen (und verletzt), da sie gezwungen (gewesen) seien, ihre auf Erbringung oder Vermittlung von Suizidhilfe gerichteten Aktivitäten (vorläufig) einzustellen, um nicht mit den Maßgaben des § 217 I StGB in Konflikt zu treten.
Bewertung: Das hätte man auch einfacher haben können, indem man schlicht den Schutzbereich des Art. 9 I GG verneint hätte mit dem Argument, dieses Grundrecht garantiere zwar umfassend die Existenz und die Funktionsfähigkeit der Vereinigung, die Selbstbestimmung über die eigene Organisation, das Verfahren der Willensbildung und die Führung der Geschäfte, nicht aber eine allgemeine Handlungs- oder Zweckverfolgungsfreiheit (Rn. 326 der Entscheidung), um die es vorliegend lediglich gehe.
D. Schlussbetrachtung
Das Urteil weist einige rechtsmethodische Schwächen auf: So stellt das BVerfG bei der Prüfung am Maßstab des Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG zunächst einen strengen Prüfungsmaßstab auf, indem es formuliert: „Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist am Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen“, lässt es dann aber genügen, wenn das grundrechtseinschränkende Gesetz „geeignet und erforderlich ist, um die von ihm verfolgten legitimen Zwecke zu erreichen, und die Einschränkungen des jeweiligen grundrechtlichen Freiheitsraums hierzu in angemessenem Verhältnis stehen“ (Rn. 223 der Entscheidung). Wenn es zudem sodann dem Gesetzgeber einen Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsraum zuspricht (Rn. 224 der Entscheidung), stellt sich die Frage, worin dann der „Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit“ bestehen soll. „Strikte Verhältnismäßigkeit“ auf der einen Seite und „angemessenes Verhältnis“ sowie „Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsraum“ auf der anderen Seite passen nicht zueinander. Auf diese Weise wird der Prüfungsmaßstab verwässert. Auch überzeugt die Formulierung, dass § 217 I StGB aufgrund seiner Unvereinbarkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlossenen Personen gegen objektives Verfassungsrecht verstoße, nicht, wenn das „objektive Verfassungsrecht“, gegen das verstoßen worden sein soll, nicht benannt wird. Schließlich ist die Prüfung am Maßstab des Art. 9 I GG verworren und unklar, weil sie grundrechtsdogmatische Fragen bzgl. des Art. 9 II GG aufwirft, jedoch nicht beantwortet, keine Subsumtionen durchführt, dann aber im Ergebnis schlicht auf Art. 2 I GG abstellt.
Die Entscheidung bedeutet zudem nicht, dass der assistierte Suizid nunmehr schrankenlos möglich wäre. Sie bedeutet zunächst (nur), dass § 217 I StGB (in der gegenwärtigen Fassung) verfassungswidrig und nichtig ist. Der assistierte Suizid ist rechtlich also jenseits des (für nichtig erklärten) § 217 StGB zu behandeln. Gleichwohl dürfte das vom BVerfG stark betonte Selbstbestimmungsrecht aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG eine andere rechtliche Betrachtung erforderlich machen, als dies vor Inkrafttreten des § 217 StGB der Fall war. Auch wird der paternalistische Staat bei einer zu erwartenden Neuregelung des § 217 StGB dem Selbstbestimmungsrecht eine stärkere Bedeutung beimessen müssen.
Freilich nützen die gesetzgeberischen Erleichterungen den Sterbewilligen in der Praxis nichts, wenn ihnen aus berufsrechtlichen Gründen keine ärztliche Suizidhilfe angeboten wird. Sollten die Landesärztekammern an ihrer restriktiven Haltung festhalten und den kammerangehörigen Ärzten bei Zuwiderhandlungen/Verstößen gegen die standesrechtlichen Regeln und Grundsätze mit berufsrechtlichen Sanktionen bis hin zur Entziehung der Approbation drohen, dürfte Sterbewilligen auch künftig ärztlich assistierte Sterbehilfe regelmäßig nicht zur Verfügung stehen, zumal auch die Entscheidung des BVerfG ja kein Recht auf assistierten Suizid gewährt, sondern lediglich das Verbot aufgehoben hat. Lediglich Sterbehilfevereine dürften durch die BVerfG-Entscheidung „Aufwind“ erhalten haben und dürfen ihre Tätigkeit nunmehr (freilich lediglich im Rahmen strafloser Beihilfe zu einem eigenverantwortlichen Suizid) fortsetzen.
Rolf Schmidt
(27.02.2020)
04.01.2020: Fahrlässige Brandstiftung durch Himmelslaterne und (un-)vermeidbarer Verbotsirrtum?
Neujahr 2020 verbreitete sich schnell die Schreckensnachricht, dass ein Feuer im Krefelder Zoo ausgebrochen sei, das zur völligen Zerstörung eines Tiergeheges und zum Tod von über 30 Affen geführt habe. Rasch wurde auch die (vermeintliche) Brandursache bekannt: Eine der brennenden Himmelslaternen, die eine 60-jährige Frau und ihre beiden erwachsenen Töchter haben aufsteigen lassen, soll den Brand verursacht haben. Im Folgenden sollen die strafrechtliche und die zivilrechtliche Seite untersucht werden. Es wird von folgendem Sachverhalt ausgegangen:
Sachverhalt: M kaufte für sich und ihre beiden erwachsenen Töchter vor Silvester im Internet sog. Himmelslaternen. Dabei handelt es sich um sehr leichte Papierlaternen, an deren Sockel eine Baumwollkerze und ggf. Grußlabels angebracht sind, um Glückwünsche niederzuschreiben. Durch die Hitze, die durch die brennende Kerze entsteht, erwärmt sich das Innere der Laterne, wodurch diese aufsteigt und vom Wind davongetragen wird. Die Brenndauer der Kerze beträgt bis zu 20 Minuten. Zu Neujahrsbeginn um 0.00 Uhr ließen die Frauen einige Himmelslaternen aufsteigen. Leider aber verfing sich eine der Laternen in der Dachkonstruktion eines Geheges des nahegelegenen Zoos, wodurch dieses vollständig niederbrannte. Neben dem immens hohen Sachschaden, der verursacht wurde, fanden über 30 Affen den Tod. Die Täterinnen, die sich alsbald der Polizei stellten, gaben im Rahmen der polizeilichen Vernehmung an, ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass der Einsatz von Himmelslaternen verboten sei. Ein Hinweis des Verkäufers habe gefehlt, sodass sie davon ausgegangen seien, der Einsatz der Papierlaternen sei nicht verboten. Es tue ihnen unendlich leid, was geschehen sei.
A. Strafbarkeit wegen fahrlässiger Brandstiftung:
Vorüberlegung: Da in Ermangelung eines gemeinsamen Tatentschlusses (siehe § 25 II StGB) eine mittäterschaftliche Brandstiftung ausscheidet und daher nur eine Einzeltäterschaft in Betracht kommt, müsste in der Praxis nachgewiesen werden, wer von den Frauen die betreffende Himmelslaterne hat aufsteigen lassen. Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, müssten alle nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ freigesprochen werden. Die Figur der „fahrlässigen Mittäterschaft“ (siehe dazu R. Schmidt, Strafrecht Allgemeiner Teil, 21. Aufl. 2019, Rn. 1020 ff.), die Strafbarkeitslücken schließen möchte, die dadurch entstehen, dass nicht festgestellt werden kann, wessen Verhalten letztlich den Taterfolg herbeigeführt hat, wird aber nun einmal der gesetzlichen Wertung des § 25 II StGB nicht gerecht. In Betracht kommt daher lediglich eine Alleintäterschaft unter dem Aspekt einer Fahrlässigkeitstat. Kann die Kausalität nicht geklärt werden, sind alle 3 Frauen freizusprechen, wenn man sich nicht der „fahrlässigen Mittäterschaft“ anschließt.
Lösungsgesichtspunkte: Die Frau, die die betreffende Himmelslaterne hat aufsteigen lassen, könnte sich wegen fahrlässiger Brandstiftung gem. § 306d I Halbs. 1 Var. 1 StGB strafbar gemacht haben. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer in den Fällen des § 306 I StGB fahrlässig handelt. § 306 I StGB wiederum stellt das Inbrandsetzen und das durch eine Brandlegung ganz oder teilweise Zerstören eines der in der Vorschrift genannten Tatobjekte unter Strafe. Tatobjekte sind fremde
Die getöteten Affen sind nicht als taugliche Tatobjekte erfasst. Das mag (auf den ersten Blick) zwar bedauerlich wirken, ist jedoch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die §§ 306 ff. StGB gemeingefährliche Straftaten regeln. Bei diesen geht es um die strafrechtliche Sanktionierung von Verhaltensweisen, die nach Auffassung des Gesetzgebers das Leben und die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen zumindest gefährden oder Sachen von bedeutendem Wert (str.) zerstören können. Affen sind (wie alle Tiere) zwar keine Sachen (siehe § 90a S. 1 BGB), jedoch gelten die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auch für Tiere (§ 90a S. 3 BGB). Die Affen waren (nach der Terminologie des Sachenrechts) wohl von bedeutendem Wert, jedoch eben nicht vom Kanon des § 306 StGB erfasst.
Die Verursacherin müsste das Gehege fahrlässig in Brand gesetzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört haben. In Brand gesetzt ist ein Tatobjekt, wenn zumindest ein funktionswesentlicher Bestandteil des Objekts so vom Feuer erfasst wird, dass das Feuer aus eigener Kraft, d.h. ohne Fortwirken des Zündstoffes, selbstständig weiterbrennen kann (BGH NStZ 2014, 404 f.; BGHSt 16, 109, 110; 18, 363, 364 ff.; 34, 115, 117; 36, 221, 222; 48, 14, 18; Lackner/Kühl-Heger, § 306 StGB Rn. 3; Fischer, § 306 StGB Rn. 14; Sch/Sch-Heine/Bosch, § 306 StGB Rn. 13; MüKo-Radtke, § 306 StGB Rn. 51; Schenkewitz, JA 2001, 400, 401; Müller/Hönig, JA 2001, 517, 518; vgl. auch BGH NStZ 2008, 99 f.). Das war vorliegend der Fall: Durch das Verheddern der einen brennenden Himmelslaterne in der Dachkonstruktion des Geheges konnte das Feuer übergreifen und das gesamte Gehege erfassen. Dieses wurde damit in Brand gesetzt.
Dies müsste auch fahrlässig geschehen sein. Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Täter objektiv sorgfaltswidrig gehandelt, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat (allgemeine Auffassung). Sofern bestimmte Verhaltensnormen bestehen, durch deren Nichtbeachtung der Taterfolg eingetreten ist, bereitet die Feststellung der objektiven Sorgfaltspflicht i.d.R. keine größeren Schwierigkeiten. Im vorliegenden Zusammenhang ist zunächst die Regelung des § 19 I Nr. 2b) LuftVO zu beachten. Danach ist in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen der Aufstieg von ballonartigen Leuchtkörpern, insbesondere von Flug- oder Himmelslaternen, während der Betriebszeit des Flugplatzes verboten. Zwar befand sich (unterstelltermaßen) kein Flugplatz in der genannten Entfernung, jedoch lässt § 19 III LuftVO landesrechtliche Regelungen, die Aufstiege von ballonartigen Leuchtkörpern verbieten, unberührt. Unterstellt, dass eine landesrechtliche Verbotsnorm existiert, hätte die Täterin dagegen verstoßen und damit objektiv fahrlässig gehandelt. Aber auch ohne ein solches Verbot war es selbstverständlich fahrlässig, im Bebauungszusammenhang und insbesondere in der Nähe eines offenen Tiergeheges, in dem sich naturgemäß Heu und Stroh befinden, brennende Himmelslaternen steigen zu lassen.
Der Taterfolg war objektiv zurechenbar, weil sich gerade das rechtlich missbilligte Verhalten der Täterin in tatbestandsspezifischer Weise in dem konkreten Erfolg niedergeschlagen hat. Auch waren der wesentliche Kausalverlauf und der Erfolgseintritt objektiv vorhersehbar. Denn sie standen nicht so sehr außerhalb der Lebenserfahrung, dass man mit ihnen nicht rechnen brauchte.
Allein die objektive Sorgfaltspflichtverletzung, die objektive Zurechnung des Erfolgseintritts und die objektive Vorhersehbarkeit des wesentlichen Kausalverlaufs und des Erfolgseintritts genügen jedoch noch nicht. Es bedarf auch der Feststellung des Fahrlässigkeitsschuldvorwurfs. Dieser wird v.a. durch die Feststellung begründet, dass der Täter nach seinen persönlichen Fähigkeiten und dem Maß seines individuellen Könnens in der Lage gewesen ist, die objektive Sorgfaltspflicht einzuhalten und den drohenden Schaden zu erkennen. Diese Fähigkeit ist regelmäßig anzunehmen, kann aber bei physischen oder psychischen Mängeln (geringe Intelligenz, Bildung, Geschicklichkeit, Befähigung etc.) durchaus fehlen. Geht man bei der Täterin nicht von derartigen Mängeln aus, hat diese auch subjektiv fahrlässig gehandelt.
Jedoch könnte die persönliche Vorwerfbarkeit i.S. eines Unrechtsbewusstseins gefehlt haben. Nach der in § 17 StGB verankerten Schuldtheorie, die das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit als ein vom (Tatbestands-)Vorsatz getrenntes selbstständiges Schuldelement begreift, bestimmt das Unrechtsbewusstsein entscheidend die Schuld. So handelt nach § 17 S. 1 StGB der Täter, dem bei Begehung der Tat die Einsicht fehlt, Unrecht zu tun, ohne Schuld, wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte; anderenfalls (bei Vermeidbarkeit des Irrtums) kann die Strafe lediglich gemildert werden (§ 17 S. 2 i.V.m. § 49 I StGB). An die Unvermeidbarkeit stellt der BGH hohe Anforderungen. Ein Verbotsirrtum i.S.v. § 17 S. 1 StGB sei (nur dann) unvermeidbar, „wenn der Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falls, seiner Persönlichkeit sowie seines Lebens- und Berufskreises zuzumutenden Anspannung des Gewissens die Einsicht in das Unrechtmäßige nicht zu gewinnen vermochte“. Im Zweifel treffe ihn eine Erkundigungspflicht (BGH NJW 2017, 2463, 2464 m.w.N.). Etwa aufkommende Zweifel seien erforderlichenfalls durch verlässliche und sachkundige Auskunft auszuräumen (BGH NJW 2017, 2463, 2464).
M, aber auch ihren beiden erwachsenen Töchtern, wäre sicherlich möglich gewesen, sich im Internet über die Verwendung von Himmelslaternen zu informieren, zumal M die Himmelslaternen ja auch im Internet kaufte und daher einigermaßen vertraut mit dem Medium Internet gewesen sein muss. Jedenfalls aber sollte es jedem erwachsenen Menschen klar sein, dass das Aufsteigenlassen von brennenden Laternen in Siedlungsgebieten sowie in der Nähe von Stallungen und Tiergehegen eine Brandgefahr in sich birgt, zumal man mit dem Loslassen der Laternen ja jegliche Kontrolle verliert. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, wie die drei Frauen davon ausgehen konnten, ihr Handeln sei ungefährlich.
Sollte bei der Täterin dennoch die Einsicht gefehlt haben, Unrecht zu tun, so war dieser Irrtum aber jedenfalls vermeidbar. Ihre Strafe wäre dann gem. § 17 S. 2 i.V.m. § 49 I StGB zu mildern. Nach § 49 I Nr. 2 S. 1 StGB darf hinsichtlich des in § 306d I StGB angedrohten Strafmaßes von bis zu 5 Jahren daher höchstens auf drei Viertel erkannt werden. Bei Geldstrafe gilt gem. § 49 I Nr. 2 S. 2 StGB dasselbe für die Höchstzahl der Tagessätze. Nimmt man also (entgegen dem hier vertretenen Standpunkt!) einen vermeidbaren Verbotsirrtum an, ist angesichts des Umstands, dass sich die drei Frauen alsbald nach der Tat der Polizei stellten, obwohl eine Entdeckung nicht sehr wahrscheinlich erschien, und sie ihre Tat zutiefst bereuen, mit einer Bewährungsstrafe (die gem. § 56 II StGB bis zu 2 Jahren möglich ist) jedenfalls dann zu rechnen, wenn § 46 StGB keine Vollstreckung der Strafe fordert.
Neujahr 2020 verbreitete sich schnell die Schreckensnachricht, dass ein Feuer im Krefelder Zoo ausgebrochen sei, das zur völligen Zerstörung eines Tiergeheges und zum Tod von über 30 Affen geführt habe. Rasch wurde auch die (vermeintliche) Brandursache bekannt: Eine der brennenden Himmelslaternen, die eine 60-jährige Frau und ihre beiden erwachsenen Töchter haben aufsteigen lassen, soll den Brand verursacht haben. Im Folgenden sollen die strafrechtliche und die zivilrechtliche Seite untersucht werden. Es wird von folgendem Sachverhalt ausgegangen:
Sachverhalt: M kaufte für sich und ihre beiden erwachsenen Töchter vor Silvester im Internet sog. Himmelslaternen. Dabei handelt es sich um sehr leichte Papierlaternen, an deren Sockel eine Baumwollkerze und ggf. Grußlabels angebracht sind, um Glückwünsche niederzuschreiben. Durch die Hitze, die durch die brennende Kerze entsteht, erwärmt sich das Innere der Laterne, wodurch diese aufsteigt und vom Wind davongetragen wird. Die Brenndauer der Kerze beträgt bis zu 20 Minuten. Zu Neujahrsbeginn um 0.00 Uhr ließen die Frauen einige Himmelslaternen aufsteigen. Leider aber verfing sich eine der Laternen in der Dachkonstruktion eines Geheges des nahegelegenen Zoos, wodurch dieses vollständig niederbrannte. Neben dem immens hohen Sachschaden, der verursacht wurde, fanden über 30 Affen den Tod. Die Täterinnen, die sich alsbald der Polizei stellten, gaben im Rahmen der polizeilichen Vernehmung an, ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass der Einsatz von Himmelslaternen verboten sei. Ein Hinweis des Verkäufers habe gefehlt, sodass sie davon ausgegangen seien, der Einsatz der Papierlaternen sei nicht verboten. Es tue ihnen unendlich leid, was geschehen sei.
A. Strafbarkeit wegen fahrlässiger Brandstiftung:
Vorüberlegung: Da in Ermangelung eines gemeinsamen Tatentschlusses (siehe § 25 II StGB) eine mittäterschaftliche Brandstiftung ausscheidet und daher nur eine Einzeltäterschaft in Betracht kommt, müsste in der Praxis nachgewiesen werden, wer von den Frauen die betreffende Himmelslaterne hat aufsteigen lassen. Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, müssten alle nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ freigesprochen werden. Die Figur der „fahrlässigen Mittäterschaft“ (siehe dazu R. Schmidt, Strafrecht Allgemeiner Teil, 21. Aufl. 2019, Rn. 1020 ff.), die Strafbarkeitslücken schließen möchte, die dadurch entstehen, dass nicht festgestellt werden kann, wessen Verhalten letztlich den Taterfolg herbeigeführt hat, wird aber nun einmal der gesetzlichen Wertung des § 25 II StGB nicht gerecht. In Betracht kommt daher lediglich eine Alleintäterschaft unter dem Aspekt einer Fahrlässigkeitstat. Kann die Kausalität nicht geklärt werden, sind alle 3 Frauen freizusprechen, wenn man sich nicht der „fahrlässigen Mittäterschaft“ anschließt.
Lösungsgesichtspunkte: Die Frau, die die betreffende Himmelslaterne hat aufsteigen lassen, könnte sich wegen fahrlässiger Brandstiftung gem. § 306d I Halbs. 1 Var. 1 StGB strafbar gemacht haben. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer in den Fällen des § 306 I StGB fahrlässig handelt. § 306 I StGB wiederum stellt das Inbrandsetzen und das durch eine Brandlegung ganz oder teilweise Zerstören eines der in der Vorschrift genannten Tatobjekte unter Strafe. Tatobjekte sind fremde
- Gebäude oder Hütten,
- Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen,
- Warenlager oder -vorräte,
- Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge,
- Wälder, Heiden oder Moore,
- land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse.
Die getöteten Affen sind nicht als taugliche Tatobjekte erfasst. Das mag (auf den ersten Blick) zwar bedauerlich wirken, ist jedoch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die §§ 306 ff. StGB gemeingefährliche Straftaten regeln. Bei diesen geht es um die strafrechtliche Sanktionierung von Verhaltensweisen, die nach Auffassung des Gesetzgebers das Leben und die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen zumindest gefährden oder Sachen von bedeutendem Wert (str.) zerstören können. Affen sind (wie alle Tiere) zwar keine Sachen (siehe § 90a S. 1 BGB), jedoch gelten die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auch für Tiere (§ 90a S. 3 BGB). Die Affen waren (nach der Terminologie des Sachenrechts) wohl von bedeutendem Wert, jedoch eben nicht vom Kanon des § 306 StGB erfasst.
Die Verursacherin müsste das Gehege fahrlässig in Brand gesetzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört haben. In Brand gesetzt ist ein Tatobjekt, wenn zumindest ein funktionswesentlicher Bestandteil des Objekts so vom Feuer erfasst wird, dass das Feuer aus eigener Kraft, d.h. ohne Fortwirken des Zündstoffes, selbstständig weiterbrennen kann (BGH NStZ 2014, 404 f.; BGHSt 16, 109, 110; 18, 363, 364 ff.; 34, 115, 117; 36, 221, 222; 48, 14, 18; Lackner/Kühl-Heger, § 306 StGB Rn. 3; Fischer, § 306 StGB Rn. 14; Sch/Sch-Heine/Bosch, § 306 StGB Rn. 13; MüKo-Radtke, § 306 StGB Rn. 51; Schenkewitz, JA 2001, 400, 401; Müller/Hönig, JA 2001, 517, 518; vgl. auch BGH NStZ 2008, 99 f.). Das war vorliegend der Fall: Durch das Verheddern der einen brennenden Himmelslaterne in der Dachkonstruktion des Geheges konnte das Feuer übergreifen und das gesamte Gehege erfassen. Dieses wurde damit in Brand gesetzt.
Dies müsste auch fahrlässig geschehen sein. Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Täter objektiv sorgfaltswidrig gehandelt, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat (allgemeine Auffassung). Sofern bestimmte Verhaltensnormen bestehen, durch deren Nichtbeachtung der Taterfolg eingetreten ist, bereitet die Feststellung der objektiven Sorgfaltspflicht i.d.R. keine größeren Schwierigkeiten. Im vorliegenden Zusammenhang ist zunächst die Regelung des § 19 I Nr. 2b) LuftVO zu beachten. Danach ist in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen der Aufstieg von ballonartigen Leuchtkörpern, insbesondere von Flug- oder Himmelslaternen, während der Betriebszeit des Flugplatzes verboten. Zwar befand sich (unterstelltermaßen) kein Flugplatz in der genannten Entfernung, jedoch lässt § 19 III LuftVO landesrechtliche Regelungen, die Aufstiege von ballonartigen Leuchtkörpern verbieten, unberührt. Unterstellt, dass eine landesrechtliche Verbotsnorm existiert, hätte die Täterin dagegen verstoßen und damit objektiv fahrlässig gehandelt. Aber auch ohne ein solches Verbot war es selbstverständlich fahrlässig, im Bebauungszusammenhang und insbesondere in der Nähe eines offenen Tiergeheges, in dem sich naturgemäß Heu und Stroh befinden, brennende Himmelslaternen steigen zu lassen.
Der Taterfolg war objektiv zurechenbar, weil sich gerade das rechtlich missbilligte Verhalten der Täterin in tatbestandsspezifischer Weise in dem konkreten Erfolg niedergeschlagen hat. Auch waren der wesentliche Kausalverlauf und der Erfolgseintritt objektiv vorhersehbar. Denn sie standen nicht so sehr außerhalb der Lebenserfahrung, dass man mit ihnen nicht rechnen brauchte.
Allein die objektive Sorgfaltspflichtverletzung, die objektive Zurechnung des Erfolgseintritts und die objektive Vorhersehbarkeit des wesentlichen Kausalverlaufs und des Erfolgseintritts genügen jedoch noch nicht. Es bedarf auch der Feststellung des Fahrlässigkeitsschuldvorwurfs. Dieser wird v.a. durch die Feststellung begründet, dass der Täter nach seinen persönlichen Fähigkeiten und dem Maß seines individuellen Könnens in der Lage gewesen ist, die objektive Sorgfaltspflicht einzuhalten und den drohenden Schaden zu erkennen. Diese Fähigkeit ist regelmäßig anzunehmen, kann aber bei physischen oder psychischen Mängeln (geringe Intelligenz, Bildung, Geschicklichkeit, Befähigung etc.) durchaus fehlen. Geht man bei der Täterin nicht von derartigen Mängeln aus, hat diese auch subjektiv fahrlässig gehandelt.
Jedoch könnte die persönliche Vorwerfbarkeit i.S. eines Unrechtsbewusstseins gefehlt haben. Nach der in § 17 StGB verankerten Schuldtheorie, die das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit als ein vom (Tatbestands-)Vorsatz getrenntes selbstständiges Schuldelement begreift, bestimmt das Unrechtsbewusstsein entscheidend die Schuld. So handelt nach § 17 S. 1 StGB der Täter, dem bei Begehung der Tat die Einsicht fehlt, Unrecht zu tun, ohne Schuld, wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte; anderenfalls (bei Vermeidbarkeit des Irrtums) kann die Strafe lediglich gemildert werden (§ 17 S. 2 i.V.m. § 49 I StGB). An die Unvermeidbarkeit stellt der BGH hohe Anforderungen. Ein Verbotsirrtum i.S.v. § 17 S. 1 StGB sei (nur dann) unvermeidbar, „wenn der Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falls, seiner Persönlichkeit sowie seines Lebens- und Berufskreises zuzumutenden Anspannung des Gewissens die Einsicht in das Unrechtmäßige nicht zu gewinnen vermochte“. Im Zweifel treffe ihn eine Erkundigungspflicht (BGH NJW 2017, 2463, 2464 m.w.N.). Etwa aufkommende Zweifel seien erforderlichenfalls durch verlässliche und sachkundige Auskunft auszuräumen (BGH NJW 2017, 2463, 2464).
M, aber auch ihren beiden erwachsenen Töchtern, wäre sicherlich möglich gewesen, sich im Internet über die Verwendung von Himmelslaternen zu informieren, zumal M die Himmelslaternen ja auch im Internet kaufte und daher einigermaßen vertraut mit dem Medium Internet gewesen sein muss. Jedenfalls aber sollte es jedem erwachsenen Menschen klar sein, dass das Aufsteigenlassen von brennenden Laternen in Siedlungsgebieten sowie in der Nähe von Stallungen und Tiergehegen eine Brandgefahr in sich birgt, zumal man mit dem Loslassen der Laternen ja jegliche Kontrolle verliert. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, wie die drei Frauen davon ausgehen konnten, ihr Handeln sei ungefährlich.
Sollte bei der Täterin dennoch die Einsicht gefehlt haben, Unrecht zu tun, so war dieser Irrtum aber jedenfalls vermeidbar. Ihre Strafe wäre dann gem. § 17 S. 2 i.V.m. § 49 I StGB zu mildern. Nach § 49 I Nr. 2 S. 1 StGB darf hinsichtlich des in § 306d I StGB angedrohten Strafmaßes von bis zu 5 Jahren daher höchstens auf drei Viertel erkannt werden. Bei Geldstrafe gilt gem. § 49 I Nr. 2 S. 2 StGB dasselbe für die Höchstzahl der Tagessätze. Nimmt man also (entgegen dem hier vertretenen Standpunkt!) einen vermeidbaren Verbotsirrtum an, ist angesichts des Umstands, dass sich die drei Frauen alsbald nach der Tat der Polizei stellten, obwohl eine Entdeckung nicht sehr wahrscheinlich erschien, und sie ihre Tat zutiefst bereuen, mit einer Bewährungsstrafe (die gem. § 56 II StGB bis zu 2 Jahren möglich ist) jedenfalls dann zu rechnen, wenn § 46 StGB keine Vollstreckung der Strafe fordert.
Ergebnis zu A.:
Nach der hier vertretenen Auffassung liegt wegen Vermeidbarkeit eines eventuellen Verbotsirrtums kein Fall des § 17 S. 2 i.V.m. § 49 I StGB vor, sodass der Strafrahmen des § 306d StGB (Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe) greift.
Anmerkung:
Kann nicht geklärt werden, von welcher der drei Frauen die todbringende Himmelslaterne stammt, kann der für eine Strafbarkeit erforderliche Kausalzusammenhang nicht hergestellt werden. Alle drei Frauen würden daher strafrechtlich nicht haften („In dubio pro reo“).
B. Schadensersatzpflicht gem. § 823 I BGB
Zivilrechtlich ist die Täterin Schadensersatzansprüchen (§ 823 I BGB) ausgesetzt. Sie hat fahrlässig (siehe § 276 II BGB) fremdes Eigentum (Gehege, Tiere) widerrechtlich verletzt. Sollte sie privathaftpflichtversichert sein, dürfte eine Haftungsübernahme wahrscheinlich sein; anderenfalls würde sie bis an ihre Haftungsgrenze herangeführt werden, was freilich nicht genügen dürfte, den Schaden zu kompensieren. Das Leid und der Tod der Tiere sind keinesfalls kompensationsfähig, weder straf- noch zivilrechtlich.
Zivilrechtlich ist die Täterin Schadensersatzansprüchen (§ 823 I BGB) ausgesetzt. Sie hat fahrlässig (siehe § 276 II BGB) fremdes Eigentum (Gehege, Tiere) widerrechtlich verletzt. Sollte sie privathaftpflichtversichert sein, dürfte eine Haftungsübernahme wahrscheinlich sein; anderenfalls würde sie bis an ihre Haftungsgrenze herangeführt werden, was freilich nicht genügen dürfte, den Schaden zu kompensieren. Das Leid und der Tod der Tiere sind keinesfalls kompensationsfähig, weder straf- noch zivilrechtlich.
Anmerkung:
Anders als im Strafrecht kommt wegen § 830 I S. 2 BGB eine Haftung im Zivilrecht auch dann in Betracht, wenn nicht geklärt werden kann, von welcher der drei Frauen die todbringende Himmelslaterne stammt. Zudem stehen gem. § 830 II BGB Anstifter und Gehilfen dem Täter gleich.
Rolf Schmidt
(04.01.2020)
01.01.2020: Vorliegen eines Fernabsatzvertrags mit verbraucherschützendem Widerrufsrecht auch im Kfz-Handel?
LG Osnabrück, Urteil v. 16.09.2019 – 2 O 683/19
Mit Urteil v. 16.09.2019 hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück (2 O 683/19) entschieden, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags habe. Der von der Klägerin am 15.11.2018 erklärte Widerruf sei wirkungslos, da der Klägerin kein Widerrufsrecht gemäß § 355 i.V.m. §§ 312c, 312g I BGB zustehe. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
Sachverhalt: U betreibt in Norddeutschland ein Autohaus. Regelmäßig präsentiert er die zum Verkauf stehenden Autos auch auf einschlägigen Verkaufsplattformen im Internet. Die in München wohnende K meldete sich telefonisch bei U wegen eines BMW 320d GT, den dieser auf der Internetplattform P präsentierte. Schnell einigte man sich am Telefon auf einen Kaufpreis und die weitere Abwicklung, nämlich, dass K den Kaufpreis überweisen solle und U nach Geldeingang die Fahrzeugpapiere zusende, damit K den Wagen in München zulassen und danach bei U abholen könne, um mit dem zugelassenen Wagen nach Hause zu fahren. Weiterhin verabredete man, dass U das Bestellformular per E-Mail zusende. Daraufhin übersandte U per E-Mail ein Bestellformular mit der Bitte, dieses Formular zu unterschreiben und per E-Mail bzw. Fax an ihn zurückzusenden. In dem Formular hieß es:
„Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung innerhalb der in den Gebrauchtfahrzeugverkaufsbedingungen geregelten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt.“
Unter „Zahlungsweise und sonstige Vereinbarungen“ hieß es:
„Bezahlung vorab per Überweisung. Auslieferung nach Geldeingang …“
Eine Widerrufsbelehrung wurde K nicht übersandt.
K unterschrieb das Formular und sandte es per E-Mail an U zurück. Dieser übersandte K am nächsten Tag eine Rechnung über den Kaufpreis für das Fahrzeug i.H.v. 25.000,- €. Nachdem K diesen Betrag auf ein Konto des U überwiesen hatte, erhielt sie per Post die Fahrzeugpapiere, um den Pkw in München zulassen zu können. Nach erfolgter Zulassung holte sie den Wagen bei U ab und bescheinigte diesem die ordnungsgemäße Übergabe des Fahrzeugs.
Eine Woche später erklärte K den Widerruf ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrags gerichteten Willenserklärung und verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Kfz. U wendete ein, der Kaufvertrag sei erst mit der Lieferung des Fahrzeuges zustande gekommen. Zudem sei das Autohaus nicht organisatorisch auf einen Fernabsatz ausgerichtet. Zwar bewerbe er Fahrzeuge auf der eigenen Internetseite und auf Internet-Verkaufsplattformen, es gebe jedoch keine Möglichkeit, Verträge online abzuschließen. Es liege keine organisierte Struktur für ein Fernabsatzgeschäft vor.
I. Problemaufriss und Definitionen: Die Zivilrechtsordnung geht im Grundsatz davon aus, dass Verträge einzuhalten sind und eine Lösung vom Vertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Eine Art der Lösung vom Vertrag besteht in der Ausübung eines verbraucherschützenden Widerrufsrechts. Verbraucherschützende Widerrufsrechte hat der Gesetzgeber insbesondere aufgrund europarechtlicher Vorgaben in die nationale Rechtsordnung aufgenommen. Sie verhindern zwar nicht das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts, räumen aber im Rahmen eines Verbrauchervertrags dem Verbraucher die Möglichkeit ein, sich durch Widerruf von einem bereits geschlossenen Vertrag einseitig zu lösen. Man kann in diesem Zusammenhang daher von schwebender Wirksamkeit des Vertrags und einem einseitigen Auflösungsrecht des Verbrauchers sprechen (R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 968 mit Verweis auf BT-Drs. 14/2658, S. 47, 60; Grüneberg, in: Palandt, § 355 Rn. 3; Hager, JA 2011, 721, 722; abl. Kaiser, in: Staudinger, § 355 Rn. 18).
Zur Ausübung eines verbraucherschützenden Widerrufsrechts bedarf es also des Vorliegens eines Verbrauchervertrags und der gesetzlichen Einräumung eines Widerrufsrechts. Der Verbrauchervertrag wird gem. § 310 III BGB als ein Vertrag definiert, der zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher geschlossen wurde. Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft überwiegend zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Und Unternehmer ist gemäß der Legaldefinition in § 14 I BGB eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit Leistungen gegen ein Entgelt anbietet. Bei einem Verbrauchervertrag gelten kraft Verweisung in § 312 I BGB auch die Schutzvorschriften der §§ 312b ff. BGB und damit auch die Vorschrift des § 312c BGB hinsichtlich des Fernabsatzvertrags. Nach der Legaldefinition in § 312c I BGB sind Fernabsatzverträge Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Hinsichtlich des 1. Halbsatzes präziser ist Art. 2 Nr. 7 der insbesondere im Fernabsatzrecht vollharmonisierend wirkenden Verbraucherrechterichtlinie 2011/ 83/EU (siehe Erwägungsgründe 2, 4, 5, 7 und 9 sowie Art. 4 der Richtlinie) formuliert, wo es heißt: „wobei bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwendet wird/ werden.“ Die Richtlinie stellt also darauf ab, dass in der Zeit bis einschließlich des Vertragsschlusses ausschließlich Fernkommunikationsmittel eingesetzt worden sind (siehe R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 1026 a.E.). Bei Unklarheiten ist § 312c I BGB also richtlinienkonform auszulegen. Danach müssen, neben der Voraussetzung, dass auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher stehen, folgende Voraussetzungen für das Vorliegen eines Fernabsatzvertrags gegeben sein (R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 999):
Es müssen gem. § 312c I BGB in richtlinienkonformer Auslegung im Zeitraum von der Aufnahme von Vertragsverhandlungen bis einschließlich des Vertragsschlusses ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden.Nicht erforderlich ist, dass die Parteien dasselbe Fernkommunikationsmittel benutzen. So genügt es, wenn bspw. Verbraucher und Unternehmer telefonisch verhandeln, der Verbraucher dann per E-Mail das Vertragsangebot unterbreitet und der Unternehmer das Angebot durch Versenden der Ware konkludent annimmt (Grüneberg, in: Palandt, § 312c Rn 4; OLG Schleswig NJW 2004, 231). Verhandeln Verbraucher und Unternehmer aber zunächst im Ladengeschäft des Unternehmers und erfolgt lediglich der Vertragsschluss im Rahmen eines Fernkommunikationsmittels, liegt kein Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312c I BGB vor. An dem Kriterium „ausschließlich“ fehlt es auch, wenn der Verbraucher die Sache, die er via Fernkommunikationsmittel gekauft hat, im Ladengeschäft des Unternehmers abholt.
Schließlich muss der Vertrag im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein (§ 312c I Hs. 2 BGB). Jedoch handelt es sich bei dieser Voraussetzung – wie sich aus der gesetzlichen Formulierung „es sei denn“ ergibt – um einen (eng auszulegenden) Ausnahmetatbestand, für dessen Vorliegen zudem der Unternehmer die Beweislast trägt. Folge ist zunächst, dass an die Annahme eines solchen Vertriebs- oder Dienstleistungssystems insgesamt keine hohen Anforderungen zu stellen sind (BT-Drs. 17/12637, S. 50; BGH NJW-RR 2017, 368, 372; BGH NJW 2019, 303, 304). Voraussetzung für die Existenz eines organisierten Vertriebssystems ist (lediglich), dass der Unternehmer mit personeller und sachlicher Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen (BT-Drs. 14/2658, S. 30; BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Bei Betreiben einer „Bestellhotline“ oder eines Onlineshops mit Warenversand wird daher ohne weiteres ein Fernabsatzsystem vorliegen, jedenfalls, wenn sich der Unternehmer systematisch die Technik der Fernkommunikation zunutze macht und sich für den Betriebsablauf in personeller und sächlicher Hinsicht ein eingespieltes Verfahren entwickelt hat (BGH NJW 2004, 3699, 3701). Ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem ist nach dem BGH auch dann nicht schon zu verneinen, wenn der Unternehmer über kein automatisiertes Verfahren verfügt, sondern den Ablauf manuell steuern muss (BGH NJW 2019, 303, 304), etwa dergestalt, dass er zum Abschluss des Vertrags keinen vorgefertigten Standard- oder Serienbrief verwendet, sondern ein individuelles Anschreiben (BGH NJW 2019, 303, 304). Daher ist von einem hinreichend organisierten Vertriebssystem stets dann auszugehen, wenn der Unternehmer in gewisser Regelmäßigkeit seine Waren im Internet (auch auf einer externen Verkaufsplattform – BT-Drs. 17/12637, S. 50) präsentiert und dem Verbraucher unmittelbar nach der Bestellung die nötigen (individuellen) Unterlagen zusendet. So führt der BGH bspw. aus: „Ein Immobilienmakler nutzt ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem, wenn er auf einem Onlinemarktplatz (hier: „ImmobilienScout24“) von ihm vertriebene Immobilien bewirbt, den Kontakt zu seinen Kunden auf elektronischem oder telefonischem Weg herstellt und der Vertrag in dieser Weise zustande kommt. Es kommt nicht darauf an, dass die Durchführung eines solchen Maklervertrags nicht auf elektronischem Wege erfolgt“ (BGH NJW 2017, 1024 LS 3). An einem für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystem fehlt es aber, wenn der Unternehmer ein stationäres Ladengeschäft betreibt, das auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert ist, und dabei nur gelegentlich und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372) bzw. nach telefonischer Bestellung ausnahmsweise auf den Wunsch des Kunden die Ware per Post versendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Bestellt in einem solchem Fall ein Kunde telefonisch (oder via E-Mail) eine Ware und erfolgt der Vertragsschluss noch am Telefon oder anschließend etwa via E-Mail oder Fax, liegt kein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c I BGB (mit einem Widerrufsrecht gem. §§ 312g I, 355 BGB) vor, wobei wegen der gesetzlichen Formulierung „es sei denn“ weiterhin folgt, dass für das Vorliegen des Ausnahmetatbestands der Unternehmer die Beweislast trägt (BT-Drs. 17/12637, S. 50; BGH MDR 2016, 817 f.; MüKo-Wendehorst, § 312c Rn 27). Der Unternehmer muss also die gesetzliche Vermutungsregel widerlegen und den Beweis erbringen, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt ist. Hintergrund ist, dass der Verbraucher die interne Vertriebsorganisation des Unternehmers regelmäßig nicht erkennen kann, er bei Fernabsatzgeschäften also vom Vorliegen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems ausgehen darf. Dieser in Auslegung des § 312c I Hs. 2 BGB vorgenommenen Beweislastumkehr kann der Unternehmer auch nicht dadurch begegnen, dass er es unterlässt, die verbraucherschützenden Belehrungen, insbesondere die Widerrufsbelehrung, zu übermitteln. Denn die Widerrufsbelehrung ist nicht konstitutiv für die Annahme eines Fernabsatzvertrags; ihr Fehlen führt lediglich zur Verlängerung der Widerrufsfrist (hier: insgesamt 12 Monate und 14 Tage, § 356 III S. 2 BGB) und ggf. zu wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen.
LG Osnabrück, Urteil v. 16.09.2019 – 2 O 683/19
Mit Urteil v. 16.09.2019 hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück (2 O 683/19) entschieden, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags habe. Der von der Klägerin am 15.11.2018 erklärte Widerruf sei wirkungslos, da der Klägerin kein Widerrufsrecht gemäß § 355 i.V.m. §§ 312c, 312g I BGB zustehe. Ob das Urteil überzeugt, soll im Folgenden untersucht werden.
Sachverhalt: U betreibt in Norddeutschland ein Autohaus. Regelmäßig präsentiert er die zum Verkauf stehenden Autos auch auf einschlägigen Verkaufsplattformen im Internet. Die in München wohnende K meldete sich telefonisch bei U wegen eines BMW 320d GT, den dieser auf der Internetplattform P präsentierte. Schnell einigte man sich am Telefon auf einen Kaufpreis und die weitere Abwicklung, nämlich, dass K den Kaufpreis überweisen solle und U nach Geldeingang die Fahrzeugpapiere zusende, damit K den Wagen in München zulassen und danach bei U abholen könne, um mit dem zugelassenen Wagen nach Hause zu fahren. Weiterhin verabredete man, dass U das Bestellformular per E-Mail zusende. Daraufhin übersandte U per E-Mail ein Bestellformular mit der Bitte, dieses Formular zu unterschreiben und per E-Mail bzw. Fax an ihn zurückzusenden. In dem Formular hieß es:
„Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung innerhalb der in den Gebrauchtfahrzeugverkaufsbedingungen geregelten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt.“
Unter „Zahlungsweise und sonstige Vereinbarungen“ hieß es:
„Bezahlung vorab per Überweisung. Auslieferung nach Geldeingang …“
Eine Widerrufsbelehrung wurde K nicht übersandt.
K unterschrieb das Formular und sandte es per E-Mail an U zurück. Dieser übersandte K am nächsten Tag eine Rechnung über den Kaufpreis für das Fahrzeug i.H.v. 25.000,- €. Nachdem K diesen Betrag auf ein Konto des U überwiesen hatte, erhielt sie per Post die Fahrzeugpapiere, um den Pkw in München zulassen zu können. Nach erfolgter Zulassung holte sie den Wagen bei U ab und bescheinigte diesem die ordnungsgemäße Übergabe des Fahrzeugs.
Eine Woche später erklärte K den Widerruf ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrags gerichteten Willenserklärung und verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Kfz. U wendete ein, der Kaufvertrag sei erst mit der Lieferung des Fahrzeuges zustande gekommen. Zudem sei das Autohaus nicht organisatorisch auf einen Fernabsatz ausgerichtet. Zwar bewerbe er Fahrzeuge auf der eigenen Internetseite und auf Internet-Verkaufsplattformen, es gebe jedoch keine Möglichkeit, Verträge online abzuschließen. Es liege keine organisierte Struktur für ein Fernabsatzgeschäft vor.
I. Problemaufriss und Definitionen: Die Zivilrechtsordnung geht im Grundsatz davon aus, dass Verträge einzuhalten sind und eine Lösung vom Vertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Eine Art der Lösung vom Vertrag besteht in der Ausübung eines verbraucherschützenden Widerrufsrechts. Verbraucherschützende Widerrufsrechte hat der Gesetzgeber insbesondere aufgrund europarechtlicher Vorgaben in die nationale Rechtsordnung aufgenommen. Sie verhindern zwar nicht das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts, räumen aber im Rahmen eines Verbrauchervertrags dem Verbraucher die Möglichkeit ein, sich durch Widerruf von einem bereits geschlossenen Vertrag einseitig zu lösen. Man kann in diesem Zusammenhang daher von schwebender Wirksamkeit des Vertrags und einem einseitigen Auflösungsrecht des Verbrauchers sprechen (R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 968 mit Verweis auf BT-Drs. 14/2658, S. 47, 60; Grüneberg, in: Palandt, § 355 Rn. 3; Hager, JA 2011, 721, 722; abl. Kaiser, in: Staudinger, § 355 Rn. 18).
Zur Ausübung eines verbraucherschützenden Widerrufsrechts bedarf es also des Vorliegens eines Verbrauchervertrags und der gesetzlichen Einräumung eines Widerrufsrechts. Der Verbrauchervertrag wird gem. § 310 III BGB als ein Vertrag definiert, der zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher geschlossen wurde. Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft überwiegend zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Und Unternehmer ist gemäß der Legaldefinition in § 14 I BGB eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit Leistungen gegen ein Entgelt anbietet. Bei einem Verbrauchervertrag gelten kraft Verweisung in § 312 I BGB auch die Schutzvorschriften der §§ 312b ff. BGB und damit auch die Vorschrift des § 312c BGB hinsichtlich des Fernabsatzvertrags. Nach der Legaldefinition in § 312c I BGB sind Fernabsatzverträge Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Hinsichtlich des 1. Halbsatzes präziser ist Art. 2 Nr. 7 der insbesondere im Fernabsatzrecht vollharmonisierend wirkenden Verbraucherrechterichtlinie 2011/ 83/EU (siehe Erwägungsgründe 2, 4, 5, 7 und 9 sowie Art. 4 der Richtlinie) formuliert, wo es heißt: „wobei bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwendet wird/ werden.“ Die Richtlinie stellt also darauf ab, dass in der Zeit bis einschließlich des Vertragsschlusses ausschließlich Fernkommunikationsmittel eingesetzt worden sind (siehe R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 1026 a.E.). Bei Unklarheiten ist § 312c I BGB also richtlinienkonform auszulegen. Danach müssen, neben der Voraussetzung, dass auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher stehen, folgende Voraussetzungen für das Vorliegen eines Fernabsatzvertrags gegeben sein (R. Schmidt, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 2019, Rn. 999):
- Vorliegen eines Fernkommunikationsmittels
- Im Zeitraum von der Aufnahme von Vertragsverhandlungen bis einschließlich des Vertragsschlusses müssen ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet worden sein
- Der Vertrag muss im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein
Es müssen gem. § 312c I BGB in richtlinienkonformer Auslegung im Zeitraum von der Aufnahme von Vertragsverhandlungen bis einschließlich des Vertragsschlusses ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden.Nicht erforderlich ist, dass die Parteien dasselbe Fernkommunikationsmittel benutzen. So genügt es, wenn bspw. Verbraucher und Unternehmer telefonisch verhandeln, der Verbraucher dann per E-Mail das Vertragsangebot unterbreitet und der Unternehmer das Angebot durch Versenden der Ware konkludent annimmt (Grüneberg, in: Palandt, § 312c Rn 4; OLG Schleswig NJW 2004, 231). Verhandeln Verbraucher und Unternehmer aber zunächst im Ladengeschäft des Unternehmers und erfolgt lediglich der Vertragsschluss im Rahmen eines Fernkommunikationsmittels, liegt kein Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312c I BGB vor. An dem Kriterium „ausschließlich“ fehlt es auch, wenn der Verbraucher die Sache, die er via Fernkommunikationsmittel gekauft hat, im Ladengeschäft des Unternehmers abholt.
Schließlich muss der Vertrag im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein (§ 312c I Hs. 2 BGB). Jedoch handelt es sich bei dieser Voraussetzung – wie sich aus der gesetzlichen Formulierung „es sei denn“ ergibt – um einen (eng auszulegenden) Ausnahmetatbestand, für dessen Vorliegen zudem der Unternehmer die Beweislast trägt. Folge ist zunächst, dass an die Annahme eines solchen Vertriebs- oder Dienstleistungssystems insgesamt keine hohen Anforderungen zu stellen sind (BT-Drs. 17/12637, S. 50; BGH NJW-RR 2017, 368, 372; BGH NJW 2019, 303, 304). Voraussetzung für die Existenz eines organisierten Vertriebssystems ist (lediglich), dass der Unternehmer mit personeller und sachlicher Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen (BT-Drs. 14/2658, S. 30; BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Bei Betreiben einer „Bestellhotline“ oder eines Onlineshops mit Warenversand wird daher ohne weiteres ein Fernabsatzsystem vorliegen, jedenfalls, wenn sich der Unternehmer systematisch die Technik der Fernkommunikation zunutze macht und sich für den Betriebsablauf in personeller und sächlicher Hinsicht ein eingespieltes Verfahren entwickelt hat (BGH NJW 2004, 3699, 3701). Ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem ist nach dem BGH auch dann nicht schon zu verneinen, wenn der Unternehmer über kein automatisiertes Verfahren verfügt, sondern den Ablauf manuell steuern muss (BGH NJW 2019, 303, 304), etwa dergestalt, dass er zum Abschluss des Vertrags keinen vorgefertigten Standard- oder Serienbrief verwendet, sondern ein individuelles Anschreiben (BGH NJW 2019, 303, 304). Daher ist von einem hinreichend organisierten Vertriebssystem stets dann auszugehen, wenn der Unternehmer in gewisser Regelmäßigkeit seine Waren im Internet (auch auf einer externen Verkaufsplattform – BT-Drs. 17/12637, S. 50) präsentiert und dem Verbraucher unmittelbar nach der Bestellung die nötigen (individuellen) Unterlagen zusendet. So führt der BGH bspw. aus: „Ein Immobilienmakler nutzt ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem, wenn er auf einem Onlinemarktplatz (hier: „ImmobilienScout24“) von ihm vertriebene Immobilien bewirbt, den Kontakt zu seinen Kunden auf elektronischem oder telefonischem Weg herstellt und der Vertrag in dieser Weise zustande kommt. Es kommt nicht darauf an, dass die Durchführung eines solchen Maklervertrags nicht auf elektronischem Wege erfolgt“ (BGH NJW 2017, 1024 LS 3). An einem für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystem fehlt es aber, wenn der Unternehmer ein stationäres Ladengeschäft betreibt, das auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert ist, und dabei nur gelegentlich und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372) bzw. nach telefonischer Bestellung ausnahmsweise auf den Wunsch des Kunden die Ware per Post versendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Bestellt in einem solchem Fall ein Kunde telefonisch (oder via E-Mail) eine Ware und erfolgt der Vertragsschluss noch am Telefon oder anschließend etwa via E-Mail oder Fax, liegt kein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c I BGB (mit einem Widerrufsrecht gem. §§ 312g I, 355 BGB) vor, wobei wegen der gesetzlichen Formulierung „es sei denn“ weiterhin folgt, dass für das Vorliegen des Ausnahmetatbestands der Unternehmer die Beweislast trägt (BT-Drs. 17/12637, S. 50; BGH MDR 2016, 817 f.; MüKo-Wendehorst, § 312c Rn 27). Der Unternehmer muss also die gesetzliche Vermutungsregel widerlegen und den Beweis erbringen, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt ist. Hintergrund ist, dass der Verbraucher die interne Vertriebsorganisation des Unternehmers regelmäßig nicht erkennen kann, er bei Fernabsatzgeschäften also vom Vorliegen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems ausgehen darf. Dieser in Auslegung des § 312c I Hs. 2 BGB vorgenommenen Beweislastumkehr kann der Unternehmer auch nicht dadurch begegnen, dass er es unterlässt, die verbraucherschützenden Belehrungen, insbesondere die Widerrufsbelehrung, zu übermitteln. Denn die Widerrufsbelehrung ist nicht konstitutiv für die Annahme eines Fernabsatzvertrags; ihr Fehlen führt lediglich zur Verlängerung der Widerrufsfrist (hier: insgesamt 12 Monate und 14 Tage, § 356 III S. 2 BGB) und ggf. zu wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen.
Nach diesen Grundsätzen sind Fernabsatzgeschäfte auch in der Kfz-Branche
denkbar, sofern nur der Unternehmer mit personeller und sachlicher Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind, um regelmäßig oder zumindest über den Einzelfall hinaus im Fernabsatz zu tätigende (auch über Online-Verkaufsplattformen zustande kommende) Geschäfte zu bewältigen (s.o.). Insbesondere ist kein automatisiertes Vertriebssystem erforderlich. Bestellt in einem solchen Fall ein Kunde telefonisch (oder via E-Mail) eine Ware und erfolgt der Vertragsschluss noch am Telefon oder anschließend etwa via E-Mail oder Fax, liegt ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c I BGB (mit einem Widerrufsrecht gem. §§ 312g I, 355 BGB) vor. Darum ging es im zu besprechenden Fall.
II. Zum Fall: Anspruchsgrundlage des Rückzahlungsbegehrens könnten §§ 355, 312g I, 312c I, 357 I BGB sein. Dass es sich bei K um eine Verbraucherin i.S.d. § 13 BGB und bei U um einen Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB handelt, bedarf keiner Erörterung. Mithin liegt ein Verbrauchervertrag vor. Bei diesem müsste es sich aber um einen Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312c I BGB handeln. Das ist (unter Beachtung der Vorgaben des Art. 2 Nr. 7 der Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU) neben der Voraussetzung, dass auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher stehen, der Fall, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
Das ist zweifelhaft. Nach der hier vertretenen Auffassung kam der Kaufvertrag sehr wohl mittels Fernkommunikationsmittel, und nicht erst in den Geschäftsräumen des U, zustande. Zwar spricht das Bestellformular durchaus von „schriftlicher Bestätigung“, um den Vertragsschluss herbeizuführen. Jedoch kann – entgegen der Auffassung des LG – in der schriftlichen Rechnung sehr wohl – sogar erst recht – eine Annahmeerklärung gesehen werden. Es ist lebensfern, anzunehmen, ein Autohaus verschicke eine schriftliche Rechnung, wenn es nicht von einem bereits geschlossenen Vertrags ausgeht. Oder anders formuliert: Führt bereits eine Auftragsbestätigung den Vertragsschluss herbei, gilt das erst recht für eine schriftliche Rechnung (vorliegend sogar i.V.m. der Zusendung der Fahrzeugpapiere, d.h. der Zulassungsbescheinigungen I und II). Zugleich liegt – ausgehend von der Annahme, dass es sich bei den Klauseln im Bestellformular um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) handelte – damit eine vorrangige Individualvereinbarung i.S.d. § 305b BGB vor.
Wenn also ein Autohaus eine Rechnung zusendet, den Kaufpreis erhalten hat und auch die Fahrzeugpapiere (d.h. Zulassungsbescheinigungen I und II) an den Käufer verschickt, spricht nichts dafür, dass das Autohaus nicht von einem bereits geschlossenen Kaufvertrag ausgeht bzw. ausgehen darf. Hinzu kommt noch ein weiteres Argument: Geht schon der BGH, der übrigens auch vom LG Osnabrück in Bezug genommen wird, von einem konkludenten Vertragsschluss aus, wenn der Unternehmer (im Fall war es ein Grundstücksmakler) mit einer E-Mail die Vereinbarung eines Besichtigungstermins ankündigt und die vom Verbraucher übermittelte Information über die Lage des Objekts entgegennimmt (BGH NJW-RR 2017, 368, 370), muss man im vorliegenden Fall mit der Übermittlung der schriftlichen Rechnung und dem Zusenden der Zulassungsbescheinigungen erst recht von einem Vertragsschluss ausgehen.
Ist danach der Kaufvertrag mittels Fernkommunikationsmittel zustande gekommen, steht es der Einordnung als Fernabsatzvertrag nicht entgegen, dass K den Wagen persönlich im Geschäft des Unternehmers abgeholt hat. Denn dies erfolgte gerade nach Vertragsschluss.
Der Vertrag müsste letztlich aber auch – um einen Fernabsatzvertrag annehmen zu können – im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein. Wenn überhaupt, scheitert – obwohl an dieses Kriterium keine allzu großen Anforderungen zu stellen sind – im vorliegenden Fall die Annahme eines Fernabsatzvertrags daran.
Voraussetzung für die Annahme eines organisierten Vertriebssystems ist, dass der Unternehmer mit personeller und sachlicher Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind, um in gewisser Regelmäßigkeit, jedenfalls über den Einzelfall hinaus, im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Nach der Rechtsprechung des BGH fehlt es daran, wenn der Unternehmer ein stationäres Ladengeschäft betreibt, das auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert ist, und dabei nur gelegentlich und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372) bzw. nach telefonischer Bestellung ausnahmsweise auf den Wunsch des Kunden die Ware per Post versendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Das LG Osnabrück ist der Ansicht, daran habe es im vorliegenden Fall gefehlt, weil U einen stationären Autohandel betreibe, der auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert sei, und U nur ausnahmsweise und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwende. Wer seine Leistungen ausschließlich vor Ort erbringe, solle durch das Fernabsatzrecht nicht davon abgehalten werden, ausnahmsweise auch eine telefonische Bestellung (ergänze: oder eine per E-Mail) entgegenzunehmen.
IV. Bewertung: Wie die Entscheidung verdeutlicht, ist es stets eine Tatfrage, ob das für die Annahme eines Fernabsatzgeschäfts erforderliche Mindestmaß an Organisation vorliegt. Auch wenn nach Auffassung des Gesetzgebers und des BGH die Anforderungen an eine Fernabsatzstruktur nicht sonderlich hoch sind und ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem nicht schon dann zu verneinen ist, wenn der Unternehmer über kein automatisiertes Verfahren verfügt, sondern den Ablauf manuell steuern muss (BGH NJW 2019, 303, 304), so muss doch der Unternehmer in gewisser Regelmäßigkeit seine Waren im Internet (auch auf einer externen Verkaufsplattform – BT-Drs. 17/12637, S. 50) präsentieren und die Ware versenden. Freilich muss der Unternehmer, der sich auf die Ausschlussklausel beruft, die gesetzliche Vermutungsregel des § 312c I BGB („es sei denn...“) widerlegen. Das kann ein Autohändler etwa dadurch, dass er die einzelnen Verkaufsprozesse dokumentiert und so den Nachweis erbringt, dass er trotz Präsentation der Fahrzeuge in den Online-Fahrzeugverkaufsplattformen lediglich ausnahmsweise ein Auto versendet. Nach der hier vertretenen Auffassung sind die Hürden aber hoch, denn das verbraucherschützende Widerrufsrecht wird weit verstanden. Das hat seinen Grund darin, dass – anders als im stationären Handel – im Fernabsatz üblicherweise Vergleichs-, Vorführ- und Beratungsmöglichkeiten fehlen. Der Verbraucher kauft regelmäßig allein aufgrund einer Beschreibung, von Fotos und der Aussagen des Händlers. Er ist also darauf angewiesen, die gekaufte Ware nach Erhalt zu Hause zu prüfen und ggf. deren Funktionstüchtigkeit zu testen. Stellt er fest, dass die Sache nicht den Erwartungen entspricht, soll er sich durch einseitige Erklärung vom Vertrag lösen können. Hinzukommt, dass Autos, die in den Online-Fahrzeugverkaufsplattformen präsentiert werden, mittlerweile sehr häufig, und nicht nur ausnahmsweise, im Fernabsatz verkauft, was die Anforderungen an die Widerlegung der gesetzlichen Vermutung erhöht. Einem Kfz-Händler, der die mit einem Fernabsatzgeschäft verbundenen Folgen vermeiden möchte, ist es unbenommen, auf einen Vertragsschluss vor Ort zu bestehen. Jedenfalls führt das Fehlen einer Widerrufsbelehrung nicht dazu, einen Fernabsatzvertrag zu verneinen. Auch im Verwaltungsrecht führt das Fehlen einer Rechtsbehelfsbelehrung bei einem belastenden Verwaltungsakt nicht zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts, sondern lediglich zur Verlängerung der Anfechtungsfrist (siehe § 58 II VwGO). Das Gleiche gilt bei Fernabsatzverträgen. Die Frist beträgt hier insgesamt 12 Monate und 14 Tage (§ 356 III S. 2 BGB). Bei der Frage nach dem Vorliegen eines Fernabsatzvertrags sind allein die Kriterien des § 312c I BGB ausschlaggebend. Wenn ein Unternehmer, der via Fernkommunikationsmittel einen Vertrag mit einem Verbraucher schließt, auf die Zusendung einer Widerrufsbelehrung (auch rechtsirrtümlich) verzichtet, kann dies nicht zu Lasten des Verbrauchers gehen.
V. Ausblick: Da der Internethandel dem stationären Handel zunehmend den Rang abläuft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der Autokauf im Internet „zur Normalität“ wird. Zwar wird der Autokauf niemals ein „Geschäft des täglichen Lebens“ und damit kein (Internet-)Massengeschäft darstellen, aber im Sinne der Kundengewinnung und der Absatzförderung dürfte ein erweiterter Aktionsradius, der auch die Lieferung von im Fernabsatz gekauften Autos einschließt, zu erwarten sein. Dann auch dürfte es den Autohäusern zunehmend schwerer fallen, die Vermutungsregel des § 312c I BGB („es sei denn...“) zu widerlegen. Liegt danach ein Fernabsatzgeschäft vor, sind von den „Online-Händlern“ auch die allgemeinen Verkäuferpflichten zu beachten. Dazu zählen insbesondere die umfangreichen Informations- und Belehrungspflichten (in Bezug auf die Bestätigung des Bestelleingangs, das Bestehen eines Widerrufsrechts etc.) vor Vertragsschluss. Folgen bei Verstößen gegen die Informations- und Belehrungspflichten sind nicht nur eine Verlängerung der Widerrufsfrist (siehe § 356 III S. 2 BGB: auf 1 Jahr und 10 Monate), sondern v.a. auch die Möglichkeit der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Keinesfalls führen unterlassene Belehrungspflichten zur Verneinung des für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems.
Rolf Schmidt (01.01.2020)
II. Zum Fall: Anspruchsgrundlage des Rückzahlungsbegehrens könnten §§ 355, 312g I, 312c I, 357 I BGB sein. Dass es sich bei K um eine Verbraucherin i.S.d. § 13 BGB und bei U um einen Unternehmer i.S.d. § 14 I BGB handelt, bedarf keiner Erörterung. Mithin liegt ein Verbrauchervertrag vor. Bei diesem müsste es sich aber um einen Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312c I BGB handeln. Das ist (unter Beachtung der Vorgaben des Art. 2 Nr. 7 der Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU) neben der Voraussetzung, dass auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher stehen, der Fall, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
- Vorliegen eines Fernkommunikationsmittels
- Im Zeitraum von der Aufnahme von Vertragsverhandlungen bis einschließlich des Vertragsschlusses müssen ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet worden sein
- Der Vertrag muss im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein
Das ist zweifelhaft. Nach der hier vertretenen Auffassung kam der Kaufvertrag sehr wohl mittels Fernkommunikationsmittel, und nicht erst in den Geschäftsräumen des U, zustande. Zwar spricht das Bestellformular durchaus von „schriftlicher Bestätigung“, um den Vertragsschluss herbeizuführen. Jedoch kann – entgegen der Auffassung des LG – in der schriftlichen Rechnung sehr wohl – sogar erst recht – eine Annahmeerklärung gesehen werden. Es ist lebensfern, anzunehmen, ein Autohaus verschicke eine schriftliche Rechnung, wenn es nicht von einem bereits geschlossenen Vertrags ausgeht. Oder anders formuliert: Führt bereits eine Auftragsbestätigung den Vertragsschluss herbei, gilt das erst recht für eine schriftliche Rechnung (vorliegend sogar i.V.m. der Zusendung der Fahrzeugpapiere, d.h. der Zulassungsbescheinigungen I und II). Zugleich liegt – ausgehend von der Annahme, dass es sich bei den Klauseln im Bestellformular um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) handelte – damit eine vorrangige Individualvereinbarung i.S.d. § 305b BGB vor.
Wenn also ein Autohaus eine Rechnung zusendet, den Kaufpreis erhalten hat und auch die Fahrzeugpapiere (d.h. Zulassungsbescheinigungen I und II) an den Käufer verschickt, spricht nichts dafür, dass das Autohaus nicht von einem bereits geschlossenen Kaufvertrag ausgeht bzw. ausgehen darf. Hinzu kommt noch ein weiteres Argument: Geht schon der BGH, der übrigens auch vom LG Osnabrück in Bezug genommen wird, von einem konkludenten Vertragsschluss aus, wenn der Unternehmer (im Fall war es ein Grundstücksmakler) mit einer E-Mail die Vereinbarung eines Besichtigungstermins ankündigt und die vom Verbraucher übermittelte Information über die Lage des Objekts entgegennimmt (BGH NJW-RR 2017, 368, 370), muss man im vorliegenden Fall mit der Übermittlung der schriftlichen Rechnung und dem Zusenden der Zulassungsbescheinigungen erst recht von einem Vertragsschluss ausgehen.
Ist danach der Kaufvertrag mittels Fernkommunikationsmittel zustande gekommen, steht es der Einordnung als Fernabsatzvertrag nicht entgegen, dass K den Wagen persönlich im Geschäft des Unternehmers abgeholt hat. Denn dies erfolgte gerade nach Vertragsschluss.
Der Vertrag müsste letztlich aber auch – um einen Fernabsatzvertrag annehmen zu können – im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems abgeschlossen worden sein. Wenn überhaupt, scheitert – obwohl an dieses Kriterium keine allzu großen Anforderungen zu stellen sind – im vorliegenden Fall die Annahme eines Fernabsatzvertrags daran.
Voraussetzung für die Annahme eines organisierten Vertriebssystems ist, dass der Unternehmer mit personeller und sachlicher Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind, um in gewisser Regelmäßigkeit, jedenfalls über den Einzelfall hinaus, im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Nach der Rechtsprechung des BGH fehlt es daran, wenn der Unternehmer ein stationäres Ladengeschäft betreibt, das auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert ist, und dabei nur gelegentlich und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372) bzw. nach telefonischer Bestellung ausnahmsweise auf den Wunsch des Kunden die Ware per Post versendet (BGH NJW-RR 2017, 368, 372). Das LG Osnabrück ist der Ansicht, daran habe es im vorliegenden Fall gefehlt, weil U einen stationären Autohandel betreibe, der auch nur für den Verkauf vor Ort organisiert sei, und U nur ausnahmsweise und zufällig zu Vertragsschlüssen Fernkommunikationsmittel verwende. Wer seine Leistungen ausschließlich vor Ort erbringe, solle durch das Fernabsatzrecht nicht davon abgehalten werden, ausnahmsweise auch eine telefonische Bestellung (ergänze: oder eine per E-Mail) entgegenzunehmen.
IV. Bewertung: Wie die Entscheidung verdeutlicht, ist es stets eine Tatfrage, ob das für die Annahme eines Fernabsatzgeschäfts erforderliche Mindestmaß an Organisation vorliegt. Auch wenn nach Auffassung des Gesetzgebers und des BGH die Anforderungen an eine Fernabsatzstruktur nicht sonderlich hoch sind und ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem nicht schon dann zu verneinen ist, wenn der Unternehmer über kein automatisiertes Verfahren verfügt, sondern den Ablauf manuell steuern muss (BGH NJW 2019, 303, 304), so muss doch der Unternehmer in gewisser Regelmäßigkeit seine Waren im Internet (auch auf einer externen Verkaufsplattform – BT-Drs. 17/12637, S. 50) präsentieren und die Ware versenden. Freilich muss der Unternehmer, der sich auf die Ausschlussklausel beruft, die gesetzliche Vermutungsregel des § 312c I BGB („es sei denn...“) widerlegen. Das kann ein Autohändler etwa dadurch, dass er die einzelnen Verkaufsprozesse dokumentiert und so den Nachweis erbringt, dass er trotz Präsentation der Fahrzeuge in den Online-Fahrzeugverkaufsplattformen lediglich ausnahmsweise ein Auto versendet. Nach der hier vertretenen Auffassung sind die Hürden aber hoch, denn das verbraucherschützende Widerrufsrecht wird weit verstanden. Das hat seinen Grund darin, dass – anders als im stationären Handel – im Fernabsatz üblicherweise Vergleichs-, Vorführ- und Beratungsmöglichkeiten fehlen. Der Verbraucher kauft regelmäßig allein aufgrund einer Beschreibung, von Fotos und der Aussagen des Händlers. Er ist also darauf angewiesen, die gekaufte Ware nach Erhalt zu Hause zu prüfen und ggf. deren Funktionstüchtigkeit zu testen. Stellt er fest, dass die Sache nicht den Erwartungen entspricht, soll er sich durch einseitige Erklärung vom Vertrag lösen können. Hinzukommt, dass Autos, die in den Online-Fahrzeugverkaufsplattformen präsentiert werden, mittlerweile sehr häufig, und nicht nur ausnahmsweise, im Fernabsatz verkauft, was die Anforderungen an die Widerlegung der gesetzlichen Vermutung erhöht. Einem Kfz-Händler, der die mit einem Fernabsatzgeschäft verbundenen Folgen vermeiden möchte, ist es unbenommen, auf einen Vertragsschluss vor Ort zu bestehen. Jedenfalls führt das Fehlen einer Widerrufsbelehrung nicht dazu, einen Fernabsatzvertrag zu verneinen. Auch im Verwaltungsrecht führt das Fehlen einer Rechtsbehelfsbelehrung bei einem belastenden Verwaltungsakt nicht zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts, sondern lediglich zur Verlängerung der Anfechtungsfrist (siehe § 58 II VwGO). Das Gleiche gilt bei Fernabsatzverträgen. Die Frist beträgt hier insgesamt 12 Monate und 14 Tage (§ 356 III S. 2 BGB). Bei der Frage nach dem Vorliegen eines Fernabsatzvertrags sind allein die Kriterien des § 312c I BGB ausschlaggebend. Wenn ein Unternehmer, der via Fernkommunikationsmittel einen Vertrag mit einem Verbraucher schließt, auf die Zusendung einer Widerrufsbelehrung (auch rechtsirrtümlich) verzichtet, kann dies nicht zu Lasten des Verbrauchers gehen.
V. Ausblick: Da der Internethandel dem stationären Handel zunehmend den Rang abläuft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der Autokauf im Internet „zur Normalität“ wird. Zwar wird der Autokauf niemals ein „Geschäft des täglichen Lebens“ und damit kein (Internet-)Massengeschäft darstellen, aber im Sinne der Kundengewinnung und der Absatzförderung dürfte ein erweiterter Aktionsradius, der auch die Lieferung von im Fernabsatz gekauften Autos einschließt, zu erwarten sein. Dann auch dürfte es den Autohäusern zunehmend schwerer fallen, die Vermutungsregel des § 312c I BGB („es sei denn...“) zu widerlegen. Liegt danach ein Fernabsatzgeschäft vor, sind von den „Online-Händlern“ auch die allgemeinen Verkäuferpflichten zu beachten. Dazu zählen insbesondere die umfangreichen Informations- und Belehrungspflichten (in Bezug auf die Bestätigung des Bestelleingangs, das Bestehen eines Widerrufsrechts etc.) vor Vertragsschluss. Folgen bei Verstößen gegen die Informations- und Belehrungspflichten sind nicht nur eine Verlängerung der Widerrufsfrist (siehe § 356 III S. 2 BGB: auf 1 Jahr und 10 Monate), sondern v.a. auch die Möglichkeit der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Keinesfalls führen unterlassene Belehrungspflichten zur Verneinung des für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems.
Rolf Schmidt (01.01.2020)